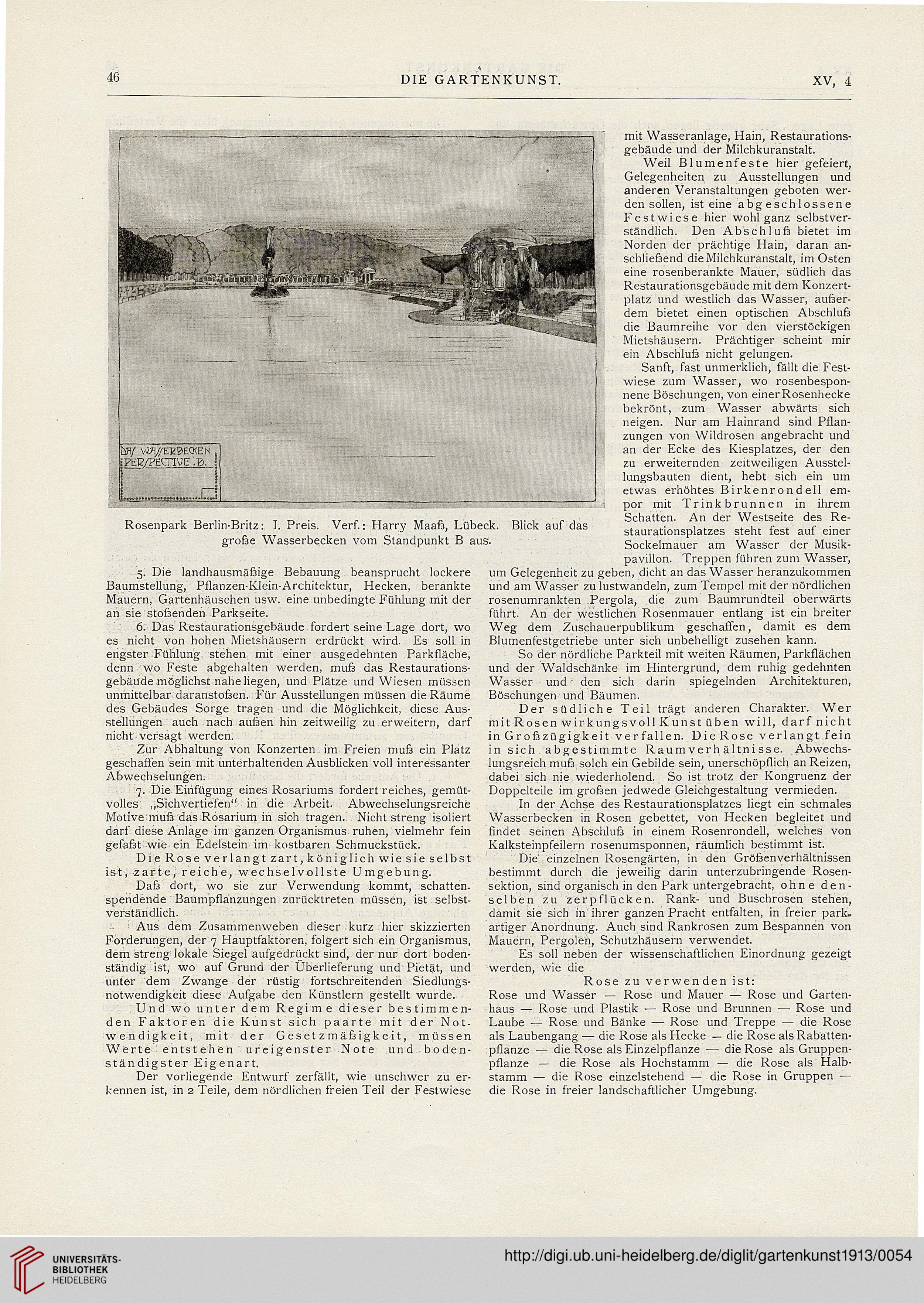46
DIE GARTENKUNST.
XV, 4
Rosenpark Berlin-Britz: I. Preis. Verf.: Harry Maaß, Lübeck. Blick auf das
große Wasserbecken vom Standpunkt B aus.
5. Die landhausmäßige Bebauung beansprucht lockere
Baumstellung, Pflanzen-Klein-Architektur, Hecken, berankte
Mauern, Gartenhäuschen usw. eine unbedingte Fühlung mit der
an sie stoßenden Parkseite.
6. Das Restaurationsgebäude fordert seine Lage dort, wo
es nicht von hohen Mietshäusern erdrückt wird. Es soll in
engster Fühlung, stehen mit einer ausgedehnten Parkfläche,
denn wo Feste abgehalten werden, muß das Restaurations-
gebäüde möglichst nahe liegen, und Plätze und Wiesen müssen
unmittelbar daranstoßen. Für Ausstellungen müssen die Räume
des Gebäudes Sorge tragen und die Möglichkeit, diese Aus-
stellungen auch nach außen hin zeitweilig zu erweitern, darf
nicht versagt werden.
Zur Abhaltung von Konzerten im Freien muß ein Platz
geschaffen sein mit unterhaltenden Ausblicken voll interessanter
Abwechselungen.
7. Die Einfügung eines Rosariums fordert reiches, gemüt-
volles „Sichvertiefen“ in die Arbeit. Abwechselungsreiche
Motive muß das Rosarium in sich tragen. Nicht streng isoliert
darf diese Anlage im ganzen Organismus ruhen, vielmehr fein
gefaßt -wie ein Edelstein im kostbaren Schmuckstück.
Die Rose verlangt zart, königlich wie sie selbst
ist, zarte, reiche, wechselvollste Umgebung.
Daß dort, wo sie zur Verwendung kommt, schatten,
spendende Baumpflanzungen zurücktreten müssen, ist selbst-
verständlich.
Aus dem Zusammenweben dieser kurz hier skizzierten
Forderungen, der 7 Hauptfaktoren, folgert sich ein Organismus,
dem streng lokale Siegel aufgedrückt sind, der nur dort boden-
ständig ist, wo auf Grund der Überlieferung und Pietät, und
unter dem Zwange der rüstig fortschreitenden Siedlungs-
notwendigkeit diese Aufgabe den Künstlern gestellt wurde.
Und wo unter dem Regime dieser bestimmen-
den Faktoren die Kunst sich paarte mit der Not-
Wendigkeit, mit der Gesetzmäßigkeit, müssen
Werte entstehen ureigenster Note und boden-
ständigster Eigenart.
Der vorliegende Entwurf zerfällt, wie unschwer zu er-
kennen ist, in 2 Teile, dem nördlichen freien Teil der Festwiese
mit Wasseraniage, Hain, Restaurations-
gebäude und der Milchkuranstalt.
Weil Blumenfeste hier gefeiert,
Gelegenheiten zu Ausstellungen und
anderen Veranstaltungen geboten wer-
den sollen, ist eine abgeschlossene
Festwiese hier wohl ganz selbstver-
ständlich. Den Abschluß bietet im
Norden der prächtige Hain, daran an-
schließend die Milchkuranstalt, im Osten
eine rosenberankte Mauer, südlich das
Restaurationsgebäude mit dem Konzert-
platz und westlich das Wasser, außer-
dem bietet einen optischen Abschluß
die Baumreihe vor den vierstöckigen
Mietshäusern. Prächtiger scheint mir
ein Abschluß nicht gelungen.
Sanft, fast unmerklich, fällt die Fest-
wiese zum Wasser, wo rosenbespon-
nene Böschungen, von einer Rosenhecke
bekrönt, zum Wasser abwärts sich
neigen. Nur am Hainrand sind Pflan-
zungen von Wildrosen angebracht und
an der Ecke des Kiesplatzes, der den
zu erweiternden zeitweiligen Ausstel-
lungsbauten dient, hebt sich ein um
etwas erhöhtes Birkenrondell em-
por mit Trink brunnen in ihrem
Schatten. An der Westseite des Re-
staurationsplatzes steht fest auf einer
Sockelmauer am Wasser der Musik-
pavillon. Treppen führen zum Wasser,
um Gelegenheit zu geben, dicht an das Wasser heranzukommen
und am Wasser zu lustwandeln, zum Tempel mit der nördlichen
rosenumrankten Pergola, die zum Baumrundteil oberwärts
führt. An der westlichen Rosenmauer entlang ist ein breiter
Weg dem Zuschauerpublikum geschaffen, damit es dem
Blumenfestgetriebe unter sich unbehelligt Zusehen kann.
So der nördliche Parkteil mit weiten Räumen, Parkflächen
und der Waldschänke im Hintergrund, dem ruhig gedehnten
Wasser und - den sich darin spiegelnden Architekturen,
Böschungen und Bäumen.
Der südliche Teil trägt anderen Charakter. Wer
mit Rosen wirkungsvoll Kunst üben will, darf nicht
in Großzügigkeit verfallen. DieRose verlangt fein
in sich abgestimmte Raumverhältnisse. Abwechs-
lungsreich muß solch ein Gebilde sein, unerschöpflich an Reizen,
dabei sich nie wiederholend. So ist trotz der Kongruenz der
Doppelteile im großen jedwede Gleichgestaltung vermieden.
In der Achse des Restaurationsplatzes liegt ein schmales
Wasserbecken in Rosen gebettet, von Hecken begleitet und
findet seinen Abschluß in einem Rosenrondell, welches von
Kalksteinpfeilern rosenumsponnen, räumlich bestimmt ist.
Die einzelnen Rosengärten, in den Größenverhältnissen
bestimmt durch die jeweilig darin unterzubringende Rosen-
sektion, sind organisch in den Park untergebracht, ohne den-
selben zu zerpflücken. Rank- und Buschrosen stehen,
damit sie sich in ihrer ganzen Pracht entfalten, in freier park,
artiger Anordnung. Auch sind Rankrosen zum Bespannen von
Mauern, Pergolen, Schutzhäusern verwendet.
Es soll neben der wissenschaftlichen Einordnung gezeigt
werden, wie die
Rose zu verwenden ist:
Rose und Wasser — Rose und Mauer — Rose und Garten-
haus — Rose und Plastik -— Rose und Brunnen — Rose und
Laube — Rose und Bänke — Rose und Treppe — die Rose
als Laubengang •— die Rose als Hecke — die Rose als Rabatten-
pflanze — die Rose als Einzelpflanze — die Rose als Gruppen-
pflanze — die Rose als Hochstamm — die Rose als Halb-
stamm — die Rose einzelstehend — die Rose in Gruppen —
die Rose in freier landschaftlicher Umgebung.
DIE GARTENKUNST.
XV, 4
Rosenpark Berlin-Britz: I. Preis. Verf.: Harry Maaß, Lübeck. Blick auf das
große Wasserbecken vom Standpunkt B aus.
5. Die landhausmäßige Bebauung beansprucht lockere
Baumstellung, Pflanzen-Klein-Architektur, Hecken, berankte
Mauern, Gartenhäuschen usw. eine unbedingte Fühlung mit der
an sie stoßenden Parkseite.
6. Das Restaurationsgebäude fordert seine Lage dort, wo
es nicht von hohen Mietshäusern erdrückt wird. Es soll in
engster Fühlung, stehen mit einer ausgedehnten Parkfläche,
denn wo Feste abgehalten werden, muß das Restaurations-
gebäüde möglichst nahe liegen, und Plätze und Wiesen müssen
unmittelbar daranstoßen. Für Ausstellungen müssen die Räume
des Gebäudes Sorge tragen und die Möglichkeit, diese Aus-
stellungen auch nach außen hin zeitweilig zu erweitern, darf
nicht versagt werden.
Zur Abhaltung von Konzerten im Freien muß ein Platz
geschaffen sein mit unterhaltenden Ausblicken voll interessanter
Abwechselungen.
7. Die Einfügung eines Rosariums fordert reiches, gemüt-
volles „Sichvertiefen“ in die Arbeit. Abwechselungsreiche
Motive muß das Rosarium in sich tragen. Nicht streng isoliert
darf diese Anlage im ganzen Organismus ruhen, vielmehr fein
gefaßt -wie ein Edelstein im kostbaren Schmuckstück.
Die Rose verlangt zart, königlich wie sie selbst
ist, zarte, reiche, wechselvollste Umgebung.
Daß dort, wo sie zur Verwendung kommt, schatten,
spendende Baumpflanzungen zurücktreten müssen, ist selbst-
verständlich.
Aus dem Zusammenweben dieser kurz hier skizzierten
Forderungen, der 7 Hauptfaktoren, folgert sich ein Organismus,
dem streng lokale Siegel aufgedrückt sind, der nur dort boden-
ständig ist, wo auf Grund der Überlieferung und Pietät, und
unter dem Zwange der rüstig fortschreitenden Siedlungs-
notwendigkeit diese Aufgabe den Künstlern gestellt wurde.
Und wo unter dem Regime dieser bestimmen-
den Faktoren die Kunst sich paarte mit der Not-
Wendigkeit, mit der Gesetzmäßigkeit, müssen
Werte entstehen ureigenster Note und boden-
ständigster Eigenart.
Der vorliegende Entwurf zerfällt, wie unschwer zu er-
kennen ist, in 2 Teile, dem nördlichen freien Teil der Festwiese
mit Wasseraniage, Hain, Restaurations-
gebäude und der Milchkuranstalt.
Weil Blumenfeste hier gefeiert,
Gelegenheiten zu Ausstellungen und
anderen Veranstaltungen geboten wer-
den sollen, ist eine abgeschlossene
Festwiese hier wohl ganz selbstver-
ständlich. Den Abschluß bietet im
Norden der prächtige Hain, daran an-
schließend die Milchkuranstalt, im Osten
eine rosenberankte Mauer, südlich das
Restaurationsgebäude mit dem Konzert-
platz und westlich das Wasser, außer-
dem bietet einen optischen Abschluß
die Baumreihe vor den vierstöckigen
Mietshäusern. Prächtiger scheint mir
ein Abschluß nicht gelungen.
Sanft, fast unmerklich, fällt die Fest-
wiese zum Wasser, wo rosenbespon-
nene Böschungen, von einer Rosenhecke
bekrönt, zum Wasser abwärts sich
neigen. Nur am Hainrand sind Pflan-
zungen von Wildrosen angebracht und
an der Ecke des Kiesplatzes, der den
zu erweiternden zeitweiligen Ausstel-
lungsbauten dient, hebt sich ein um
etwas erhöhtes Birkenrondell em-
por mit Trink brunnen in ihrem
Schatten. An der Westseite des Re-
staurationsplatzes steht fest auf einer
Sockelmauer am Wasser der Musik-
pavillon. Treppen führen zum Wasser,
um Gelegenheit zu geben, dicht an das Wasser heranzukommen
und am Wasser zu lustwandeln, zum Tempel mit der nördlichen
rosenumrankten Pergola, die zum Baumrundteil oberwärts
führt. An der westlichen Rosenmauer entlang ist ein breiter
Weg dem Zuschauerpublikum geschaffen, damit es dem
Blumenfestgetriebe unter sich unbehelligt Zusehen kann.
So der nördliche Parkteil mit weiten Räumen, Parkflächen
und der Waldschänke im Hintergrund, dem ruhig gedehnten
Wasser und - den sich darin spiegelnden Architekturen,
Böschungen und Bäumen.
Der südliche Teil trägt anderen Charakter. Wer
mit Rosen wirkungsvoll Kunst üben will, darf nicht
in Großzügigkeit verfallen. DieRose verlangt fein
in sich abgestimmte Raumverhältnisse. Abwechs-
lungsreich muß solch ein Gebilde sein, unerschöpflich an Reizen,
dabei sich nie wiederholend. So ist trotz der Kongruenz der
Doppelteile im großen jedwede Gleichgestaltung vermieden.
In der Achse des Restaurationsplatzes liegt ein schmales
Wasserbecken in Rosen gebettet, von Hecken begleitet und
findet seinen Abschluß in einem Rosenrondell, welches von
Kalksteinpfeilern rosenumsponnen, räumlich bestimmt ist.
Die einzelnen Rosengärten, in den Größenverhältnissen
bestimmt durch die jeweilig darin unterzubringende Rosen-
sektion, sind organisch in den Park untergebracht, ohne den-
selben zu zerpflücken. Rank- und Buschrosen stehen,
damit sie sich in ihrer ganzen Pracht entfalten, in freier park,
artiger Anordnung. Auch sind Rankrosen zum Bespannen von
Mauern, Pergolen, Schutzhäusern verwendet.
Es soll neben der wissenschaftlichen Einordnung gezeigt
werden, wie die
Rose zu verwenden ist:
Rose und Wasser — Rose und Mauer — Rose und Garten-
haus — Rose und Plastik -— Rose und Brunnen — Rose und
Laube — Rose und Bänke — Rose und Treppe — die Rose
als Laubengang •— die Rose als Hecke — die Rose als Rabatten-
pflanze — die Rose als Einzelpflanze — die Rose als Gruppen-
pflanze — die Rose als Hochstamm — die Rose als Halb-
stamm — die Rose einzelstehend — die Rose in Gruppen —
die Rose in freier landschaftlicher Umgebung.