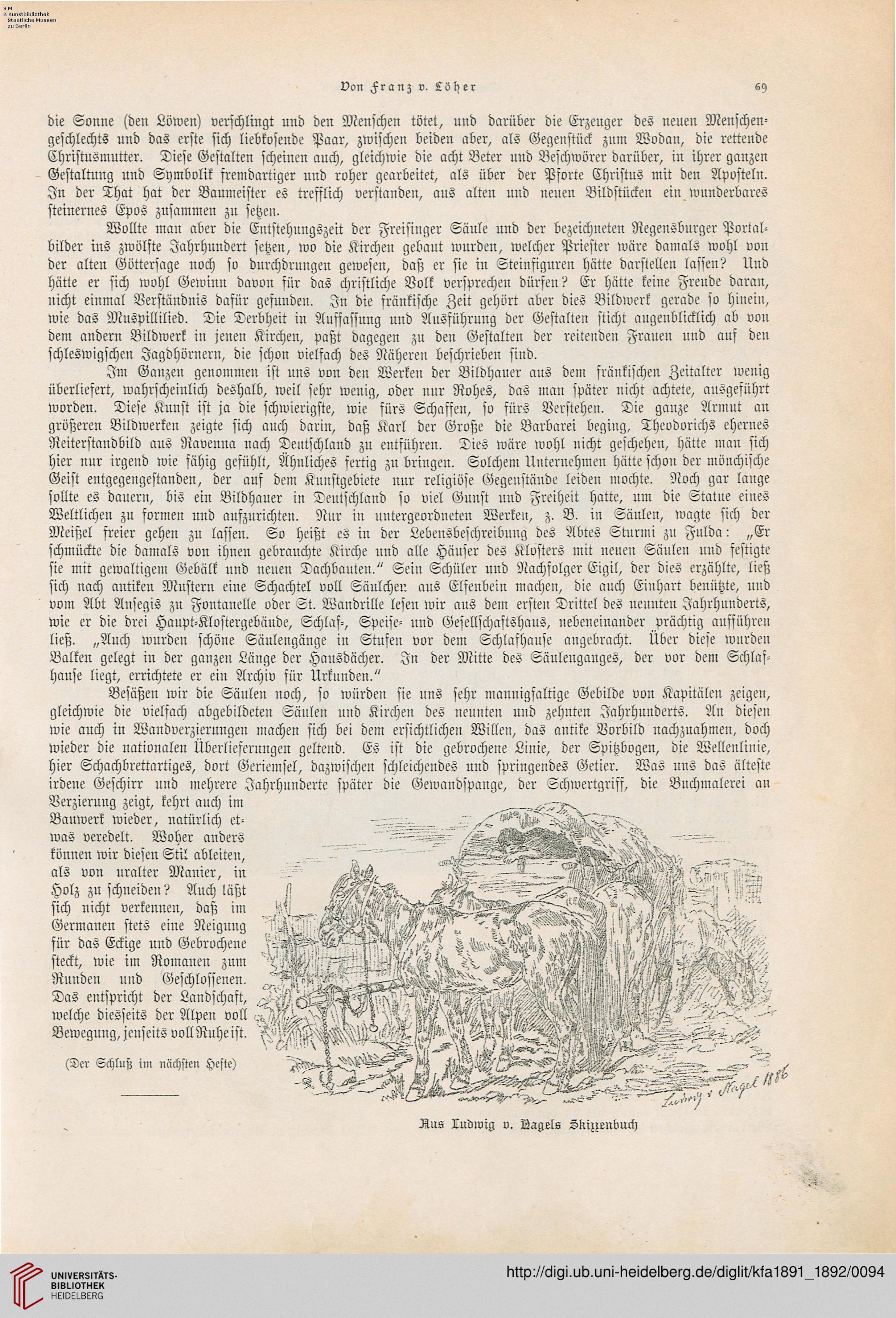von Franz v. Löher
ey
die Sonne (den Löwen) verschlingt und den Menschen tötet, und darüber die Erzeuger des neuen Menschen-
geschlechts und das erste sich liebkosende Paar, zwischen beiden aber, als Gegenstück zum Wodan, die rettende
Christus mutter. Diese Gestalten scheinen auch, gleichwie die acht Beter und Beschwörer darüber, in ihrer ganzen
Gestaltung und Symbolik fremdartiger und roher gearbeitet, als über der Pforte Christus mit den Aposteln.
In der That hat der Baumeister es trefflich verstanden, aus alten und neuen Bildstücken ein wunderbares
steinernes Epos zusammen zu setzen.
Wollte man aber die Entstehungszeit der Freisinger Säule und der bezeichnten Regensburger Portal-
bilder ins zwölfte Jahrhundert setzen, wo die Kirchen gebaut wurden, welcher Priester wäre damals wohl von
der alten Göttersage noch so durchdrungen gewesen, daß er sie in Steinsiguren hätte darstellen lassen? Und
hätte er sich wohl Gewinn davon für das christliche Volk versprechen dürfen? Er Hütte keine Freude daran,
nicht einmal Verständnis dafür gefunden. In die fränkische Zeit gehört aber dies Bildwerk gerade so hinein,
wie das Muspillilied. Die Derbheit in Auffassung und Ausführung der Gestalten sticht augenblicklich ab von
dem andern Bildwerk in jenen Kirchen, paßt dagegen zu den Gestalten der reitenden Frauen und auf den
schleswigschen Jagdhörnern, die schon vielfach des Näheren beschrieben sind.
Im Ganzen genommen ist uns von den Werken der Bildhauer aus dem fränkischen Zeitalter wenig
überliefert, wahrscheinlich deshalb, weil sehr wenig, oder nur Rohes, das man später nicht achtete, ausgeführt
worden. Diese Kunst ist ja die schwierigste, wie fürs Schaffen, so fürs Verstehen. Die ganze Armut an
größeren Bildwerken zeigte sich auch darin, daß Karl der Große die Barbarei beging, Theodorichs ehernes
Reiterstandbild aus Ravenna nach Deutschland zu entführen. Dies wäre wohl nicht geschehen, hätte man sich
hier nur irgend wie fähig gefühlt, Ähnliches fertig zu bringen. Solchem Unternehmen Hütte schon der mönchische
Geist entgegengestanden, der auf dem Kunstgebiete nur religiöse Gegenstände leiden mochte. Noch gar lange
sollte es dauern, bis ein Bildhauer in Deutschland so viel Gunst und Freiheit hatte, um die Statue eines
Weltlichen zu formen und aufznrichten. Nur in untergeordneten Werken, z. B. in Säulen, wagte sich der
Meißel freier gehen zu lassen. So heißt es in der Lebensbeschreibung des Abtes Sturmi zu Fulda: „Er
schmückte die damals von ihnen gebrauchte Kirche und alle Häuser des Klosters mit neuen Säulen und festigte
sie mit gewaltigem Gebälk und neuen Dachbanten." Sein Schüler und Nachfolger Eigil, der dies erzählte, ließ
sich nach antiken Mustern eine Schachtel voll Säulchen aus Elfenbein machen, die auch Einhart benützte, und
vom Abt Ansegis zu Fontanelle oder St. Wandrille lesen wir aus dem ersten Drittel des nennten Jahrhunderts,
wie er die drei Haupt-Klostergebäude, Schlaf-, Speise- und Gesellschastshaus, nebeneinander prächtig anfführen
ließ. „Auch wurden schöne Säulengänge in Stufen vor dem Schlafhause angebracht. Über diese wurden
Balken gelegt in der ganzen Länge der Hausdächer. In der Mitte des Säulenganges, der vor dem Schlaf-
hause liegt, errichtete er ein Archiv für Urkunden."
Besäßen wir die Säulen noch, so würden sie uns sehr mannigfaltige Gebilde von Kapitälen zeigen,
gleichwie die vielfach abgebildeten Säulen und Kirchen des neunten und zehnten Jahrhunderts. An diesen
wie auch in Wandverziernngen machen sich bei dem ersichtlichen Willen, das antike Vorbild nachzuahmen, doch
wieder die nationalen Überlieferungen geltend. Es ist die gebrochene Linie, der Spitzbogen, die Wellenlinie,
hier Schachbrettartiges, dort Geriemsel, dazwischen schleichendes und springendes Getier. Was uns das älteste
irdene Geschirr und mehrere Jahrhunderte später die Gewandspange, der Schwertgriff, die Buchmalerei an
Verzierung zeigt, kehrt auch im
Bauwerk wieder, natürlich et-
was veredelt. Woher anders
können wir diesen Stil ableiten,
als von uralter Manier, in
Holz zu schneiden? Auch läßt
sich nicht verkennen, daß im
Germanen stets eine Neigung
für das Eckige und Gebrochene
steckt, wie im Romanen zum
Runden und Geschloffenen.
Das entspricht der Landschaft,
welche diesseits der Alpen voll
Bewegung, jenseits voll Ruhe ist.
(Der Schluß im nächsten Hefte)
Aus Ludwig u. Nagels skiMnbuch
ey
die Sonne (den Löwen) verschlingt und den Menschen tötet, und darüber die Erzeuger des neuen Menschen-
geschlechts und das erste sich liebkosende Paar, zwischen beiden aber, als Gegenstück zum Wodan, die rettende
Christus mutter. Diese Gestalten scheinen auch, gleichwie die acht Beter und Beschwörer darüber, in ihrer ganzen
Gestaltung und Symbolik fremdartiger und roher gearbeitet, als über der Pforte Christus mit den Aposteln.
In der That hat der Baumeister es trefflich verstanden, aus alten und neuen Bildstücken ein wunderbares
steinernes Epos zusammen zu setzen.
Wollte man aber die Entstehungszeit der Freisinger Säule und der bezeichnten Regensburger Portal-
bilder ins zwölfte Jahrhundert setzen, wo die Kirchen gebaut wurden, welcher Priester wäre damals wohl von
der alten Göttersage noch so durchdrungen gewesen, daß er sie in Steinsiguren hätte darstellen lassen? Und
hätte er sich wohl Gewinn davon für das christliche Volk versprechen dürfen? Er Hütte keine Freude daran,
nicht einmal Verständnis dafür gefunden. In die fränkische Zeit gehört aber dies Bildwerk gerade so hinein,
wie das Muspillilied. Die Derbheit in Auffassung und Ausführung der Gestalten sticht augenblicklich ab von
dem andern Bildwerk in jenen Kirchen, paßt dagegen zu den Gestalten der reitenden Frauen und auf den
schleswigschen Jagdhörnern, die schon vielfach des Näheren beschrieben sind.
Im Ganzen genommen ist uns von den Werken der Bildhauer aus dem fränkischen Zeitalter wenig
überliefert, wahrscheinlich deshalb, weil sehr wenig, oder nur Rohes, das man später nicht achtete, ausgeführt
worden. Diese Kunst ist ja die schwierigste, wie fürs Schaffen, so fürs Verstehen. Die ganze Armut an
größeren Bildwerken zeigte sich auch darin, daß Karl der Große die Barbarei beging, Theodorichs ehernes
Reiterstandbild aus Ravenna nach Deutschland zu entführen. Dies wäre wohl nicht geschehen, hätte man sich
hier nur irgend wie fähig gefühlt, Ähnliches fertig zu bringen. Solchem Unternehmen Hütte schon der mönchische
Geist entgegengestanden, der auf dem Kunstgebiete nur religiöse Gegenstände leiden mochte. Noch gar lange
sollte es dauern, bis ein Bildhauer in Deutschland so viel Gunst und Freiheit hatte, um die Statue eines
Weltlichen zu formen und aufznrichten. Nur in untergeordneten Werken, z. B. in Säulen, wagte sich der
Meißel freier gehen zu lassen. So heißt es in der Lebensbeschreibung des Abtes Sturmi zu Fulda: „Er
schmückte die damals von ihnen gebrauchte Kirche und alle Häuser des Klosters mit neuen Säulen und festigte
sie mit gewaltigem Gebälk und neuen Dachbanten." Sein Schüler und Nachfolger Eigil, der dies erzählte, ließ
sich nach antiken Mustern eine Schachtel voll Säulchen aus Elfenbein machen, die auch Einhart benützte, und
vom Abt Ansegis zu Fontanelle oder St. Wandrille lesen wir aus dem ersten Drittel des nennten Jahrhunderts,
wie er die drei Haupt-Klostergebäude, Schlaf-, Speise- und Gesellschastshaus, nebeneinander prächtig anfführen
ließ. „Auch wurden schöne Säulengänge in Stufen vor dem Schlafhause angebracht. Über diese wurden
Balken gelegt in der ganzen Länge der Hausdächer. In der Mitte des Säulenganges, der vor dem Schlaf-
hause liegt, errichtete er ein Archiv für Urkunden."
Besäßen wir die Säulen noch, so würden sie uns sehr mannigfaltige Gebilde von Kapitälen zeigen,
gleichwie die vielfach abgebildeten Säulen und Kirchen des neunten und zehnten Jahrhunderts. An diesen
wie auch in Wandverziernngen machen sich bei dem ersichtlichen Willen, das antike Vorbild nachzuahmen, doch
wieder die nationalen Überlieferungen geltend. Es ist die gebrochene Linie, der Spitzbogen, die Wellenlinie,
hier Schachbrettartiges, dort Geriemsel, dazwischen schleichendes und springendes Getier. Was uns das älteste
irdene Geschirr und mehrere Jahrhunderte später die Gewandspange, der Schwertgriff, die Buchmalerei an
Verzierung zeigt, kehrt auch im
Bauwerk wieder, natürlich et-
was veredelt. Woher anders
können wir diesen Stil ableiten,
als von uralter Manier, in
Holz zu schneiden? Auch läßt
sich nicht verkennen, daß im
Germanen stets eine Neigung
für das Eckige und Gebrochene
steckt, wie im Romanen zum
Runden und Geschloffenen.
Das entspricht der Landschaft,
welche diesseits der Alpen voll
Bewegung, jenseits voll Ruhe ist.
(Der Schluß im nächsten Hefte)
Aus Ludwig u. Nagels skiMnbuch