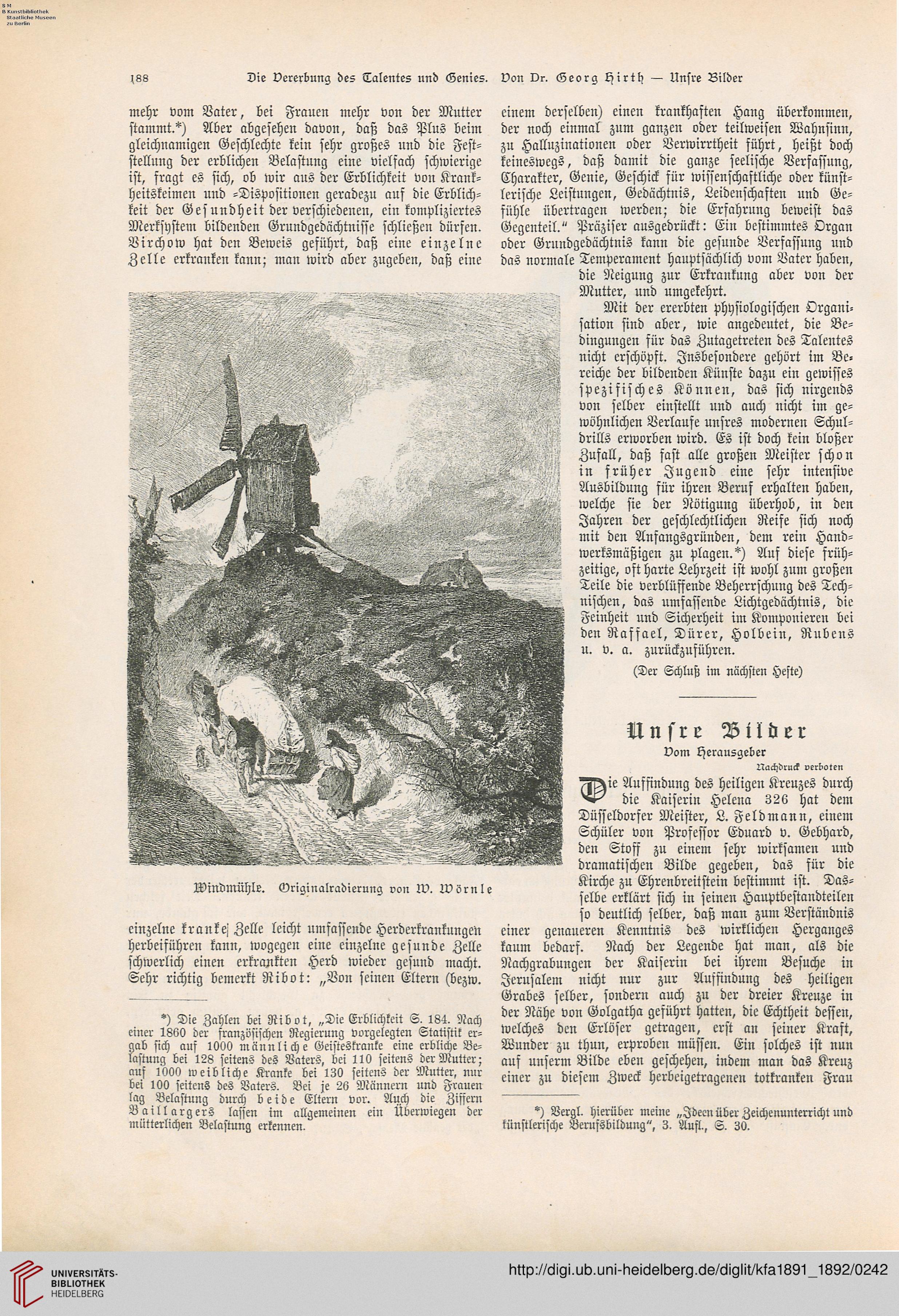188
Die Vererbung des Talentes und Genies, von vr. Georg Hirth — Unsre Bilder
mehr vom Vater, bei Frauen mehr von der Mutter
stammt.*) Aber abgesehen davon, daß das Plus beim
gleichnamigen Geschlechte kein sehr großes und die Fest-
stellung der erblichen Belastung eine vielfach schwierige
ist, fragt es sich, ob wir aus der Erblichkeit von Krank-
heitskeimen und -Dispositionen geradezu auf die Erblich-
keit der Gesundheit der verschiedenen, ein kompliziertes
Merksystem bildenden Grnndgedächtnisse schließen dürfen.
Virchow hat den Beweis geführt, daß eine einzelne
Zelle erkranken kann; man wird aber zugeben, daß eine
Windmühle. Vrigiualradierung von !v. Ivörnle
einzelne kranke; Zelle leicht umfassende Herderkrankungen
herbeiführen kann, wogegen eine einzelne gesunde Zelle
schwerlich einen erkrankten Herd wieder gesund macht.
Sehr richtig bemerkt Ribot: „Von seinen Eltern (bezw.
*) Die Zahlen bei Ribot, „Die Erblichkeit S. 184. Nach
einer 1860 der französischen Regierung vorgelegten Statistik er-
gab sich auf 1000 männliche Geisteskranke eine erbliche Be-
lastung bei 128 seitens des Vaters, bei 110 seitens der Mutter;
auf 1000 weibliche Kranke bei 130 seitens der Mutter, nur
bei 100 seitens des Vaters. Bei je 26 Männern und Frauen
lag Belastung durch beide Eltern vor. Auch die Ziffern
Baillargers lassen im allgemeinen ein Überwiegen der
mütterlichen Belastung erkennen.
einem derselben) einen krankhaften Hang überkommen,
der noch einmal znm ganzen oder teilweisen Wahnsinn,
zu Halluzinationen oder Verwirrtheit führt, heißt doch
keineswegs, daß damit die ganze seelische Verfassung,
Charakter, Genie, Geschick für wissenschaftliche oder künst-
lerische Leistungen, Gedächtnis, Leidenschaften und Ge-
fühle übertragen werden; die Erfahrung beweist das
Gegenteil." Präziser ausgedrückt: Ein bestimmtes Organ
oder Grundgedächtnis kann die gesunde Verfassung und
das normale Temperament hauptsächlich vom Vater haben,
die Neigung zur Erkrankung aber von der
Mutter, und umgekehrt.
Mit der ererbten physiologischen Organi-
sation sind aber, wie angedentet, die Be-
dingungen für das Zutagetreten des Talentes
nicht erschöpft. Insbesondere gehört im Be-
reiche der bildenden Künste dazu ein gewisses
spezifisches Können, das sich nirgends
von selber einstellt und auch nicht im ge-
wöhnlichen Verlaufe unsres modernen Schul-
drills erworben wird. Es ist doch kein bloßer
Zufall, daß fast alle großen Meister schon
in früher Jugend eine sehr intensive
Ausbildung für ihren Beruf erhalten haben,
welche sie der Nötigung überhob, in den
Jahren der geschlechtlichen Reife sich noch
mit den Anfangsgründen, dem rein Hand-
werksmäßigen zu plagen.*) Auf diese früh-
zeitige, oft harte Lehrzeit ist Wohl zum großen
Teile die verblüffende Beherrschung des Tech-
nischen, das umfassende Lichtgedächtnis, die
Feinheit und Sicherheit im Komponieren bei
den Raffael, Dürer, Holbein, Rubens
u. v. a. zurückzuführen.
(Der Schluß im nächsten Hefte)
Unsre Bilder
vom Herausgeber
Nachdruck verboten
ie Auffindung des heiligen Kreuzes durch
die Kaiserin Helena 326 hat dem
Düsseldorfer Meister, L. Feldmann, einem
Schüler von Professor Eduard v. Gebhard,
den Stoff zu einem sehr wirksamen und
dramatischen Bilde gegeben, das für die
Kirche zu Ehrenbreit stein bestimmt ist. Das-
selbe erklärt sich in seinen Hauptbestandteilen
so deutlich selber, daß man zum Verständnis
einer genaueren Kenntnis des wirklichen Herganges
kaum bedarf. Nach der Legende hat man, als die
Nachgrabungen der Kaiserin bei ihrem Besuche in
Jerusalem nicht nur zur Auffindung des heiligen
Grabes selber, sondern auch zu der dreier Kreuze in
der Nähe von Golgatha geführt hatten, die Echtheit dessen,
welches den Erlöser getragen, erst an seiner Kraft,
Wunder zu thun, erproben müssen. Ein solches ist nun
auf unserm Bilde eben geschehen, indem man das Kreuz
einer zu diesem Zweck herbeigetragenen totkranken Frau
*) Vergl. hierüber meine „Ideen über Zeichenunterricht und
künstlerische Berufsbildung", 3. Aufl., S. 30.
Die Vererbung des Talentes und Genies, von vr. Georg Hirth — Unsre Bilder
mehr vom Vater, bei Frauen mehr von der Mutter
stammt.*) Aber abgesehen davon, daß das Plus beim
gleichnamigen Geschlechte kein sehr großes und die Fest-
stellung der erblichen Belastung eine vielfach schwierige
ist, fragt es sich, ob wir aus der Erblichkeit von Krank-
heitskeimen und -Dispositionen geradezu auf die Erblich-
keit der Gesundheit der verschiedenen, ein kompliziertes
Merksystem bildenden Grnndgedächtnisse schließen dürfen.
Virchow hat den Beweis geführt, daß eine einzelne
Zelle erkranken kann; man wird aber zugeben, daß eine
Windmühle. Vrigiualradierung von !v. Ivörnle
einzelne kranke; Zelle leicht umfassende Herderkrankungen
herbeiführen kann, wogegen eine einzelne gesunde Zelle
schwerlich einen erkrankten Herd wieder gesund macht.
Sehr richtig bemerkt Ribot: „Von seinen Eltern (bezw.
*) Die Zahlen bei Ribot, „Die Erblichkeit S. 184. Nach
einer 1860 der französischen Regierung vorgelegten Statistik er-
gab sich auf 1000 männliche Geisteskranke eine erbliche Be-
lastung bei 128 seitens des Vaters, bei 110 seitens der Mutter;
auf 1000 weibliche Kranke bei 130 seitens der Mutter, nur
bei 100 seitens des Vaters. Bei je 26 Männern und Frauen
lag Belastung durch beide Eltern vor. Auch die Ziffern
Baillargers lassen im allgemeinen ein Überwiegen der
mütterlichen Belastung erkennen.
einem derselben) einen krankhaften Hang überkommen,
der noch einmal znm ganzen oder teilweisen Wahnsinn,
zu Halluzinationen oder Verwirrtheit führt, heißt doch
keineswegs, daß damit die ganze seelische Verfassung,
Charakter, Genie, Geschick für wissenschaftliche oder künst-
lerische Leistungen, Gedächtnis, Leidenschaften und Ge-
fühle übertragen werden; die Erfahrung beweist das
Gegenteil." Präziser ausgedrückt: Ein bestimmtes Organ
oder Grundgedächtnis kann die gesunde Verfassung und
das normale Temperament hauptsächlich vom Vater haben,
die Neigung zur Erkrankung aber von der
Mutter, und umgekehrt.
Mit der ererbten physiologischen Organi-
sation sind aber, wie angedentet, die Be-
dingungen für das Zutagetreten des Talentes
nicht erschöpft. Insbesondere gehört im Be-
reiche der bildenden Künste dazu ein gewisses
spezifisches Können, das sich nirgends
von selber einstellt und auch nicht im ge-
wöhnlichen Verlaufe unsres modernen Schul-
drills erworben wird. Es ist doch kein bloßer
Zufall, daß fast alle großen Meister schon
in früher Jugend eine sehr intensive
Ausbildung für ihren Beruf erhalten haben,
welche sie der Nötigung überhob, in den
Jahren der geschlechtlichen Reife sich noch
mit den Anfangsgründen, dem rein Hand-
werksmäßigen zu plagen.*) Auf diese früh-
zeitige, oft harte Lehrzeit ist Wohl zum großen
Teile die verblüffende Beherrschung des Tech-
nischen, das umfassende Lichtgedächtnis, die
Feinheit und Sicherheit im Komponieren bei
den Raffael, Dürer, Holbein, Rubens
u. v. a. zurückzuführen.
(Der Schluß im nächsten Hefte)
Unsre Bilder
vom Herausgeber
Nachdruck verboten
ie Auffindung des heiligen Kreuzes durch
die Kaiserin Helena 326 hat dem
Düsseldorfer Meister, L. Feldmann, einem
Schüler von Professor Eduard v. Gebhard,
den Stoff zu einem sehr wirksamen und
dramatischen Bilde gegeben, das für die
Kirche zu Ehrenbreit stein bestimmt ist. Das-
selbe erklärt sich in seinen Hauptbestandteilen
so deutlich selber, daß man zum Verständnis
einer genaueren Kenntnis des wirklichen Herganges
kaum bedarf. Nach der Legende hat man, als die
Nachgrabungen der Kaiserin bei ihrem Besuche in
Jerusalem nicht nur zur Auffindung des heiligen
Grabes selber, sondern auch zu der dreier Kreuze in
der Nähe von Golgatha geführt hatten, die Echtheit dessen,
welches den Erlöser getragen, erst an seiner Kraft,
Wunder zu thun, erproben müssen. Ein solches ist nun
auf unserm Bilde eben geschehen, indem man das Kreuz
einer zu diesem Zweck herbeigetragenen totkranken Frau
*) Vergl. hierüber meine „Ideen über Zeichenunterricht und
künstlerische Berufsbildung", 3. Aufl., S. 30.