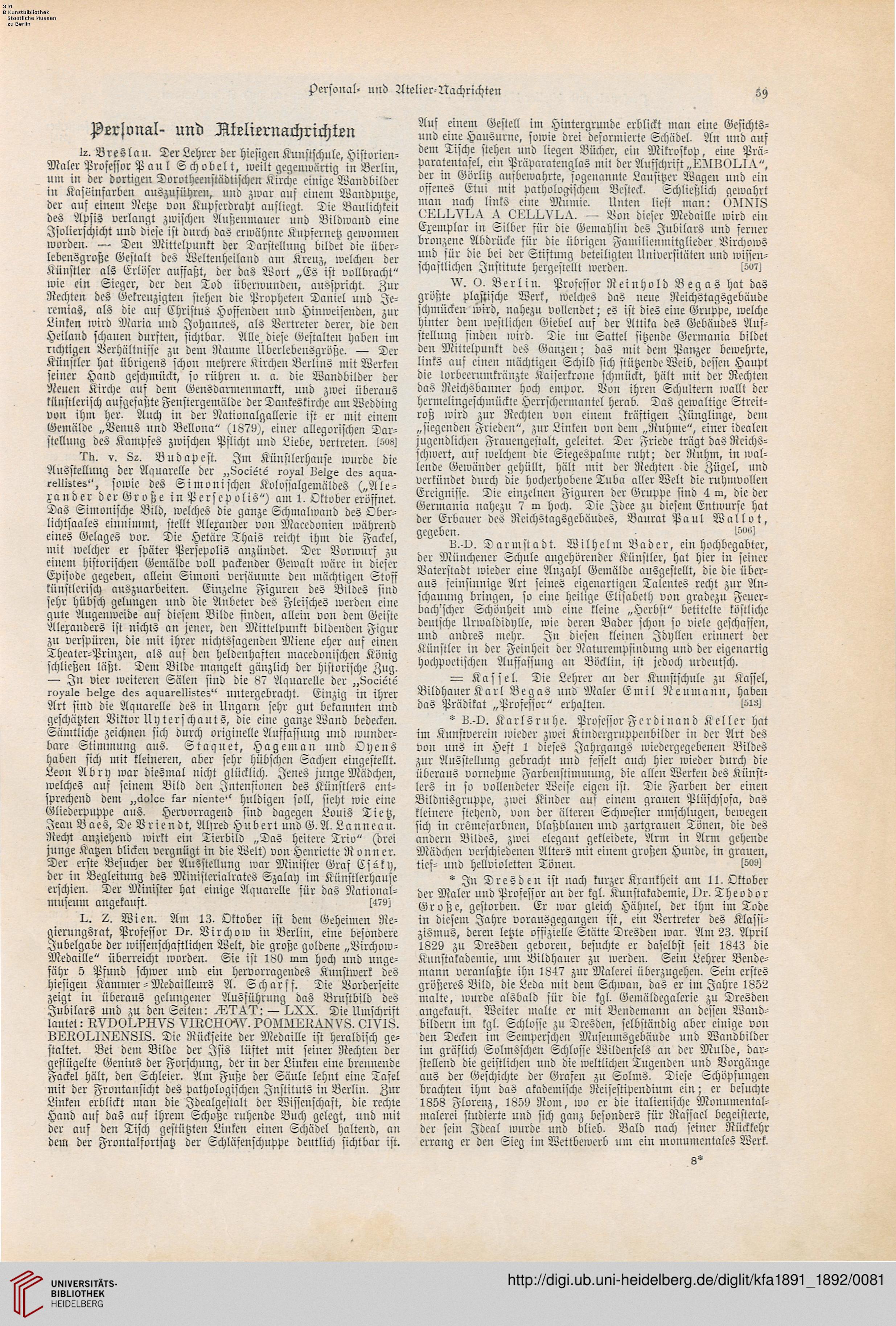Personal- und Atelier-Nachrichten
Personal- und Ateliernschrichten
Breslau. TerLehrer der hiesigen Kunstschule, Historieu-
Maler Professor P au l S ch obel t, weilt gegenwärtig in Berlin,
um in der dortigen Dorotheenstädtischcn Kirche einige Wandbilder
in Kasdinfärben auszusühren, und zwar auf einem Wandputze,
der auf einem Netze von Kupferdraht aufliegt. Die Baulichkeit
des Apsis verlangt zwischen Außenmauer und Bildwand eine
Isolierschicht und diese ist durch das erwähnie Kupfernetz gewonnen
worden. — Den Mittelpunkt der Darstellung bildet die über-
lebensgroße Gestalt des Weltenheiland am Kreuz, welchen der
Künstler als Erlöser auffaßt, der das Wort „Es ist vollbracht"
wie ein Sieger, der den Tod überwunden, ausspricht. Zur
Rechten des Gekreuzigten stehen die Propheten Daniel und Je-
remias, als die auf Christus Hoffenden und Hinweisenden, zur
Linken wird Maria und Johannes, als Vertreter derer, die den
Heiland schauen durften, sichtbar. Alle, diese Gestalten haben im
richtigen Verhältnisse zu dem Raume Überlebensgroße. — Der
Künstler hat übrigens schon mehrere Kirchen Berlins mit Werken
seiner Hand geschmückt, so rühren u. a. die Wandbilder der
Neuen Kirche auf dem Gensdarmenmarkt, und zwei überaus
künstlerisch aufgesaßte Fenstergemälde der Dankeskirche am Wedding
von ihm her. Auch in der Nationalgallerie ist er mit einem
Gemälde „Venus und Bellona" (1879), einer allegorischen Dar-
stellung des Kampfes zwischen Pflicht und Liebe, vertreten, lsvss
DK. v. 8r. Budapest. Im Künslterhause wurde die
Ausstellung der Aquarelle der „Lociete i-o^-al LelZe äes aqua-
rellistes", sowie des Simonischen Kvlossalgcmäldes („Ale-
xander der Große in Persepolis") am 1. Oktober eröffnet.
Das Simonische Bild, welches die ganze Schmalwand des Ober-
lichtsaales einnimmt, stellt Alexander von Macedonien mährend
eines Gelages vor. Die Hetäre Thais reicht ihm die Fackel,
mit welcher er später Persepolis anzündet. Der Vorwurf zu
einem historischen Gemälde voll packender Gewalt märe in dieser
Episode gegeben, allein Simoni versäumte den mächtigen Stoff
künstlerisch auszuarbeiten. Einzelne Figuren des Bildes sind
sehr hübsch gelungen und die Anbeter des Fleisches werden eine
gute Augenweide auf diesem Bilde finden, allein von dem Geiste
Alexanders ist nichts an jener, den Mittelpunkt bildenden Figur
zu verspüren, die mit ihrer nichtssagenden Miene eher auf einen
Theater-Prinzen, als auf den heldenhaften macedonischen König
schließen läßt. Dem Bilde mangelt gänzlich der historische Zug.
— In vier weiteren Sälen find die 87 Aquarelle der „Lociete
ro)'ale beige ckes aquarellistes" untergebracht. Einzig in ihrer
Art sind die Aquarelle des in Ungarn sehr gut bekannten und
geschätzten Viktor llyterschauts, die eine ganze Wand bedecken.
Sämtliche zeichnen sich durch originelle Auffassung und wunder-
bare Stimmung aus. Staquet, Hageman und Oyens
haben sich mit kleineren, aber sehr hübschen Sachen eingestellt.
Leon Abry war diesmal nicht glücklich. Jenes junge Mädchen,
welches auf seinem Bild den Jntensionen des Künstlers ent-
sprechend dem „ckolce 5ar uieute'' huldigen soll, sieht wie eine
Gliederpuppe aus. Hervorragend sind dagegen Louis Tietz,
Jean Baes, De Vriendt, Al>red Hubert und GA. Lanneau.
Recht anziehend wirkt ein Tierbild „Das heitere Trio" (drei
junge Katzen blicken vergnügt in die Welt) von Henriette Ronn er.
Der erste Besucher der Ausstellung war Minister Graf CsLkh,
der in Begleitung des Ministerialrates Szalay im Künstlerhause
erschien. Der Minister hat einige Aquarelle für das National-
museum angekauft. l«B
D. L Wien. Am 13. Oktober ist dem Geheimen Re-
gierungsrat, Professor l)r. Birchow in Berlin, eine besondere
Jubelgabe der wissenschaftlichen Welt, die große goldene „Virchow-
Medaille" überreicht worden. Sie ist 180 mm hoch und unge-
fähr 5 Pfund schwer und ein hervorragendes Kunstwerk des
hiesigen Kammer-Medailleurs A. Scharff. Die Vorderseite
zeigt in überaus gelungener Ausführung das Brustbild des
Jubilars und zu den Seiten: L2TXT: — I-XX. Die Umschrift
lautet: RVV0O?LV8 VILOLO^V. I>0LQI8IiXXV8. OIVI8.
L8R0I-IX8X8I8. Die Rückseite der Medaille ist heraldisch ge-
staltet. Bei dem Bilde der Isis lüftet mit seiner Rechten der
geflügelte Genius der Forschung, der in der Linken eine brennende
Fackel hält, den Schleier. Am Fuße der Säule lehnt eine Tasel
mit der Frontansicht des pathologischen Instituts in Berlin. Zur
Linken erblickt man die Jdealgestalt der Wissenschaft, die rechte
Hand auf das auf ihrem Schoße ruhende Buch gelegt, und mit
der auf den Tisch gestützten Linken einen Schädel haltend, an
dem der Frontalfortsatz der Schläfenschuppe deutlich sichtbar ist.
Aus einem Gestell im Hintergründe erblickt man eine Gesichts-
und eine Hausurne, sowie drei deformierte Schädel. An und auf
dem Tische stehen und liegen Bücher, ein Mikroskop, eine Prä-
Paratentafel, ein Präparatenglas mit der Ausschrift „ONBOI-IX",
der in Görlitz aufbewahrte, sogenannte Lausitzer Wagen und ein
offenes Etui mit Pathologischem Besteck. Schließlich gewahrt
man nach links eine Mumie. Nuten liest man: ÖÄIXI8
68HVI-X X 08I-I-VI-X. — Bon dieser Medaille wird ein
Exemplar in Silber für die Gemahlin des Jubilars und ferner
bronzene Abdrücke für die übrigen Familienmitglieder Virchows
und für die bei der Stiftung beteiligten Universitäten und wissen-
schaftlichen Institute hergestellt werden. I»»?!
^V. O. Berlin. Professor Reinhold B eg as hat das
größte plastische Werk, welches das neue Reichstagsgebüude
schmücken wird, nahezu vollendet; es ist dies eine Gruppe, welche
hinter dein westlichen Giebel auf der Attika des Gebäudes Auf-
stellung sinken wird. Tie im Sattel sitzende Germania bildet
den Mittelpunkt des Ganzen; das mit dem Panzer bewehrte,
links auf einen mächtigen Schild sich stützende Weib, dessen Haupt
die lorbeerumkränzte Kaiserkrone schmückt, hält mit der Rechten
das Reichsbanner hoch empor. Von ihren Schultern wallt der
hermelingcschmückle Hcrrschcrmantel herab. Das gewaltige Streit-
roß ivird zur Rechten von einem kräftigen Jünglinge, dem
„siegenden Frieden", zur Linken von dem „Ruhme", einer idealen
jugendlichen Frauengestalt, geleitet. Der Friede trägt das Reichs-
schwert, auf welchem die Siegespalme ruht; der Ruhm, in wal-
lende Gewänder gehüllt, hält mit der Rechten die Zügel, und
verkündet durch die hocherhobene Tuba aller Welt die ruhmvollen
Ereignisse. Die einzelnen Figuren der Gruppe sind 4 m, die der
Germania nahezu 7 m hoch. Die Idee zu diesem Entwürfe hat
der Erbauer des Reichstagsgebäudes, Baurat Paul Wallot,
gegeben. lsvch
L.-v. Darmstadt. Wilhelm Bader, ein hochbegabter,
der Münchener Schule angehörender Künstler, hat hier in seiner
Vaterstadt wieder eine Anzahl Gemälde ausgestellt, die die über-
aus feinsinnige Art seines eigenartigen Talentes recht zur An-
schauung bringen, so eine heilige Elisabeth von gradezu Feuer-
bach'scher Schönheit und eine kleine „Herbst" betitelte köstliche
deutsche llrwaldidylle, wie deren Bader schon so viele geschaffen,
und andres mehr. In diesen kleinen Idyllen erinnert der
Künstler in der Feinheit der Naturempfindung und der eigenartig
hochpolitischen Auffassung an Böcklin, ist jedoch urdeutsch.
— Kassel. Die Lehrer an der Kunstschule zu Kassel,
Bildhauer Karl Begas und Maler Emil Neumann, haben
das Prädikat „Professor" erhalten. l»rch
* L.-v. Karlsruhe. Professor Ferdinand Keller hat
im Kunstvercin wieder zwei Kindergruppenbilder in der Art des
von uns in Heft 1 dieses Jahrgangs wiedergegebenen Bildes
zur Ausstellung gebracht und fesselt auch hier wieder durch die
überaus vornehme Farbenstimmung, die allen Werken des Künst-
lers in so vollendeter Weise eigen ist. Die Farben der einen
Bildnisgruppe, zwei Kinder auf einem grauen Plüjchsofa, das
kleinere stehend, von der älteren Schwester umschlugen, bewegen
sich in cremefarbnen, blaßblauen und zartgrauen Tönen, die des
andern Bildes, zwei elegant gekleidete, Arm in Arm gehende
Mädchen verschiedenen Alters mit einem großen Hunde, in grauen,
tief- und hellvioletten Tönen. lboch
* In Dresden ist nach kurzer Krankheit am 11. Oktober
der Maler und Professor an der kgl. Kunstakademie, Or. Theodor
Große, gestorben. Er war gleich Hähnel, der ihm im Tode
in diesem Jahre vorausgegangen ist, ein Vertreter des Klassi-
zismus, deren letzte offizielle Stätte Dresden war. Am 23. April
1829 zu Dresden geboren, besuchte er daselbst seit 1843 die
Kunstakademie, um Bildhauer zu werden. Sein Lehrer Bende-
mann veranlaßte ihn 1847 zur Malerei überzugehen. Sein erstes
größeres Bild, die Leda mit dem Schwan, das er im Jahre 1852
malte, wurde alsbald für die kgl. Gemäldegalerie zu Dresden
angekaust. Weiter malte er mit Bendemann an dessen Wand-
bildern im kgl. Schlosse zu Dresden, selbständig aber einige von
den Decken im Semperschen Museumsgebäude und Wandbilder
im gräflich Solmsschen Schlosse Wildenfels an der Mulde, dar-
stellend die geistlichen und die weltlichen Tugenden und Vorgänge
aus der Geschichte der Grafen zu Solms. Diese Schöpfungen
brachten ihm das akademische Reisestipendium ein; er besuchte
1858 Florenz, 1859 Rom, wo er die italienische Monumental-
malerci studierte und sich ganz besonders für Raffael begeisterte,
der sein Ideal wurde und blieb. Bald nach seiner Rückkehr
errang er den Sieg im Wettbewerb um ein monumentales Werk.
8«
Personal- und Ateliernschrichten
Breslau. TerLehrer der hiesigen Kunstschule, Historieu-
Maler Professor P au l S ch obel t, weilt gegenwärtig in Berlin,
um in der dortigen Dorotheenstädtischcn Kirche einige Wandbilder
in Kasdinfärben auszusühren, und zwar auf einem Wandputze,
der auf einem Netze von Kupferdraht aufliegt. Die Baulichkeit
des Apsis verlangt zwischen Außenmauer und Bildwand eine
Isolierschicht und diese ist durch das erwähnie Kupfernetz gewonnen
worden. — Den Mittelpunkt der Darstellung bildet die über-
lebensgroße Gestalt des Weltenheiland am Kreuz, welchen der
Künstler als Erlöser auffaßt, der das Wort „Es ist vollbracht"
wie ein Sieger, der den Tod überwunden, ausspricht. Zur
Rechten des Gekreuzigten stehen die Propheten Daniel und Je-
remias, als die auf Christus Hoffenden und Hinweisenden, zur
Linken wird Maria und Johannes, als Vertreter derer, die den
Heiland schauen durften, sichtbar. Alle, diese Gestalten haben im
richtigen Verhältnisse zu dem Raume Überlebensgroße. — Der
Künstler hat übrigens schon mehrere Kirchen Berlins mit Werken
seiner Hand geschmückt, so rühren u. a. die Wandbilder der
Neuen Kirche auf dem Gensdarmenmarkt, und zwei überaus
künstlerisch aufgesaßte Fenstergemälde der Dankeskirche am Wedding
von ihm her. Auch in der Nationalgallerie ist er mit einem
Gemälde „Venus und Bellona" (1879), einer allegorischen Dar-
stellung des Kampfes zwischen Pflicht und Liebe, vertreten, lsvss
DK. v. 8r. Budapest. Im Künslterhause wurde die
Ausstellung der Aquarelle der „Lociete i-o^-al LelZe äes aqua-
rellistes", sowie des Simonischen Kvlossalgcmäldes („Ale-
xander der Große in Persepolis") am 1. Oktober eröffnet.
Das Simonische Bild, welches die ganze Schmalwand des Ober-
lichtsaales einnimmt, stellt Alexander von Macedonien mährend
eines Gelages vor. Die Hetäre Thais reicht ihm die Fackel,
mit welcher er später Persepolis anzündet. Der Vorwurf zu
einem historischen Gemälde voll packender Gewalt märe in dieser
Episode gegeben, allein Simoni versäumte den mächtigen Stoff
künstlerisch auszuarbeiten. Einzelne Figuren des Bildes sind
sehr hübsch gelungen und die Anbeter des Fleisches werden eine
gute Augenweide auf diesem Bilde finden, allein von dem Geiste
Alexanders ist nichts an jener, den Mittelpunkt bildenden Figur
zu verspüren, die mit ihrer nichtssagenden Miene eher auf einen
Theater-Prinzen, als auf den heldenhaften macedonischen König
schließen läßt. Dem Bilde mangelt gänzlich der historische Zug.
— In vier weiteren Sälen find die 87 Aquarelle der „Lociete
ro)'ale beige ckes aquarellistes" untergebracht. Einzig in ihrer
Art sind die Aquarelle des in Ungarn sehr gut bekannten und
geschätzten Viktor llyterschauts, die eine ganze Wand bedecken.
Sämtliche zeichnen sich durch originelle Auffassung und wunder-
bare Stimmung aus. Staquet, Hageman und Oyens
haben sich mit kleineren, aber sehr hübschen Sachen eingestellt.
Leon Abry war diesmal nicht glücklich. Jenes junge Mädchen,
welches auf seinem Bild den Jntensionen des Künstlers ent-
sprechend dem „ckolce 5ar uieute'' huldigen soll, sieht wie eine
Gliederpuppe aus. Hervorragend sind dagegen Louis Tietz,
Jean Baes, De Vriendt, Al>red Hubert und GA. Lanneau.
Recht anziehend wirkt ein Tierbild „Das heitere Trio" (drei
junge Katzen blicken vergnügt in die Welt) von Henriette Ronn er.
Der erste Besucher der Ausstellung war Minister Graf CsLkh,
der in Begleitung des Ministerialrates Szalay im Künstlerhause
erschien. Der Minister hat einige Aquarelle für das National-
museum angekauft. l«B
D. L Wien. Am 13. Oktober ist dem Geheimen Re-
gierungsrat, Professor l)r. Birchow in Berlin, eine besondere
Jubelgabe der wissenschaftlichen Welt, die große goldene „Virchow-
Medaille" überreicht worden. Sie ist 180 mm hoch und unge-
fähr 5 Pfund schwer und ein hervorragendes Kunstwerk des
hiesigen Kammer-Medailleurs A. Scharff. Die Vorderseite
zeigt in überaus gelungener Ausführung das Brustbild des
Jubilars und zu den Seiten: L2TXT: — I-XX. Die Umschrift
lautet: RVV0O?LV8 VILOLO^V. I>0LQI8IiXXV8. OIVI8.
L8R0I-IX8X8I8. Die Rückseite der Medaille ist heraldisch ge-
staltet. Bei dem Bilde der Isis lüftet mit seiner Rechten der
geflügelte Genius der Forschung, der in der Linken eine brennende
Fackel hält, den Schleier. Am Fuße der Säule lehnt eine Tasel
mit der Frontansicht des pathologischen Instituts in Berlin. Zur
Linken erblickt man die Jdealgestalt der Wissenschaft, die rechte
Hand auf das auf ihrem Schoße ruhende Buch gelegt, und mit
der auf den Tisch gestützten Linken einen Schädel haltend, an
dem der Frontalfortsatz der Schläfenschuppe deutlich sichtbar ist.
Aus einem Gestell im Hintergründe erblickt man eine Gesichts-
und eine Hausurne, sowie drei deformierte Schädel. An und auf
dem Tische stehen und liegen Bücher, ein Mikroskop, eine Prä-
Paratentafel, ein Präparatenglas mit der Ausschrift „ONBOI-IX",
der in Görlitz aufbewahrte, sogenannte Lausitzer Wagen und ein
offenes Etui mit Pathologischem Besteck. Schließlich gewahrt
man nach links eine Mumie. Nuten liest man: ÖÄIXI8
68HVI-X X 08I-I-VI-X. — Bon dieser Medaille wird ein
Exemplar in Silber für die Gemahlin des Jubilars und ferner
bronzene Abdrücke für die übrigen Familienmitglieder Virchows
und für die bei der Stiftung beteiligten Universitäten und wissen-
schaftlichen Institute hergestellt werden. I»»?!
^V. O. Berlin. Professor Reinhold B eg as hat das
größte plastische Werk, welches das neue Reichstagsgebüude
schmücken wird, nahezu vollendet; es ist dies eine Gruppe, welche
hinter dein westlichen Giebel auf der Attika des Gebäudes Auf-
stellung sinken wird. Tie im Sattel sitzende Germania bildet
den Mittelpunkt des Ganzen; das mit dem Panzer bewehrte,
links auf einen mächtigen Schild sich stützende Weib, dessen Haupt
die lorbeerumkränzte Kaiserkrone schmückt, hält mit der Rechten
das Reichsbanner hoch empor. Von ihren Schultern wallt der
hermelingcschmückle Hcrrschcrmantel herab. Das gewaltige Streit-
roß ivird zur Rechten von einem kräftigen Jünglinge, dem
„siegenden Frieden", zur Linken von dem „Ruhme", einer idealen
jugendlichen Frauengestalt, geleitet. Der Friede trägt das Reichs-
schwert, auf welchem die Siegespalme ruht; der Ruhm, in wal-
lende Gewänder gehüllt, hält mit der Rechten die Zügel, und
verkündet durch die hocherhobene Tuba aller Welt die ruhmvollen
Ereignisse. Die einzelnen Figuren der Gruppe sind 4 m, die der
Germania nahezu 7 m hoch. Die Idee zu diesem Entwürfe hat
der Erbauer des Reichstagsgebäudes, Baurat Paul Wallot,
gegeben. lsvch
L.-v. Darmstadt. Wilhelm Bader, ein hochbegabter,
der Münchener Schule angehörender Künstler, hat hier in seiner
Vaterstadt wieder eine Anzahl Gemälde ausgestellt, die die über-
aus feinsinnige Art seines eigenartigen Talentes recht zur An-
schauung bringen, so eine heilige Elisabeth von gradezu Feuer-
bach'scher Schönheit und eine kleine „Herbst" betitelte köstliche
deutsche llrwaldidylle, wie deren Bader schon so viele geschaffen,
und andres mehr. In diesen kleinen Idyllen erinnert der
Künstler in der Feinheit der Naturempfindung und der eigenartig
hochpolitischen Auffassung an Böcklin, ist jedoch urdeutsch.
— Kassel. Die Lehrer an der Kunstschule zu Kassel,
Bildhauer Karl Begas und Maler Emil Neumann, haben
das Prädikat „Professor" erhalten. l»rch
* L.-v. Karlsruhe. Professor Ferdinand Keller hat
im Kunstvercin wieder zwei Kindergruppenbilder in der Art des
von uns in Heft 1 dieses Jahrgangs wiedergegebenen Bildes
zur Ausstellung gebracht und fesselt auch hier wieder durch die
überaus vornehme Farbenstimmung, die allen Werken des Künst-
lers in so vollendeter Weise eigen ist. Die Farben der einen
Bildnisgruppe, zwei Kinder auf einem grauen Plüjchsofa, das
kleinere stehend, von der älteren Schwester umschlugen, bewegen
sich in cremefarbnen, blaßblauen und zartgrauen Tönen, die des
andern Bildes, zwei elegant gekleidete, Arm in Arm gehende
Mädchen verschiedenen Alters mit einem großen Hunde, in grauen,
tief- und hellvioletten Tönen. lboch
* In Dresden ist nach kurzer Krankheit am 11. Oktober
der Maler und Professor an der kgl. Kunstakademie, Or. Theodor
Große, gestorben. Er war gleich Hähnel, der ihm im Tode
in diesem Jahre vorausgegangen ist, ein Vertreter des Klassi-
zismus, deren letzte offizielle Stätte Dresden war. Am 23. April
1829 zu Dresden geboren, besuchte er daselbst seit 1843 die
Kunstakademie, um Bildhauer zu werden. Sein Lehrer Bende-
mann veranlaßte ihn 1847 zur Malerei überzugehen. Sein erstes
größeres Bild, die Leda mit dem Schwan, das er im Jahre 1852
malte, wurde alsbald für die kgl. Gemäldegalerie zu Dresden
angekaust. Weiter malte er mit Bendemann an dessen Wand-
bildern im kgl. Schlosse zu Dresden, selbständig aber einige von
den Decken im Semperschen Museumsgebäude und Wandbilder
im gräflich Solmsschen Schlosse Wildenfels an der Mulde, dar-
stellend die geistlichen und die weltlichen Tugenden und Vorgänge
aus der Geschichte der Grafen zu Solms. Diese Schöpfungen
brachten ihm das akademische Reisestipendium ein; er besuchte
1858 Florenz, 1859 Rom, wo er die italienische Monumental-
malerci studierte und sich ganz besonders für Raffael begeisterte,
der sein Ideal wurde und blieb. Bald nach seiner Rückkehr
errang er den Sieg im Wettbewerb um ein monumentales Werk.
8«