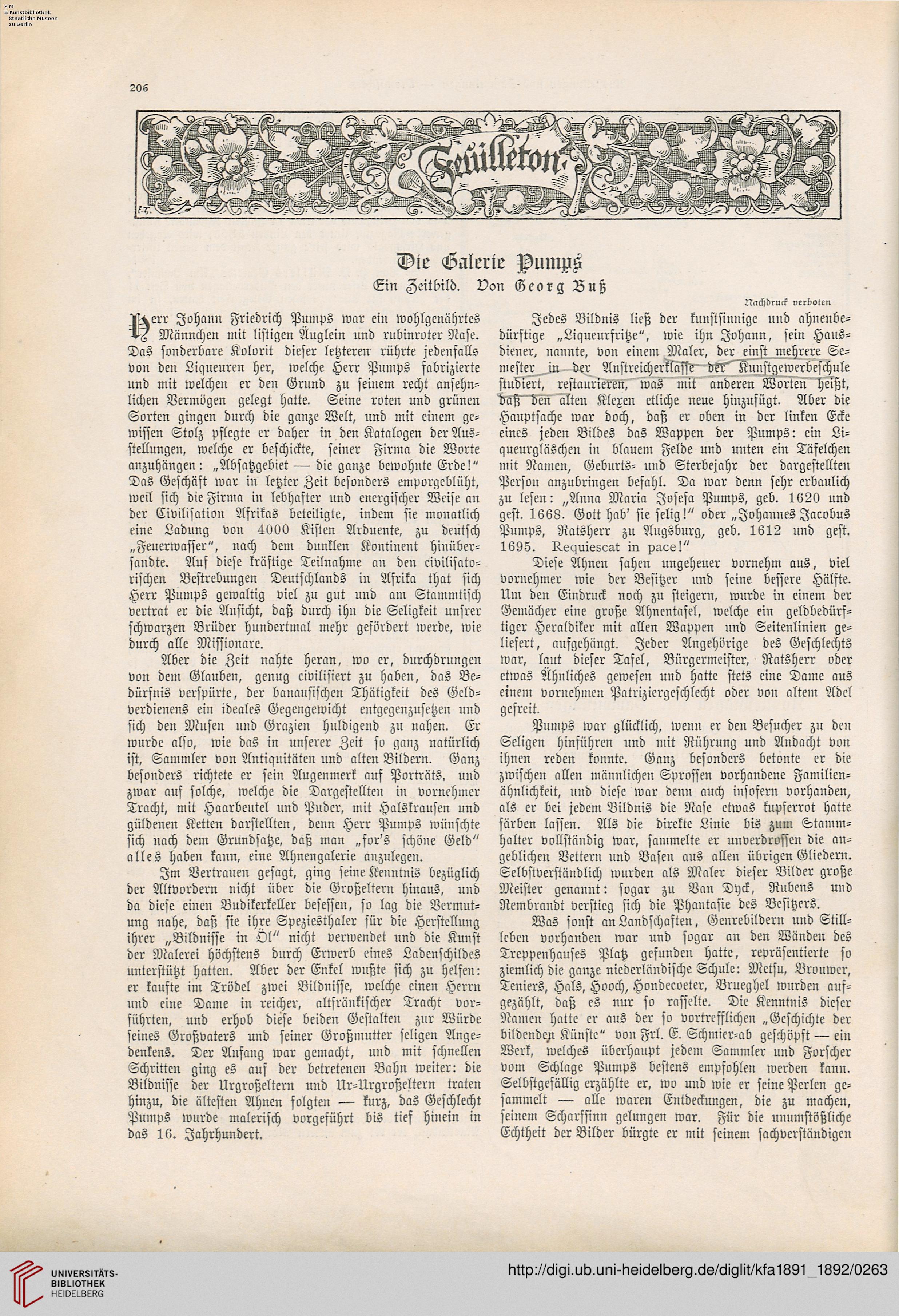206
Die «Valerie PumpK
Lin Zeitbild, von Georg Buß
err Johann Friedrich Pumps war ein wohlgenährtes
Männchen mit listigen Äuglein und rubinroter Nase.
Das sonderbare Kolorit dieser letzteren rührte jedenfalls
von den Liqueuren her, welche Herr Pumps fabrizierte
und mit welchen er den Grund zu seinem recht ansehn-
lichen Vermögen gelegt hatte. Seine roten und grünen
Sorten gingen durch die ganze Welt, und mit einem ge-
wissen Stolz pflegte er daher in den Katalogen der Aus-
stellungen, welche er beschickte, seiner Firma die Worte
anzuhängen: „Absatzgebiet — die ganze bewohnte Erde!"
Das Geschäft war in letzter Zeit besonders emporgeblüht,
weil sich die Firma in lebhafter und energischer Weise an
der Civilisation Afrikas beteiligte, indem sie monatlich
eine Ladung von 4000 Kisten Arduente, zu deutsch
„Feuerwasser", nach dem dunklen Kontinent hinüber-
sandte. Auf diese kräftige Teilnahme an den civilisato-
rischen Bestrebungen Deutschlands in Afrika that sich
Herr Pumps gewaltig viel zu gut und am Stammtisch
vertrat er die Ansicht, daß durch ihn die Seligkeit unsrer
schwarzen Brüder hundertmal mehr gefördert werde, wie
durch alle Missionare.
Aber die Zeit nahte heran, wo er, durchdrungen
von dem Glauben, genug civilisiert zu haben, das Be-
dürfnis verspürte, der banausischen Thätigkeit des Geld-
verdienens ein ideales Gegengewicht entgegenzusetzen und
sich den Musen und Grazien huldigend zu nahen. Er
wurde also, wie das in unserer Zeit so ganz natürlich
ist, Sammler von Antiquitäten und alten Bildern. Ganz
besonders richtete er sein Augenmerk auf Porträts, und
zwar auf solche, welche die Dargestellten in vornehmer
Tracht, mit Haarbeutel und Puder, mit Halskrausen und
güldenen Ketten darstellten, denn Herr Pumps wünschte
sich nach dem Grundsätze, daß man „for's schöne Geld"
alles haben kann, eine Ahnengalerie anzulegen.
Im Vertrauen gesagt, ging seine Kenntnis bezüglich
der Altvordern nicht über die Großeltern hinaus, und
da diese einen Budikerkeller besessen, so lag die Vermut-
ung nahe, daß sie ihre Speziesthaler für die Herstellung
ihrer „Bildnisse in Öl" nicht verwendet und die Kunst
der Malerei höchstens durch Erwerb eines Ladenschildes
unterstützt hatten. Aber der Enkel wußte sich zu helfen:
er kaufte im Trödel zwei Bildnisse, welche einen Herrn
und eine Dame in reicher, altfränkischer Tracht vor-
führten, und erhob diese beiden Gestalten zur Würde
seines Großvaters und seiner Großmutter seligen Ange-
denkens. Der Anfang war gemacht, und mit schnellen
Schritten ging es auf der betretenen Bahn weiter: die
Bildnisse der Urgroßeltern und Ur-Urgroßeltern traten
hinzu, die ältesten Ahnen folgten — kurz, das Geschlecht
Pumps wurde malerisch vorgeführt bis tief hinein in
das 16. Jahrhundert.
Jedes Bildnis ließ der kunstsinnige und ahnenbe-
dürftige „Liqueurfritze", wie ihn Johann, sein Haus-
diener, nannte, von einem Maler, der einst mehrere Se-
mester^in der AnstreicherÄassd—dkr^Künstgewerbeschule
studier:, restaurieren, was mit anderen Worten heißt,
cheaß den Wen Klexen etliche neue hinznfügt. Aber die
Hauptsache war doch, daß er oben in der linken Ecke
eines jeden Bildes das Wappen der Pumps: ein Li-
queurgläschen in blauem Felde und unten ein Täfelchen
mit Namen, Geburts- und Sterbejahr der dargestellten
Person anzubringen befahl. Da war denn sehr erbaulich
zu lesen: „Anna Maria Josefa Pumps, geb. 1620 und
gest. 1668. Gott Hab' sie selig!" oder „Johannes Jacobus
Pumps, Ratsherr zu Augsburg, geb. 1612 und gest.
1695. lLeguiescat in puce!"
Diese Ähnen sahen ungeheuer vornehm aus, viel
vornehmer wie der Besitzer und seine bessere Hälfte.
Um den Eindruck noch zu steigern, wurde in einem der
Gemächer eine große Ähnentafel, welche ein geldbedürf-
tiger Heraldiker mit allen Wappen und Seitenlinien ge-
liefert, aufgehängt. Jeder Angehörige des Geschlechts
war, laut dieser Tafel, Bürgermeister, Ratsherr oder
etwas Ähnliches gewesen und hatte stets eine Dame aus
einem vornehmen Patriziergeschlecht oder von altem Adel
gefreit.
Pumps war glücklich, wenn er den Besucher zu den
Seligen hinführen und mit Rührung und Andacht von
ihnen reden konnte. Ganz besonders betonte er die
zwischen allen männlichen Sprossen vorhandene Familien-
ähnlichkeit, und diese war denn auch insofern vorhanden,
als er bei jedem Bildnis die Nase etwas kupferrot hatte
färben lassen. Als die direkte Linie bis zum Stamm-
halter vollständig war, sammelte er unverdrossen die an-
geblichen Vettern und Basen aus allen übrigen Gliedern.
Selbstverständlich wurden als Maler dieser Bilder große
Meister genannt: sogar zu Van Dyck, Rubens und
Rembrandt verflieg sich die Phantasie des Besitzers.
Was sonst an Landschaften, Genrebildern und Still-
leben vorhanden war und sogar an den Wänden des
Treppenhauses Platz gefunden hatte, repräsentierte so
ziemlich die ganze niederländische Schule: Metsu, Brouwcr,
Teniers, Hals, Hooch, Hondecoeter, Brueghel wurden auf-
gezählt, daß es nur so rasselte. Die Kenntnis dieser
Namen hatte er aus der so vortrefflichen „Geschichte der
bildende/: Künste" von Frl. E. Schmicr-ab geschöpft — ein
Werk, welches überhaupt jedem Sammler und Forscher
vom Schlage Pumps bestens empfohlen werden kann.
Selbstgefällig erzählte er, wo und wie er seine Perlen ge-
sammelt — alle waren Entdeckungen, die zu machen,
seinem Scharfsinn gelungen war. Für die unumstößliche
Echtheit der Bilder bürgte er mit seinem sachverständigen
Die «Valerie PumpK
Lin Zeitbild, von Georg Buß
err Johann Friedrich Pumps war ein wohlgenährtes
Männchen mit listigen Äuglein und rubinroter Nase.
Das sonderbare Kolorit dieser letzteren rührte jedenfalls
von den Liqueuren her, welche Herr Pumps fabrizierte
und mit welchen er den Grund zu seinem recht ansehn-
lichen Vermögen gelegt hatte. Seine roten und grünen
Sorten gingen durch die ganze Welt, und mit einem ge-
wissen Stolz pflegte er daher in den Katalogen der Aus-
stellungen, welche er beschickte, seiner Firma die Worte
anzuhängen: „Absatzgebiet — die ganze bewohnte Erde!"
Das Geschäft war in letzter Zeit besonders emporgeblüht,
weil sich die Firma in lebhafter und energischer Weise an
der Civilisation Afrikas beteiligte, indem sie monatlich
eine Ladung von 4000 Kisten Arduente, zu deutsch
„Feuerwasser", nach dem dunklen Kontinent hinüber-
sandte. Auf diese kräftige Teilnahme an den civilisato-
rischen Bestrebungen Deutschlands in Afrika that sich
Herr Pumps gewaltig viel zu gut und am Stammtisch
vertrat er die Ansicht, daß durch ihn die Seligkeit unsrer
schwarzen Brüder hundertmal mehr gefördert werde, wie
durch alle Missionare.
Aber die Zeit nahte heran, wo er, durchdrungen
von dem Glauben, genug civilisiert zu haben, das Be-
dürfnis verspürte, der banausischen Thätigkeit des Geld-
verdienens ein ideales Gegengewicht entgegenzusetzen und
sich den Musen und Grazien huldigend zu nahen. Er
wurde also, wie das in unserer Zeit so ganz natürlich
ist, Sammler von Antiquitäten und alten Bildern. Ganz
besonders richtete er sein Augenmerk auf Porträts, und
zwar auf solche, welche die Dargestellten in vornehmer
Tracht, mit Haarbeutel und Puder, mit Halskrausen und
güldenen Ketten darstellten, denn Herr Pumps wünschte
sich nach dem Grundsätze, daß man „for's schöne Geld"
alles haben kann, eine Ahnengalerie anzulegen.
Im Vertrauen gesagt, ging seine Kenntnis bezüglich
der Altvordern nicht über die Großeltern hinaus, und
da diese einen Budikerkeller besessen, so lag die Vermut-
ung nahe, daß sie ihre Speziesthaler für die Herstellung
ihrer „Bildnisse in Öl" nicht verwendet und die Kunst
der Malerei höchstens durch Erwerb eines Ladenschildes
unterstützt hatten. Aber der Enkel wußte sich zu helfen:
er kaufte im Trödel zwei Bildnisse, welche einen Herrn
und eine Dame in reicher, altfränkischer Tracht vor-
führten, und erhob diese beiden Gestalten zur Würde
seines Großvaters und seiner Großmutter seligen Ange-
denkens. Der Anfang war gemacht, und mit schnellen
Schritten ging es auf der betretenen Bahn weiter: die
Bildnisse der Urgroßeltern und Ur-Urgroßeltern traten
hinzu, die ältesten Ahnen folgten — kurz, das Geschlecht
Pumps wurde malerisch vorgeführt bis tief hinein in
das 16. Jahrhundert.
Jedes Bildnis ließ der kunstsinnige und ahnenbe-
dürftige „Liqueurfritze", wie ihn Johann, sein Haus-
diener, nannte, von einem Maler, der einst mehrere Se-
mester^in der AnstreicherÄassd—dkr^Künstgewerbeschule
studier:, restaurieren, was mit anderen Worten heißt,
cheaß den Wen Klexen etliche neue hinznfügt. Aber die
Hauptsache war doch, daß er oben in der linken Ecke
eines jeden Bildes das Wappen der Pumps: ein Li-
queurgläschen in blauem Felde und unten ein Täfelchen
mit Namen, Geburts- und Sterbejahr der dargestellten
Person anzubringen befahl. Da war denn sehr erbaulich
zu lesen: „Anna Maria Josefa Pumps, geb. 1620 und
gest. 1668. Gott Hab' sie selig!" oder „Johannes Jacobus
Pumps, Ratsherr zu Augsburg, geb. 1612 und gest.
1695. lLeguiescat in puce!"
Diese Ähnen sahen ungeheuer vornehm aus, viel
vornehmer wie der Besitzer und seine bessere Hälfte.
Um den Eindruck noch zu steigern, wurde in einem der
Gemächer eine große Ähnentafel, welche ein geldbedürf-
tiger Heraldiker mit allen Wappen und Seitenlinien ge-
liefert, aufgehängt. Jeder Angehörige des Geschlechts
war, laut dieser Tafel, Bürgermeister, Ratsherr oder
etwas Ähnliches gewesen und hatte stets eine Dame aus
einem vornehmen Patriziergeschlecht oder von altem Adel
gefreit.
Pumps war glücklich, wenn er den Besucher zu den
Seligen hinführen und mit Rührung und Andacht von
ihnen reden konnte. Ganz besonders betonte er die
zwischen allen männlichen Sprossen vorhandene Familien-
ähnlichkeit, und diese war denn auch insofern vorhanden,
als er bei jedem Bildnis die Nase etwas kupferrot hatte
färben lassen. Als die direkte Linie bis zum Stamm-
halter vollständig war, sammelte er unverdrossen die an-
geblichen Vettern und Basen aus allen übrigen Gliedern.
Selbstverständlich wurden als Maler dieser Bilder große
Meister genannt: sogar zu Van Dyck, Rubens und
Rembrandt verflieg sich die Phantasie des Besitzers.
Was sonst an Landschaften, Genrebildern und Still-
leben vorhanden war und sogar an den Wänden des
Treppenhauses Platz gefunden hatte, repräsentierte so
ziemlich die ganze niederländische Schule: Metsu, Brouwcr,
Teniers, Hals, Hooch, Hondecoeter, Brueghel wurden auf-
gezählt, daß es nur so rasselte. Die Kenntnis dieser
Namen hatte er aus der so vortrefflichen „Geschichte der
bildende/: Künste" von Frl. E. Schmicr-ab geschöpft — ein
Werk, welches überhaupt jedem Sammler und Forscher
vom Schlage Pumps bestens empfohlen werden kann.
Selbstgefällig erzählte er, wo und wie er seine Perlen ge-
sammelt — alle waren Entdeckungen, die zu machen,
seinem Scharfsinn gelungen war. Für die unumstößliche
Echtheit der Bilder bürgte er mit seinem sachverständigen