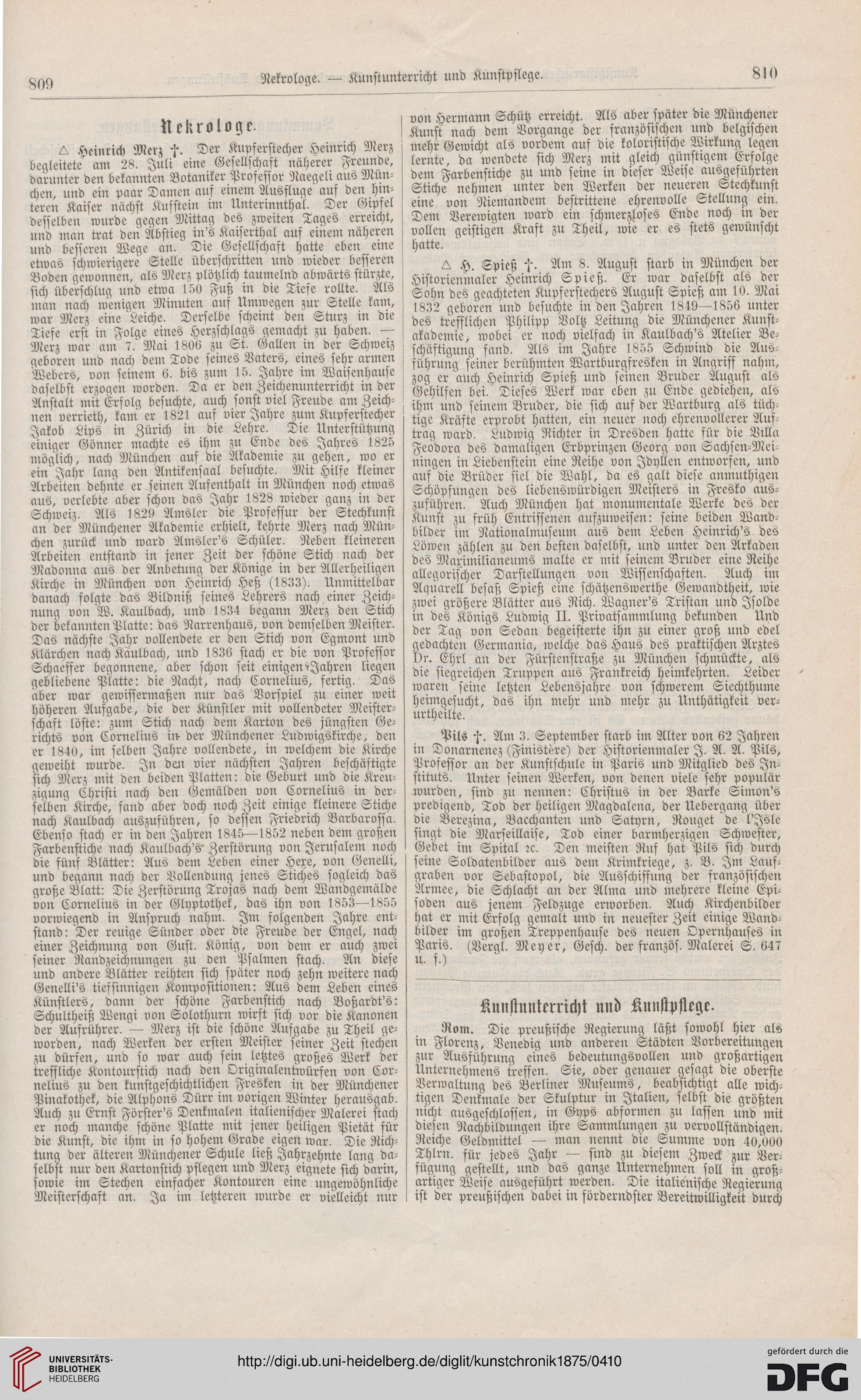809
Nekrologe. — Kunstunterricht und Kunstpflege.
810
tlekrologr.
^ Heinrich Merz 1°. Der Kupferstecher Heinrich Merz
begleitete" am 28. Juli eine Gesellschast näherer Freunde,
darunter den bekannten Botaniker Professor Naegeli aus Mün-
chen, und ein paar Damen auf einem Ausfluqe auf den hin-
teren Kaiser nächst Kufstein im Unterinnthal. Der Gipfel
desselben wurde gegen Mittag des zweiten Tages erreicht,
und man trat den Äbstieg in's Kaiserthal auf einem näheren
und besseren Wege an. Die Gesellschaft hatte eben eine
etwas schwierigere Stelle überschritten und wieder besseren
Boden gewonnen, als Merz plötzlich taumelnd abwärts stürzte,
sich überschlug und etwa 1SV Fuß in die Tiefe rollte. Als
»mn nach wenigen Minuten aus Umwegen zur Stelle kam,
war Merz eine Leiche. Derselbe scheint den Sturz in die
Tiefe erst in Folge eines Herzschlags gemacht zu haben. —
Merz war am 7. Mai 1806 zu St. Gallen in der Schweiz
geboren und nach dem Tode seines Vaters, eines sehr armen
Webers, von seinem 6. bis zum 15. Jahre im Waisenhause
daselbst erzogen worden. Da er den Zeichenunterricht in der
Anstalt mit Grfolg besuchte, auch sonst viel Freude am Zeich-
nen verrieth, kam er 1821 auf vier Jahre zum Kupferstecher
Jakob Lips in Zürich in die Lehre. Die Unterstützung
einiger Gönner machte es ihm zu Ende des Jahres 1825
möglich, nach München auf die Akademie zu gehen, wo er
ein Jahr lang den Antikensaal besuchte. Mit Hilfe kleiner
Arbeiten dehnte er seinen Aufenthalt in München noch etwas
aus, verlebte aber schon das Jahr 1828 wieder ganz in der
Schweiz. Als 1829 Amsler die Professur der Stechkunst
an der Münchener Akademie erhielt, kehrte Merz nach Mün-
chen zurück und ward Amsler's Schüler. Neben kleineren
Arbeiten entstand in jener Zeit der schöne Stich nach der
Madonna aus der Anbetung der Könige in der Allerheiligen
Kirche in München von Heinrich Heß (1833). Unmittelbar
danach folgte das Bildniß seines Lehrers nach einer Zeich-
nung von W. Kaulbach, und 1834 begann Merz den Stich
der bekannten Platte: das Narrenhaus, von demselben Meister.
Das nächste Zahr vollendete er den Stich von Egmont und
Klärchen nach Käulbach, und 1836 stach er die von Professor
Schaeffer begonnene, aber schon seit einigen^Jahren liegen
gebliebene Platte: die Nacht, nach Cornelius, fertig. Das
äber war gewissermaßen nur das Vorspiel zu einer weit
höheren Aufgabe, die der Künstler mit vollendeter Meister-
schaft löste: zum Stich nach dem Karton des jüngsten Ge-
richts von Cornelius in der Münchener Ludwigskirche, den
er 1840, im selben Jahre vollendete, in welchem die Kirche
geweiht wurde. Jn den vier nüchsten Jahren beschäftigte
sich Merz mit den beiden Platten: die Geburt und die Kreu-
zigung Christi nach den Gemälden von Cornelius in der-
selben Kirche, fand aber doch noch Zeit einige kleinere Stiche
nach Kaulbach auszuführen, so dessen Friedrich Barbarossa.
Ebenso stach er in den Jahren 1845—1852 neben dem großen
Farbenstiche nach Kaulbach's' Zerstörung von Jerusalem noch
die fünf Blätter: Aus dem Leben einer Hexe, von Genelli,
und begann nach der Vollendung jenes Stiches sogleich das
große Blatt: Die Zerstörung Trojas nach dem Wandgemälde
von Cornelius in der Glyptothek, das ihn von 1853—1855
vorwiegend in Anspruch nahm. Jm folgenden Jahre ent-
stand: Der reuige Sünder oder die Freude der Engel, nach
einer Zeichnung von Gust. König, von dem er auch zwei
seiner Randzeichnungen zu den Psalmen stach. An diese
und andere Blätter reihten sich später noch zehn weitere nach
Genelli's tiefsinnigen Kompositionen: Aus dem Leben eines
Künstlers, dann der schöne Farbenstich nach Boßardt's:
Schultheiß Wengi von Solothurn wirft sich vor die Kanonen
der Aufrührer. — Merz ist die schöne Aufgabe zu Theil ge-
worden, nach Werken der ersten Meister seiner Zeit stechen
zu dürfen, und so war auch sein letztes großes Werk der
treffliche Kontourstich nach den Originalentwürfen von Cor-
nelius zu den kunstgeschichtlichen Fresken in der Münchener
Pinakothek, die Alphons Äürr im vorigen Winter herausgab.
Auch zu Ernst Förster's Denkmalen italienischer Malerei ßtach
er noch manche schöne Platte mit jener heiligen Pietät für
die Kunst, die ihm in so hohem Grade eigen war. Die Rich-
tung der älteren Münchener Schule ließ Zahrzehnte lang da-
selbst nur den Kartonstich pslegen und Merz eignete sich darin,
sowie im Stechen einfacher Kontouren eine ungewöhnliche
Meisterschaft an. Ja im letzteren wurde er vielleicht nur
von Hermann Schütz erreicht. Als aber später die Münchener
Kunst nach dem Vorgange der französischen und belgischen
mehr Gewicht als vordem auf die koloristische Wirkung legen
lernte, da wendcte sich Merz mit gleich günstigem Erfolge
dem Farbenstiche zu und seine in dieser Weise ausgeführten
Stiche nehmen unter den Werken der neueren Stechkunst
eine von Niemandem bestrittene ehrenvolle Stellung ein.
Dem Verewigten ward ein schmerzsoses Ende noch in der
vollen geistigen Kraft zu Theil, wie er es stets gewünscht
hatte.
H. Spieß 'k- Am 8. August starb in München der
Historienmaler Heinrich Spietz. Er war daselbst als der
Sohn des geachteten Kupferstechers August Spieß am 10. Mai
1832 geboren und besuchte in den Jahren 1849—1856 unter
des trefflichen Philipp Voltz Leitung die Münchener Kunst-
akademie, wobei cr noch vielfach in Kaulbach's Atelier Be-
schäftigung fand. Als im Jahre 1855 Schwind die Aus-
führung seiner berühmten Wartburgfresken in Ilngriff nahm,
zog er auch Heinrich Spieß und seinen Bruder August als
Gehilfen bei. Dieses Werk war eben zu Ende gediehen, als
ihm und seinem Bruder, die sich auf der Wartburg als tüch-
tige Kräfte erprobt hatten, ein neuer noch ehrenvollerer Auf-
trag ward. Ludwig Richter in Dresden hatte für die Vllln
Feödora des damaligen Erbprinzen Georg von Sachsen-Mei-
ningen in Liebenstein eine Reihe von Jdyllen entworfen, und
n>lf die Brüdcr fiel die Wahl, dn eS galt diesc anmuthigen
Schöpfungen des liebenswürdigen Mejsters in Fresko aus-
zuführen. Auch München hat monumentale Werke des der
Kunst zu früh Entrissenen aufzuweisen: seine beiden Wand-
bilder im Nationalmuseum aus dem Leben Heinrich's des
Löwen zählen zu den besten daselbst, und unter den Arkaden
des Maximilianeums malte er mit seincm Bruder eine Reihe
allegorischer Darstellungen von Wissenschaften. Auch im
Aqunrell besaß Spieß eine schätzenswerthe Gewnndtheit, wie
zwei größere Blätter aus Rich. Wagner's Tristan und Jsolde
in des Königs Ludwig II. Privatsammlung bekunden Und
der Tag von Sedan begeisterte ihn zu einer groß und edel
gedachten Germanin, welche das Haus des präktischen Arztes
Ist'. Ehrl an der Fürstenstraße zu München schmückte, als
die siegreichen Truppen auS Frankreich heimkehrten. Leider
waren seine letzten Lebensjahre von schwerem Siechthume
heimgesucht, das ihn mehr und mehr zu Unthätigkeit ver-
urtheilte.
Pils -ß. Am 3. September starb im Alter von 62 Jahren
in Donarnenez (Finistere) der Historienmaler I. A. A. Pils,
Professor an der Kunstschule in Paris und Mitglied des Jn-
stituts. Unter seinen Werken, von denen viele sehr populär
wurden, sind zu nennen: Christus in der Barke Simon's
predigend, Tod der heiligen Magdalena, der Uebergang über
die Berezina, Bacchanten und Satyrn, Rouget de l'Jsle
singt die Marseillaise, Tod einer barmherzigen Schwester,
Gebet im Spital rc. Den meisten Ruf hat Pils sich durch
seine Soldatenbilder aus dem Krimkriege, z. B. Jm Lauf-
graben vor Sebastopol, die Ausschiffung der französischen
Arnree, die Schlacht an der Alma und mehrere kleine Epi-
soden aus jenem Feldzuge erworben. Auch Kirchenbilder
hat er mit Erfolg gemalt und in neuester Zeit einige Wand-
bilder im großen Trsppenhause des neuen Opernhauses in
Paris. (Vergl. Mey er, Gesch. der französ. Malerei S. 647
u. f.)
Lmistlmtcrncht »iii> Kunstvflegr.
Rom. Die preußische Regierunq läßt sorvohl hier als
in Florenz, Venedig und anderen Städten Vorbereitungen
zur Ausführung eines bedeutungsvollen und großartigen
Unternehmens treffen. Sie, oder genauer gesagt die oberste
Verwaltung des Berliner Museums, beabsichtigt alle wich-
tigen Denkmale der Skulptur in Jtalien, selbst' die größten
nicht ausgeschlossen, in Gyps abformen zu lassen und mit
diesen Nachbildungen ihre Sammlungen zu vervollständigen.
Reiche Geldmittel — man nennt die Summe von 40,000
THIrn. für jedes Zahr — sind zu diesem Zweck zur Ver-
fügung gestellt, und das ganze Unternehmen soll in groß-
artiger Weise ausgeführt werden. Die italienische Regierung
ist der preußischen dabei in förderndster Bereitwilligkeit durch
Nekrologe. — Kunstunterricht und Kunstpflege.
810
tlekrologr.
^ Heinrich Merz 1°. Der Kupferstecher Heinrich Merz
begleitete" am 28. Juli eine Gesellschast näherer Freunde,
darunter den bekannten Botaniker Professor Naegeli aus Mün-
chen, und ein paar Damen auf einem Ausfluqe auf den hin-
teren Kaiser nächst Kufstein im Unterinnthal. Der Gipfel
desselben wurde gegen Mittag des zweiten Tages erreicht,
und man trat den Äbstieg in's Kaiserthal auf einem näheren
und besseren Wege an. Die Gesellschaft hatte eben eine
etwas schwierigere Stelle überschritten und wieder besseren
Boden gewonnen, als Merz plötzlich taumelnd abwärts stürzte,
sich überschlug und etwa 1SV Fuß in die Tiefe rollte. Als
»mn nach wenigen Minuten aus Umwegen zur Stelle kam,
war Merz eine Leiche. Derselbe scheint den Sturz in die
Tiefe erst in Folge eines Herzschlags gemacht zu haben. —
Merz war am 7. Mai 1806 zu St. Gallen in der Schweiz
geboren und nach dem Tode seines Vaters, eines sehr armen
Webers, von seinem 6. bis zum 15. Jahre im Waisenhause
daselbst erzogen worden. Da er den Zeichenunterricht in der
Anstalt mit Grfolg besuchte, auch sonst viel Freude am Zeich-
nen verrieth, kam er 1821 auf vier Jahre zum Kupferstecher
Jakob Lips in Zürich in die Lehre. Die Unterstützung
einiger Gönner machte es ihm zu Ende des Jahres 1825
möglich, nach München auf die Akademie zu gehen, wo er
ein Jahr lang den Antikensaal besuchte. Mit Hilfe kleiner
Arbeiten dehnte er seinen Aufenthalt in München noch etwas
aus, verlebte aber schon das Jahr 1828 wieder ganz in der
Schweiz. Als 1829 Amsler die Professur der Stechkunst
an der Münchener Akademie erhielt, kehrte Merz nach Mün-
chen zurück und ward Amsler's Schüler. Neben kleineren
Arbeiten entstand in jener Zeit der schöne Stich nach der
Madonna aus der Anbetung der Könige in der Allerheiligen
Kirche in München von Heinrich Heß (1833). Unmittelbar
danach folgte das Bildniß seines Lehrers nach einer Zeich-
nung von W. Kaulbach, und 1834 begann Merz den Stich
der bekannten Platte: das Narrenhaus, von demselben Meister.
Das nächste Zahr vollendete er den Stich von Egmont und
Klärchen nach Käulbach, und 1836 stach er die von Professor
Schaeffer begonnene, aber schon seit einigen^Jahren liegen
gebliebene Platte: die Nacht, nach Cornelius, fertig. Das
äber war gewissermaßen nur das Vorspiel zu einer weit
höheren Aufgabe, die der Künstler mit vollendeter Meister-
schaft löste: zum Stich nach dem Karton des jüngsten Ge-
richts von Cornelius in der Münchener Ludwigskirche, den
er 1840, im selben Jahre vollendete, in welchem die Kirche
geweiht wurde. Jn den vier nüchsten Jahren beschäftigte
sich Merz mit den beiden Platten: die Geburt und die Kreu-
zigung Christi nach den Gemälden von Cornelius in der-
selben Kirche, fand aber doch noch Zeit einige kleinere Stiche
nach Kaulbach auszuführen, so dessen Friedrich Barbarossa.
Ebenso stach er in den Jahren 1845—1852 neben dem großen
Farbenstiche nach Kaulbach's' Zerstörung von Jerusalem noch
die fünf Blätter: Aus dem Leben einer Hexe, von Genelli,
und begann nach der Vollendung jenes Stiches sogleich das
große Blatt: Die Zerstörung Trojas nach dem Wandgemälde
von Cornelius in der Glyptothek, das ihn von 1853—1855
vorwiegend in Anspruch nahm. Jm folgenden Jahre ent-
stand: Der reuige Sünder oder die Freude der Engel, nach
einer Zeichnung von Gust. König, von dem er auch zwei
seiner Randzeichnungen zu den Psalmen stach. An diese
und andere Blätter reihten sich später noch zehn weitere nach
Genelli's tiefsinnigen Kompositionen: Aus dem Leben eines
Künstlers, dann der schöne Farbenstich nach Boßardt's:
Schultheiß Wengi von Solothurn wirft sich vor die Kanonen
der Aufrührer. — Merz ist die schöne Aufgabe zu Theil ge-
worden, nach Werken der ersten Meister seiner Zeit stechen
zu dürfen, und so war auch sein letztes großes Werk der
treffliche Kontourstich nach den Originalentwürfen von Cor-
nelius zu den kunstgeschichtlichen Fresken in der Münchener
Pinakothek, die Alphons Äürr im vorigen Winter herausgab.
Auch zu Ernst Förster's Denkmalen italienischer Malerei ßtach
er noch manche schöne Platte mit jener heiligen Pietät für
die Kunst, die ihm in so hohem Grade eigen war. Die Rich-
tung der älteren Münchener Schule ließ Zahrzehnte lang da-
selbst nur den Kartonstich pslegen und Merz eignete sich darin,
sowie im Stechen einfacher Kontouren eine ungewöhnliche
Meisterschaft an. Ja im letzteren wurde er vielleicht nur
von Hermann Schütz erreicht. Als aber später die Münchener
Kunst nach dem Vorgange der französischen und belgischen
mehr Gewicht als vordem auf die koloristische Wirkung legen
lernte, da wendcte sich Merz mit gleich günstigem Erfolge
dem Farbenstiche zu und seine in dieser Weise ausgeführten
Stiche nehmen unter den Werken der neueren Stechkunst
eine von Niemandem bestrittene ehrenvolle Stellung ein.
Dem Verewigten ward ein schmerzsoses Ende noch in der
vollen geistigen Kraft zu Theil, wie er es stets gewünscht
hatte.
H. Spieß 'k- Am 8. August starb in München der
Historienmaler Heinrich Spietz. Er war daselbst als der
Sohn des geachteten Kupferstechers August Spieß am 10. Mai
1832 geboren und besuchte in den Jahren 1849—1856 unter
des trefflichen Philipp Voltz Leitung die Münchener Kunst-
akademie, wobei cr noch vielfach in Kaulbach's Atelier Be-
schäftigung fand. Als im Jahre 1855 Schwind die Aus-
führung seiner berühmten Wartburgfresken in Ilngriff nahm,
zog er auch Heinrich Spieß und seinen Bruder August als
Gehilfen bei. Dieses Werk war eben zu Ende gediehen, als
ihm und seinem Bruder, die sich auf der Wartburg als tüch-
tige Kräfte erprobt hatten, ein neuer noch ehrenvollerer Auf-
trag ward. Ludwig Richter in Dresden hatte für die Vllln
Feödora des damaligen Erbprinzen Georg von Sachsen-Mei-
ningen in Liebenstein eine Reihe von Jdyllen entworfen, und
n>lf die Brüdcr fiel die Wahl, dn eS galt diesc anmuthigen
Schöpfungen des liebenswürdigen Mejsters in Fresko aus-
zuführen. Auch München hat monumentale Werke des der
Kunst zu früh Entrissenen aufzuweisen: seine beiden Wand-
bilder im Nationalmuseum aus dem Leben Heinrich's des
Löwen zählen zu den besten daselbst, und unter den Arkaden
des Maximilianeums malte er mit seincm Bruder eine Reihe
allegorischer Darstellungen von Wissenschaften. Auch im
Aqunrell besaß Spieß eine schätzenswerthe Gewnndtheit, wie
zwei größere Blätter aus Rich. Wagner's Tristan und Jsolde
in des Königs Ludwig II. Privatsammlung bekunden Und
der Tag von Sedan begeisterte ihn zu einer groß und edel
gedachten Germanin, welche das Haus des präktischen Arztes
Ist'. Ehrl an der Fürstenstraße zu München schmückte, als
die siegreichen Truppen auS Frankreich heimkehrten. Leider
waren seine letzten Lebensjahre von schwerem Siechthume
heimgesucht, das ihn mehr und mehr zu Unthätigkeit ver-
urtheilte.
Pils -ß. Am 3. September starb im Alter von 62 Jahren
in Donarnenez (Finistere) der Historienmaler I. A. A. Pils,
Professor an der Kunstschule in Paris und Mitglied des Jn-
stituts. Unter seinen Werken, von denen viele sehr populär
wurden, sind zu nennen: Christus in der Barke Simon's
predigend, Tod der heiligen Magdalena, der Uebergang über
die Berezina, Bacchanten und Satyrn, Rouget de l'Jsle
singt die Marseillaise, Tod einer barmherzigen Schwester,
Gebet im Spital rc. Den meisten Ruf hat Pils sich durch
seine Soldatenbilder aus dem Krimkriege, z. B. Jm Lauf-
graben vor Sebastopol, die Ausschiffung der französischen
Arnree, die Schlacht an der Alma und mehrere kleine Epi-
soden aus jenem Feldzuge erworben. Auch Kirchenbilder
hat er mit Erfolg gemalt und in neuester Zeit einige Wand-
bilder im großen Trsppenhause des neuen Opernhauses in
Paris. (Vergl. Mey er, Gesch. der französ. Malerei S. 647
u. f.)
Lmistlmtcrncht »iii> Kunstvflegr.
Rom. Die preußische Regierunq läßt sorvohl hier als
in Florenz, Venedig und anderen Städten Vorbereitungen
zur Ausführung eines bedeutungsvollen und großartigen
Unternehmens treffen. Sie, oder genauer gesagt die oberste
Verwaltung des Berliner Museums, beabsichtigt alle wich-
tigen Denkmale der Skulptur in Jtalien, selbst' die größten
nicht ausgeschlossen, in Gyps abformen zu lassen und mit
diesen Nachbildungen ihre Sammlungen zu vervollständigen.
Reiche Geldmittel — man nennt die Summe von 40,000
THIrn. für jedes Zahr — sind zu diesem Zweck zur Ver-
fügung gestellt, und das ganze Unternehmen soll in groß-
artiger Weise ausgeführt werden. Die italienische Regierung
ist der preußischen dabei in förderndster Bereitwilligkeit durch