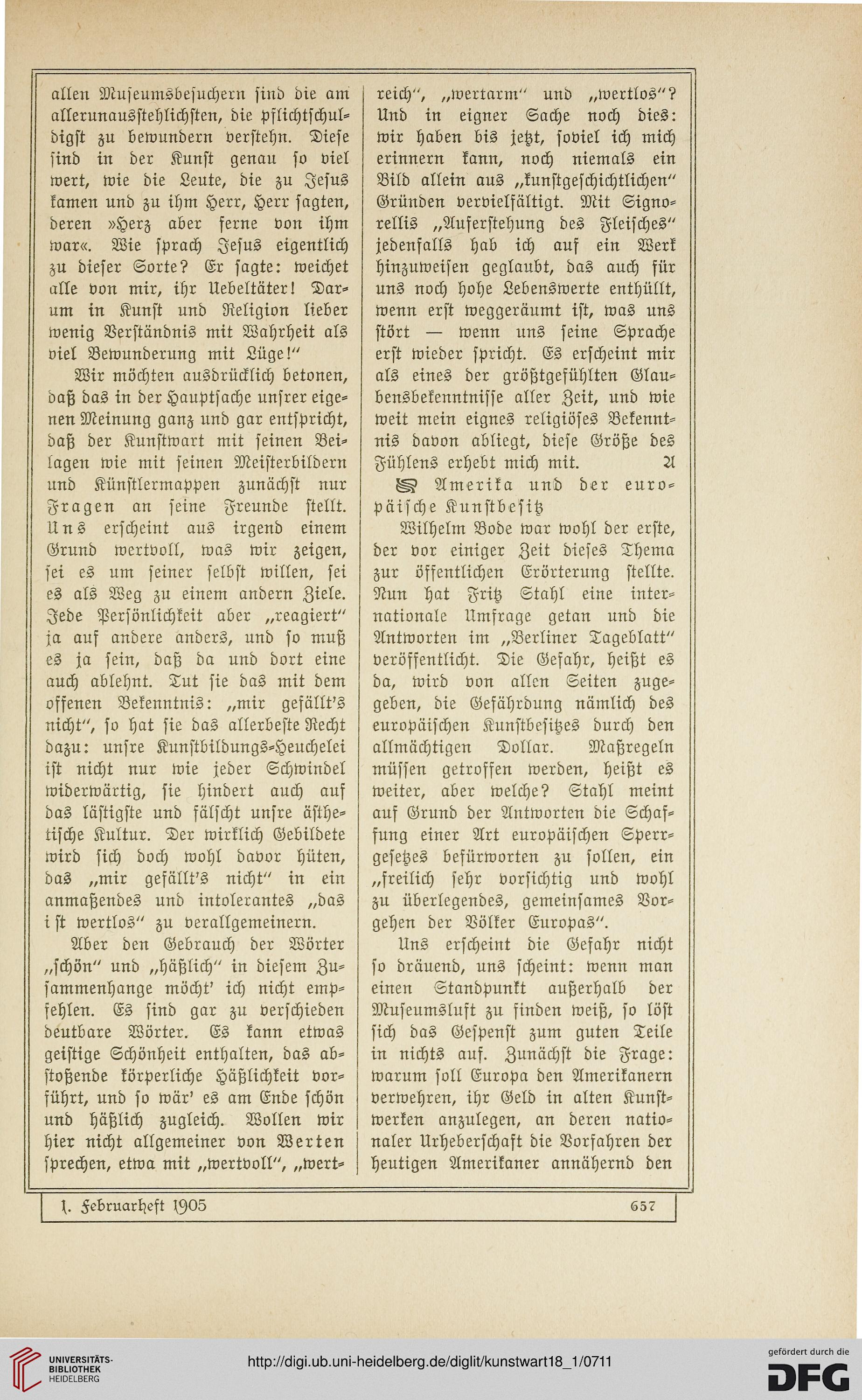allen Museumsbesuchern sind die am
allerunausstehlichsten, die pslichtschul-
digst zu bewundern verstehn. Diese
siud in der Kunst genau so viel
wert, wie die Leute, die zu Jesus
kamen uud zu ihm Herr, Herr sagten,
deren »Herz aber ferne von ihm
war«. Wie sprach Jesus eigentlich
zu dieser Sorte? Er sagte: weichet
alle von mir, ihr Uebeltäter! Dar-
um in Kunst und Religion lieber
wenig Verständnis mit Wahrheit als
oiel Bewunderung mit Lüge!"
Wir möchten ansdrücklich betonen,
daß das in der Hauptsache unsrer eige-
nen Meinung ganz und gar entspricht,
daß der Kunstwart mit seinen Bei-
lagen wie mit seinen Meisterbildern
und Künstlermappen zunächst nur
Fragen an seine Freunde stellt.
Uns erscheint ans irgend einem
Grund wertvoll, was wir zeigen,
sei es um seiner selbst willen, sei
es als Weg zu einem andern Ziele.
Jede Persönlichkeit aber „reagiert"
ja auf andere anders, und so muß
es ja sein, daß da und dort eine
auch ablehnt. Tut sie das mit dem
offenen Bekenntnis: „mir gefällt's
nicht", so hat sie das allerbeste Recht
dazu: unsre Kunstbildungs-Heuchelei
ist nicht nur wie jeder Schwindel
widerwärtig, sie hindert auch auf
das lästigste und fälscht unsre ästhe-
tische Kultur. Der wirklich Gebildete
wird sich doch wohl davor hüten,
das „mir gefällt's nicht" in ein
anmaßendes und intolerantes „das
i st wertlos" zu verallgemeinern.
Aber den Gebrauch der Wörter
„schön" und „häßlich" in diesem Zu-
sammenhange möcht' ich nicht emp-
fehlen. Es sind gar zu verschieden
deutbare Wörter. Es kann etwas
geistige Schönheit enthalten, das ab-
stoßende körperliche Häßlichkeit vor-
führt, und so wär' es am Ende schön
und häßlich zugleich. Wollen wir
hier nicht allgemeiner von Werten
sprechen, etwa mit „wertvoll", „wert-
reich", „wertarm" und „wertlos"?
Und in eigner Sache noch dies:
wir haben bis jetzt, soviel ich mich
erinnern kann, noch niemals ein
Bild allein aus „kunstgeschichtlichen"
Gründen vervielfältigt. Mit Signo-
rellis „Auferstehung des Fleisches"
jedenfalls hab ich auf ein Werk
hinzuweisen geglaubt, das auch für
uns noch hohe Lebenswerte enthüllt,
wenn erst weggeräumt ist, was uns
stört — wenn uns seine Sprache
erst wieder spricht. Es erscheint mir
als eines der größtgefühlten Glau-
bensbekenntnisse aller Zeit, und wie
weit mein eignes religiöses Bekennt-
nis davon abliegt, diese Größe des
Fühlens erhebt mich mit. A
W Amerika und der euro-
päische Kunstbesitz
Wilhelm Bode war wohl der erste,
der vor einiger Zeit dieses Thema
zur öffeutlichen Erörterung stellte.
Nun hat Fritz Stahl eine inter-
nationale Umfrage getan und die
Antworten im „Berliner Tageblatt"
veröffentlicht. Die Gefahr, heißt es
da, wird von allen Seiten zuge-
geben, die Gefährdung nämlich des
europäischen Kunstbesitzes durch den
allmächtigen Dollar. Maßregeln
müssen getroffen werden, heißt es
weiter, aber welche? Stahl meint
auf Grund der Antworten die Schaf-
fung einer Art europäischen Sperr-
gesetzes befürworten zu sollen, ein
„freilich sehr vorsichtig und wohl
zu überlegendes, gemeinsames Vor-
gehen der Völker Europas".
Uns erscheint die Gefahr nicht
so dräuend, uns scheint: wenn man
einen Standpunkt außerhalb der
Museumslust zu finden weiß, so löst
sich das Gespenst zum guten Teile
in nichts auf. Zunächst die Frage:
warum soll Europa den Amerikanern
verwehren, ihr Geld in alten Kunst-
werken anzulegen, an deren natio-
naler Urheberschaft die Vorfahren der
heutigen Amerikaner annähernd den
h Februarheft sZOö 657
allerunausstehlichsten, die pslichtschul-
digst zu bewundern verstehn. Diese
siud in der Kunst genau so viel
wert, wie die Leute, die zu Jesus
kamen uud zu ihm Herr, Herr sagten,
deren »Herz aber ferne von ihm
war«. Wie sprach Jesus eigentlich
zu dieser Sorte? Er sagte: weichet
alle von mir, ihr Uebeltäter! Dar-
um in Kunst und Religion lieber
wenig Verständnis mit Wahrheit als
oiel Bewunderung mit Lüge!"
Wir möchten ansdrücklich betonen,
daß das in der Hauptsache unsrer eige-
nen Meinung ganz und gar entspricht,
daß der Kunstwart mit seinen Bei-
lagen wie mit seinen Meisterbildern
und Künstlermappen zunächst nur
Fragen an seine Freunde stellt.
Uns erscheint ans irgend einem
Grund wertvoll, was wir zeigen,
sei es um seiner selbst willen, sei
es als Weg zu einem andern Ziele.
Jede Persönlichkeit aber „reagiert"
ja auf andere anders, und so muß
es ja sein, daß da und dort eine
auch ablehnt. Tut sie das mit dem
offenen Bekenntnis: „mir gefällt's
nicht", so hat sie das allerbeste Recht
dazu: unsre Kunstbildungs-Heuchelei
ist nicht nur wie jeder Schwindel
widerwärtig, sie hindert auch auf
das lästigste und fälscht unsre ästhe-
tische Kultur. Der wirklich Gebildete
wird sich doch wohl davor hüten,
das „mir gefällt's nicht" in ein
anmaßendes und intolerantes „das
i st wertlos" zu verallgemeinern.
Aber den Gebrauch der Wörter
„schön" und „häßlich" in diesem Zu-
sammenhange möcht' ich nicht emp-
fehlen. Es sind gar zu verschieden
deutbare Wörter. Es kann etwas
geistige Schönheit enthalten, das ab-
stoßende körperliche Häßlichkeit vor-
führt, und so wär' es am Ende schön
und häßlich zugleich. Wollen wir
hier nicht allgemeiner von Werten
sprechen, etwa mit „wertvoll", „wert-
reich", „wertarm" und „wertlos"?
Und in eigner Sache noch dies:
wir haben bis jetzt, soviel ich mich
erinnern kann, noch niemals ein
Bild allein aus „kunstgeschichtlichen"
Gründen vervielfältigt. Mit Signo-
rellis „Auferstehung des Fleisches"
jedenfalls hab ich auf ein Werk
hinzuweisen geglaubt, das auch für
uns noch hohe Lebenswerte enthüllt,
wenn erst weggeräumt ist, was uns
stört — wenn uns seine Sprache
erst wieder spricht. Es erscheint mir
als eines der größtgefühlten Glau-
bensbekenntnisse aller Zeit, und wie
weit mein eignes religiöses Bekennt-
nis davon abliegt, diese Größe des
Fühlens erhebt mich mit. A
W Amerika und der euro-
päische Kunstbesitz
Wilhelm Bode war wohl der erste,
der vor einiger Zeit dieses Thema
zur öffeutlichen Erörterung stellte.
Nun hat Fritz Stahl eine inter-
nationale Umfrage getan und die
Antworten im „Berliner Tageblatt"
veröffentlicht. Die Gefahr, heißt es
da, wird von allen Seiten zuge-
geben, die Gefährdung nämlich des
europäischen Kunstbesitzes durch den
allmächtigen Dollar. Maßregeln
müssen getroffen werden, heißt es
weiter, aber welche? Stahl meint
auf Grund der Antworten die Schaf-
fung einer Art europäischen Sperr-
gesetzes befürworten zu sollen, ein
„freilich sehr vorsichtig und wohl
zu überlegendes, gemeinsames Vor-
gehen der Völker Europas".
Uns erscheint die Gefahr nicht
so dräuend, uns scheint: wenn man
einen Standpunkt außerhalb der
Museumslust zu finden weiß, so löst
sich das Gespenst zum guten Teile
in nichts auf. Zunächst die Frage:
warum soll Europa den Amerikanern
verwehren, ihr Geld in alten Kunst-
werken anzulegen, an deren natio-
naler Urheberschaft die Vorfahren der
heutigen Amerikaner annähernd den
h Februarheft sZOö 657