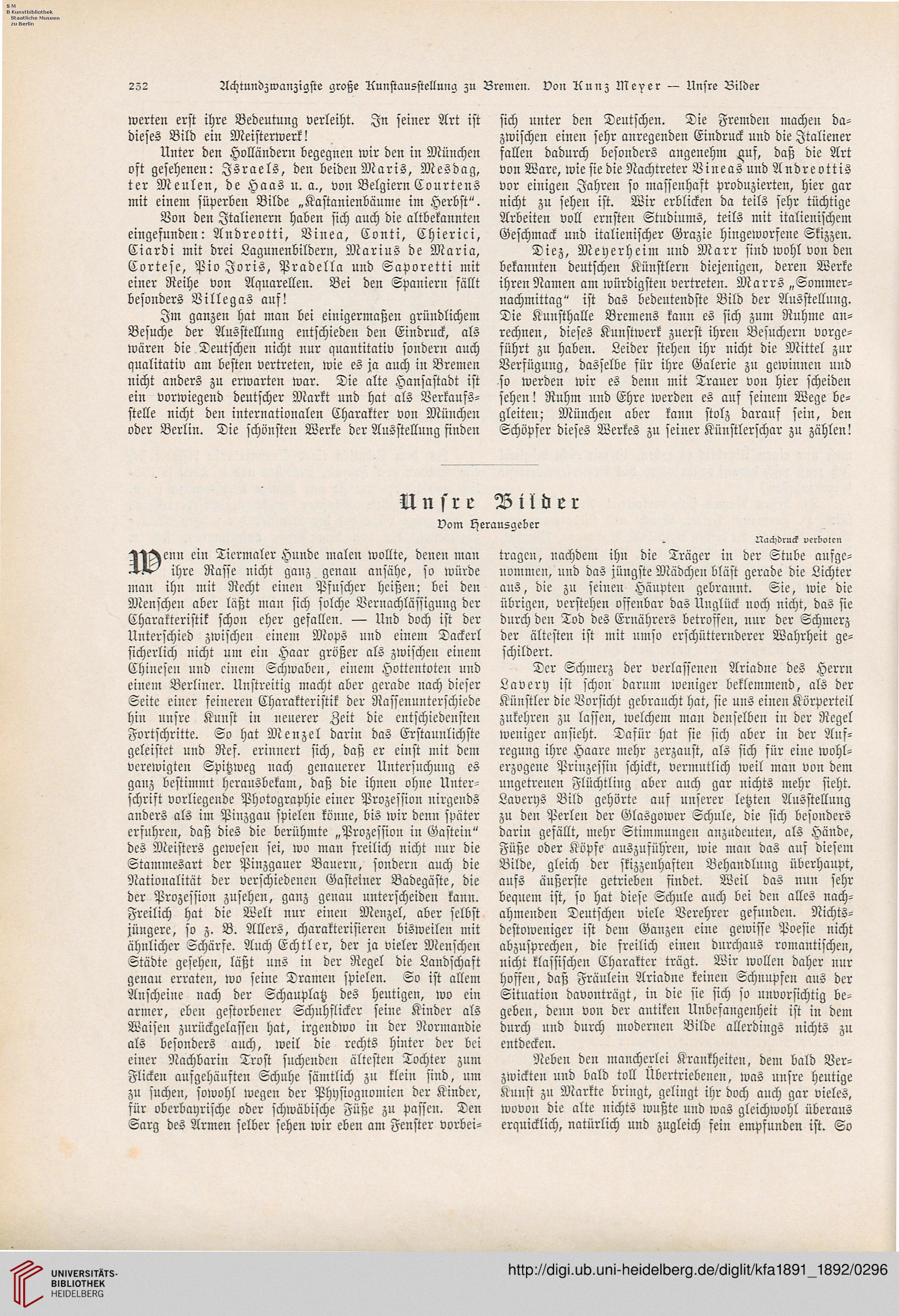2Z2
Achtundzwanzigste große Kunstausstellung zu Bremen, von Kunz Meyer — Unsre Bilder
werten erst ihre Bedeutung verleiht. In seiner Art ist
dieses Bild ein Meisterwerk!
Unter den Holländern begegnen wir den in München
oft gesehenen: Israels, den beiden Maris, Mesdag,
ter M eulen, de Haas u. a., von Belgiern Courtens
mit einem süperben Bilde „Kastanienbäume im Herbst".
Von den Italienern haben sich auch die altbekannten
eingefunden: Andreotti, Vinea, Conti, Chierici,
Ciardi mit drei Lagunenbildern, Marius de Maria,
Cortese, Pio Joris, Pradella und Saporetti mit
einer Reihe von Aquarellen. Bei den Spaniern fällt
besonders Bille gas auf!
Im ganzen hat man bei einigermaßen gründlichem
Besuche der Ausstellung entschieden den Eindruck, als
wären die Deutschen nicht nur quantitativ sondern auch
qualitativ am besten vertreten, wie es ja auch in Bremen
nicht anders zu erwarten war. Die alte Hansastadt ist
ein vorwiegend deutscher Markt und hat als Verkaufs-
stelle nicht den internationalen Charakter von München
oder Berlin. Die schönsten Werke der Ausstellung finden
sich unter den Deutschen. Die Fremden machen da-
zwischen einen sehr anregenden Eindruck und die Italiener
fallen dadurch besonders angenehm §uf, daß die Art
von Ware, wie sie die Nachtreter Vineas und Andreottis
vor einigen Jahren so massenhaft produzierten, hier gar
nicht zu sehen ist. Wir erblicken da teils sehr tüchtige
Arbeiten voll ernsten Studiums, teils mit italienischem
Geschmack und italienischer Grazie hingeworfene Skizzen.
Diez, Meyerheim und Marr sind Wohl von den
bekannten deutschen Künstlern diejenigen, deren Werke
ihren Namen am würdigsten vertreten. Marrs „Sommer-
nachmittag" ist das bedeutendste Bild der Ausstellung.
Die Kunsthalle Bremens kann es sich zum Ruhme an-
rechnen, dieses Kunstwerk zuerst ihren Besuchern vorge-
führt zu haben. Leider stehen ihr nicht die Mittel zur
Verfügung, dasselbe für ihre Galerie zu gewinnen und
so werden wir es denn mit Trauer von hier scheiden
sehen! Ruhm und Ehre werden es auf seinem Wege be-
gleiten; München aber kann stolz darauf sein, den
Schöpfer dieses Werkes zu seiner Künstlerschar zu zählen!
Ans re Dil der
vom Herausgeber
enn ein Tiermaler Hunde malen wollte, denen man
ihre Rasse nicht ganz genau ansähe, so würde
man ihn mit Recht einen Pfuscher heißen; bei den
Menschen aber läßt man sich solche Vernachlässigung der
Charakteristik schon eher gefallen. — Und doch ist der
Unterschied zwischen einem Mops und einem Dackerl
sicherlich nicht um ein Haar größer als zwischen einem
Chinesen und einem Schwaben, einem Hottentoten und
einem Berliner. Unstreitig macht aber gerade nach dieser
Seite einer feineren Charakteristik der Rassenunterschiede
hin unsre Kunst in neuerer Zeit die entschiedensten
Fortschritte. So hat Menzel darin das Erstaunlichste
geleistet und Res. erinnert sich, daß er einst mit dem
verewigten Spitzweg nach genauerer Untersuchung es
ganz bestimmt herausbckam, daß die ihnen ohne Unter-
schrift vorliegende Photographie einer Prozession nirgends
anders als im Pinzgau spielen könne, bis wir denn später
erfuhren, daß dies die berühmte „Prozession in Gastein"
des Meisters gewesen sei, wo man freilich nicht nur die
Stammesart der Pinzgauer Bauern, sondern auch die
Nationalität der verschiedenen Gastetner Badegäste, die
der Prozession zusehen, ganz genau unterscheiden kann.
Freilich hat die Welt nur einen Menzel, aber selbst
jüngere, so z. B. Alters, charakterisieren bisweilen mit
ähnlicher Schärfe. Auch Echtler, der ja vieler Menschen
Städte gesehen, läßt uns in der Regel die Landschaft
genau erraten, wo seine Dramen spielen. So ist allem
Anscheine nach der Schauplatz des heutigen, wo ein
armer, eben gestorbener Schuhflicker seine Kinder als
Waisen zurückgelassen hat, irgendwo in der Normandie
als besonders auch, weil die rechts hinter der bei
einer Nachbarin Trost suchenden ältesten Tochter zum
Flicken aufgehäuften Schuhe sämtlich zu klein sind, um
zu suchen, sowohl wegen der Physiognomien der Kinder,
für oberbayrische oder schwäbische Füße zu passen. Den
Sarg des Armen selber sehen wir eben am Fenster vorbei-
tragcn, nachdem ihn die Träger in der Stube ausge-
nommen, und das jüngste Mädchen bläst gerade die Lichter
aus, die zu seinen Häupten gebrannt. Sie, wie die
übrigen, verstehen offenbar das Unglück noch nicht, das sie
durch den Tod des Ernährers betroffen, nur der Schmerz
der ältesten ist mit umso erschütternderer Wahrheit ge-
schildert.
Der Schmerz der verlassenen Ariadne des Herrn
Lavery ist schon darum weniger beklemmend, als der
Künstler die Vorsicht gebraucht hat, sie uns einen Körperteil
zukehren zu lassen, welchem man denselben in der Regel
weniger ansieht. Dafür hat sie sich aber in der Auf-
regung ihre Haare mehr zerzaust, als sich für eine wohl-
erzogene Prinzessin schickt, vermutlich weil man von dem
ungetreuen Flüchtling aber auch gar nichts mehr sieht.
Laverys Bild gehörte auf unserer letzten Ausstellung
zu den Perlen der Glasgower Schule, die sich besonders
darin gefällt, mehr Stimmungen anzudeuten, als Hände,
Füße oder Köpfe auszuführen, wie man das auf diesem
Bilde, gleich der skizzenhaften Behandlung überhaupt,
aufs äußerste getrieben findet. Weil das nun sehr
bequem ist, so hat diese Schule auch bei den alles nach-
ahmeuden Deutschen viele Verehrer gefunden. Nichts-
destoweniger ist dem Ganzen eine gewisse Poesie nicht
abzusprechen, die freilich einen durchaus romantischen,
nicht klassischen Charakter trägt. Wir wollen daher nur
hoffen, daß Fräulein Ariadne keinen Schnupfen aus der
Situation davonträgt, in die sie sich so unvorsichtig be-
geben, denn von der antiken Unbefangenheit ist in dem
durch und durch modernen Bilde allerdings nichts zu
entdecken.
Neben den mancherlei Krankheiten, dem bald Ver-
zwickten und bald toll Übertriebenen, was unsre heutige
Kunst zu Markte bringt, gelingt ihr doch auch gar vieles,
wovon die alte nichts wußte und was gleichwohl überaus
erquicklich, natürlich und zugleich fein empfunden ist. So
Achtundzwanzigste große Kunstausstellung zu Bremen, von Kunz Meyer — Unsre Bilder
werten erst ihre Bedeutung verleiht. In seiner Art ist
dieses Bild ein Meisterwerk!
Unter den Holländern begegnen wir den in München
oft gesehenen: Israels, den beiden Maris, Mesdag,
ter M eulen, de Haas u. a., von Belgiern Courtens
mit einem süperben Bilde „Kastanienbäume im Herbst".
Von den Italienern haben sich auch die altbekannten
eingefunden: Andreotti, Vinea, Conti, Chierici,
Ciardi mit drei Lagunenbildern, Marius de Maria,
Cortese, Pio Joris, Pradella und Saporetti mit
einer Reihe von Aquarellen. Bei den Spaniern fällt
besonders Bille gas auf!
Im ganzen hat man bei einigermaßen gründlichem
Besuche der Ausstellung entschieden den Eindruck, als
wären die Deutschen nicht nur quantitativ sondern auch
qualitativ am besten vertreten, wie es ja auch in Bremen
nicht anders zu erwarten war. Die alte Hansastadt ist
ein vorwiegend deutscher Markt und hat als Verkaufs-
stelle nicht den internationalen Charakter von München
oder Berlin. Die schönsten Werke der Ausstellung finden
sich unter den Deutschen. Die Fremden machen da-
zwischen einen sehr anregenden Eindruck und die Italiener
fallen dadurch besonders angenehm §uf, daß die Art
von Ware, wie sie die Nachtreter Vineas und Andreottis
vor einigen Jahren so massenhaft produzierten, hier gar
nicht zu sehen ist. Wir erblicken da teils sehr tüchtige
Arbeiten voll ernsten Studiums, teils mit italienischem
Geschmack und italienischer Grazie hingeworfene Skizzen.
Diez, Meyerheim und Marr sind Wohl von den
bekannten deutschen Künstlern diejenigen, deren Werke
ihren Namen am würdigsten vertreten. Marrs „Sommer-
nachmittag" ist das bedeutendste Bild der Ausstellung.
Die Kunsthalle Bremens kann es sich zum Ruhme an-
rechnen, dieses Kunstwerk zuerst ihren Besuchern vorge-
führt zu haben. Leider stehen ihr nicht die Mittel zur
Verfügung, dasselbe für ihre Galerie zu gewinnen und
so werden wir es denn mit Trauer von hier scheiden
sehen! Ruhm und Ehre werden es auf seinem Wege be-
gleiten; München aber kann stolz darauf sein, den
Schöpfer dieses Werkes zu seiner Künstlerschar zu zählen!
Ans re Dil der
vom Herausgeber
enn ein Tiermaler Hunde malen wollte, denen man
ihre Rasse nicht ganz genau ansähe, so würde
man ihn mit Recht einen Pfuscher heißen; bei den
Menschen aber läßt man sich solche Vernachlässigung der
Charakteristik schon eher gefallen. — Und doch ist der
Unterschied zwischen einem Mops und einem Dackerl
sicherlich nicht um ein Haar größer als zwischen einem
Chinesen und einem Schwaben, einem Hottentoten und
einem Berliner. Unstreitig macht aber gerade nach dieser
Seite einer feineren Charakteristik der Rassenunterschiede
hin unsre Kunst in neuerer Zeit die entschiedensten
Fortschritte. So hat Menzel darin das Erstaunlichste
geleistet und Res. erinnert sich, daß er einst mit dem
verewigten Spitzweg nach genauerer Untersuchung es
ganz bestimmt herausbckam, daß die ihnen ohne Unter-
schrift vorliegende Photographie einer Prozession nirgends
anders als im Pinzgau spielen könne, bis wir denn später
erfuhren, daß dies die berühmte „Prozession in Gastein"
des Meisters gewesen sei, wo man freilich nicht nur die
Stammesart der Pinzgauer Bauern, sondern auch die
Nationalität der verschiedenen Gastetner Badegäste, die
der Prozession zusehen, ganz genau unterscheiden kann.
Freilich hat die Welt nur einen Menzel, aber selbst
jüngere, so z. B. Alters, charakterisieren bisweilen mit
ähnlicher Schärfe. Auch Echtler, der ja vieler Menschen
Städte gesehen, läßt uns in der Regel die Landschaft
genau erraten, wo seine Dramen spielen. So ist allem
Anscheine nach der Schauplatz des heutigen, wo ein
armer, eben gestorbener Schuhflicker seine Kinder als
Waisen zurückgelassen hat, irgendwo in der Normandie
als besonders auch, weil die rechts hinter der bei
einer Nachbarin Trost suchenden ältesten Tochter zum
Flicken aufgehäuften Schuhe sämtlich zu klein sind, um
zu suchen, sowohl wegen der Physiognomien der Kinder,
für oberbayrische oder schwäbische Füße zu passen. Den
Sarg des Armen selber sehen wir eben am Fenster vorbei-
tragcn, nachdem ihn die Träger in der Stube ausge-
nommen, und das jüngste Mädchen bläst gerade die Lichter
aus, die zu seinen Häupten gebrannt. Sie, wie die
übrigen, verstehen offenbar das Unglück noch nicht, das sie
durch den Tod des Ernährers betroffen, nur der Schmerz
der ältesten ist mit umso erschütternderer Wahrheit ge-
schildert.
Der Schmerz der verlassenen Ariadne des Herrn
Lavery ist schon darum weniger beklemmend, als der
Künstler die Vorsicht gebraucht hat, sie uns einen Körperteil
zukehren zu lassen, welchem man denselben in der Regel
weniger ansieht. Dafür hat sie sich aber in der Auf-
regung ihre Haare mehr zerzaust, als sich für eine wohl-
erzogene Prinzessin schickt, vermutlich weil man von dem
ungetreuen Flüchtling aber auch gar nichts mehr sieht.
Laverys Bild gehörte auf unserer letzten Ausstellung
zu den Perlen der Glasgower Schule, die sich besonders
darin gefällt, mehr Stimmungen anzudeuten, als Hände,
Füße oder Köpfe auszuführen, wie man das auf diesem
Bilde, gleich der skizzenhaften Behandlung überhaupt,
aufs äußerste getrieben findet. Weil das nun sehr
bequem ist, so hat diese Schule auch bei den alles nach-
ahmeuden Deutschen viele Verehrer gefunden. Nichts-
destoweniger ist dem Ganzen eine gewisse Poesie nicht
abzusprechen, die freilich einen durchaus romantischen,
nicht klassischen Charakter trägt. Wir wollen daher nur
hoffen, daß Fräulein Ariadne keinen Schnupfen aus der
Situation davonträgt, in die sie sich so unvorsichtig be-
geben, denn von der antiken Unbefangenheit ist in dem
durch und durch modernen Bilde allerdings nichts zu
entdecken.
Neben den mancherlei Krankheiten, dem bald Ver-
zwickten und bald toll Übertriebenen, was unsre heutige
Kunst zu Markte bringt, gelingt ihr doch auch gar vieles,
wovon die alte nichts wußte und was gleichwohl überaus
erquicklich, natürlich und zugleich fein empfunden ist. So