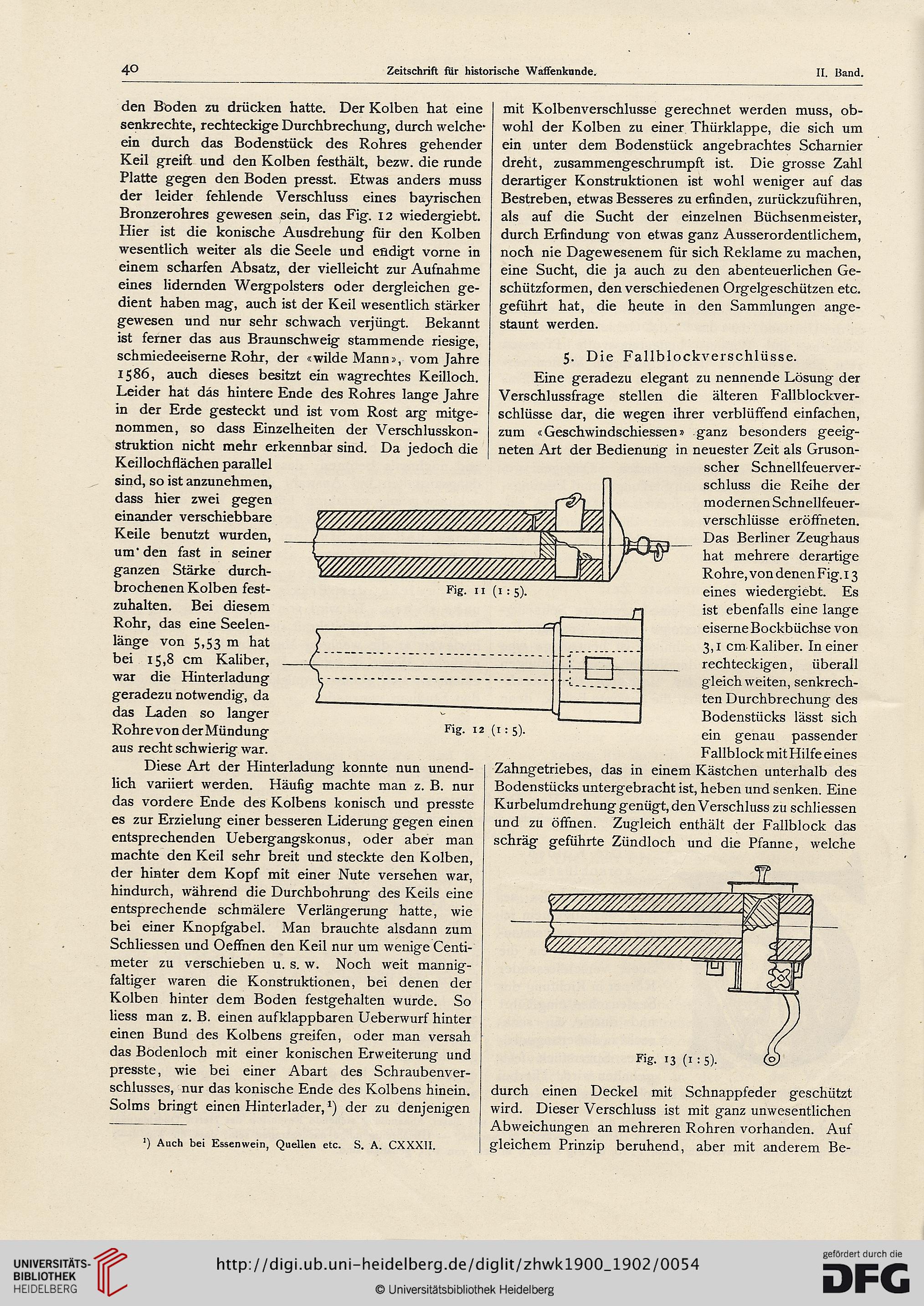40
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
II. Band.
den Boden zu drücken hatte. Der Kolben hat eine
senkrechte, rechteckige Durchbrechung, durch welche'
ein durch das Bodenstück des Rohres gehender
Keil greift und den Kolben festhält, bezw. die runde
Platte gegen den Boden presst. Etwas anders muss
der leider fehlende Verschluss eines bayrischen
Bronzerohres gewesen sein, das Fig. 12 wiedergiebt.
Hier ist die konische Ausdrehung für den Kolben
wesentlich weiter als die Seele und efidigt vorne in
einem scharfen Absatz, der vielleicht zur Aufnahme
eines lidernden Wergpolsters oder dergleichen ge-
dient haben mag, auch ist der Keil wesentlich stärker
gewesen und nur sehr schwach verjüngt. Bekannt
ist ferner das aus Braunschweig stammende riesige,
schmiedeeiserne Rohr, der «wilde Mann», vom Jahre
1586, auch dieses besitzt ein wagrechtes Keilloch.
Leider hat das hintere Ende des Rohres lange Jahre
in der Erde gesteckt und ist vom Rost arg mitge-
nommen, so dass Einzelheiten der Verschlusskon-
struktion nicht mehr erkennbar sind. Da jedoch die
Keil lochflächen parallel
sind, so ist anzunehmen,
dass hier zwei gegen
einander verschiebbare
Keile benutzt wurden,
um'den fast in seiner
ganzen Stärke durch-
brochenen Kolben fest-
zuhalten. Bei diesem
Rohr, das eine Seelen-
länge von 5,53 m hat
bei 15,8 cm Kaliber,
war die Hinterladung
geradezu notwendig, da
das Laden so langer
Rohre von der Mündung
aus recht schwierig war.
Diese Art der Hinterladung konnte nun unend-
lich variiert werden. Häufig machte man z. B. nur
das vordere Ende des Kolbens konisch und presste
es zur Erzielung einer besseren Liderung gegen einen
entsprechenden Uebergangskonus, oder aber man
machte den Keil sehr breit und steckte den Kolben,
der hinter dem Kopf mit einer Nute versehen war,
hindurch, während die Durchbohrung des Keils eine
entsprechende schmälere Verlängerung hatte, wie
bei einer Knopfgabel. Man brauchte alsdann zum
Schliessen und Oeffnen den Keil nur um wenige Centi-
meter zu verschieben u. s. w. Noch weit mannig-
faltiger waren die Konstruktionen, bei denen der
Kolben hinter dem Boden festgehalten wurde. So
liess man z. B. einen aufklappbaren Ueberwurf hinter
einen Bund des Kolbens greifen, oder man versah
das Bodenloch mit einer konischen Erweiterung und
presste, wie bei einer Abart des Schraubenver-
schlusses, nur das konische Ende des Kolbens hinein.
Solms bringt einen Hinterlader,*) der zu denjenigen
mit Kolbenverschlusse gerechnet werden muss, ob-
wohl der Kolben zu einer Thürklappe, die sich um
ein unter dem Bodenstück angebrachtes Scharnier
dreht, zusammengeschrumpft ist. Die grosse Zahl
derartiger Konstruktionen ist wohl weniger auf das
Bestreben, etwas Besseres zu erfinden, zurückzuführen,
als auf die Sucht der einzelnen Büchsenmeister,
durch Erfindung von etwas ganz Ausserordentlichem,
noch nie Dagewesenem für sich Reklame zu machen,
eine Sucht, die ja auch zu den abenteuerlichen Ge-
schützformen, den verschiedenen Orgelgeschützen etc.
geführt hat, die heute in den Sammlungen ange-
staunt werden.
5. Die Fallblockverschlüsse.
Eine geradezu elegant zu nennende Lösung der
Verschlussfrage stellen die älteren Fallblockver-
schlüsse dar, die wegen ihrer verblüffend einfachen,
zum «Geschwindschiessen» ganz besonders geeig-
neten Art der Bedienung in neuester Zeit als Gruson-
scher Schnellfeuerver-
schluss die Reihe der
modernen Schnellfeuer-
verschlüsse eröffneten.
Das Berliner Zeughaus
hat mehrere derartige
Rohre, von denen Fig. 13
eines wiedergiebt. Es
ist ebenfalls eine lange
eiserne Bockbüchse von
3,1 cm Kaliber. In einer
rechteckigen, überall
gleich weiten, senkrech-
ten Durchbrechung des
Bodenstücks lässt sich
ein genau passender
Fallblock mit Hilfe eines
Zahngetriebes, das in einem Kästchen unterhalb des
Bodenstücks untergebracht ist, heben und senken. Eine
Kurbelumdrehung genügt, den Verschluss zu schliessen
und zu öffnen. Zugleich enthält der Fallblock das
schräg geführte Zündloch und die Pfanne, welche
durch einen Deckel mit Schnappfeder geschützt
wird. Dieser Verschluss ist mit ganz unwesentlichen
Abweichungen an mehreren Rohren vorhanden. Auf
gleichem Prinzip beruhend, aber mit anderem Be-
Fig. 12 (1 : 5).
') Auch bei Essenwein, Quellen etc. S. A. CXXXII.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
II. Band.
den Boden zu drücken hatte. Der Kolben hat eine
senkrechte, rechteckige Durchbrechung, durch welche'
ein durch das Bodenstück des Rohres gehender
Keil greift und den Kolben festhält, bezw. die runde
Platte gegen den Boden presst. Etwas anders muss
der leider fehlende Verschluss eines bayrischen
Bronzerohres gewesen sein, das Fig. 12 wiedergiebt.
Hier ist die konische Ausdrehung für den Kolben
wesentlich weiter als die Seele und efidigt vorne in
einem scharfen Absatz, der vielleicht zur Aufnahme
eines lidernden Wergpolsters oder dergleichen ge-
dient haben mag, auch ist der Keil wesentlich stärker
gewesen und nur sehr schwach verjüngt. Bekannt
ist ferner das aus Braunschweig stammende riesige,
schmiedeeiserne Rohr, der «wilde Mann», vom Jahre
1586, auch dieses besitzt ein wagrechtes Keilloch.
Leider hat das hintere Ende des Rohres lange Jahre
in der Erde gesteckt und ist vom Rost arg mitge-
nommen, so dass Einzelheiten der Verschlusskon-
struktion nicht mehr erkennbar sind. Da jedoch die
Keil lochflächen parallel
sind, so ist anzunehmen,
dass hier zwei gegen
einander verschiebbare
Keile benutzt wurden,
um'den fast in seiner
ganzen Stärke durch-
brochenen Kolben fest-
zuhalten. Bei diesem
Rohr, das eine Seelen-
länge von 5,53 m hat
bei 15,8 cm Kaliber,
war die Hinterladung
geradezu notwendig, da
das Laden so langer
Rohre von der Mündung
aus recht schwierig war.
Diese Art der Hinterladung konnte nun unend-
lich variiert werden. Häufig machte man z. B. nur
das vordere Ende des Kolbens konisch und presste
es zur Erzielung einer besseren Liderung gegen einen
entsprechenden Uebergangskonus, oder aber man
machte den Keil sehr breit und steckte den Kolben,
der hinter dem Kopf mit einer Nute versehen war,
hindurch, während die Durchbohrung des Keils eine
entsprechende schmälere Verlängerung hatte, wie
bei einer Knopfgabel. Man brauchte alsdann zum
Schliessen und Oeffnen den Keil nur um wenige Centi-
meter zu verschieben u. s. w. Noch weit mannig-
faltiger waren die Konstruktionen, bei denen der
Kolben hinter dem Boden festgehalten wurde. So
liess man z. B. einen aufklappbaren Ueberwurf hinter
einen Bund des Kolbens greifen, oder man versah
das Bodenloch mit einer konischen Erweiterung und
presste, wie bei einer Abart des Schraubenver-
schlusses, nur das konische Ende des Kolbens hinein.
Solms bringt einen Hinterlader,*) der zu denjenigen
mit Kolbenverschlusse gerechnet werden muss, ob-
wohl der Kolben zu einer Thürklappe, die sich um
ein unter dem Bodenstück angebrachtes Scharnier
dreht, zusammengeschrumpft ist. Die grosse Zahl
derartiger Konstruktionen ist wohl weniger auf das
Bestreben, etwas Besseres zu erfinden, zurückzuführen,
als auf die Sucht der einzelnen Büchsenmeister,
durch Erfindung von etwas ganz Ausserordentlichem,
noch nie Dagewesenem für sich Reklame zu machen,
eine Sucht, die ja auch zu den abenteuerlichen Ge-
schützformen, den verschiedenen Orgelgeschützen etc.
geführt hat, die heute in den Sammlungen ange-
staunt werden.
5. Die Fallblockverschlüsse.
Eine geradezu elegant zu nennende Lösung der
Verschlussfrage stellen die älteren Fallblockver-
schlüsse dar, die wegen ihrer verblüffend einfachen,
zum «Geschwindschiessen» ganz besonders geeig-
neten Art der Bedienung in neuester Zeit als Gruson-
scher Schnellfeuerver-
schluss die Reihe der
modernen Schnellfeuer-
verschlüsse eröffneten.
Das Berliner Zeughaus
hat mehrere derartige
Rohre, von denen Fig. 13
eines wiedergiebt. Es
ist ebenfalls eine lange
eiserne Bockbüchse von
3,1 cm Kaliber. In einer
rechteckigen, überall
gleich weiten, senkrech-
ten Durchbrechung des
Bodenstücks lässt sich
ein genau passender
Fallblock mit Hilfe eines
Zahngetriebes, das in einem Kästchen unterhalb des
Bodenstücks untergebracht ist, heben und senken. Eine
Kurbelumdrehung genügt, den Verschluss zu schliessen
und zu öffnen. Zugleich enthält der Fallblock das
schräg geführte Zündloch und die Pfanne, welche
durch einen Deckel mit Schnappfeder geschützt
wird. Dieser Verschluss ist mit ganz unwesentlichen
Abweichungen an mehreren Rohren vorhanden. Auf
gleichem Prinzip beruhend, aber mit anderem Be-
Fig. 12 (1 : 5).
') Auch bei Essenwein, Quellen etc. S. A. CXXXII.