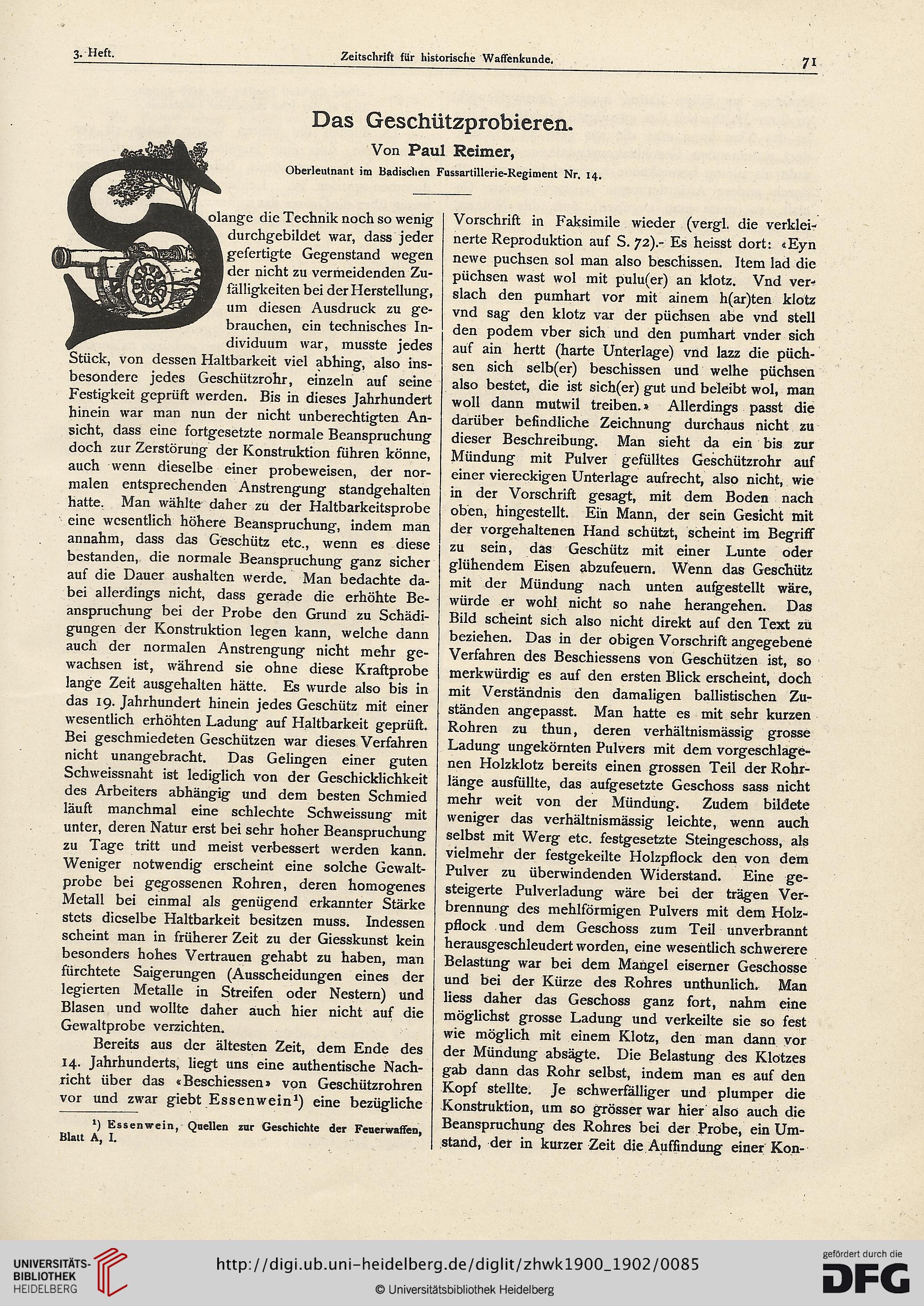3. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenfcunde.
71
Das Geschützprobieren.
Von Paul Reimer,
Oberleutnant im Badischen Fussartillerie-Regiment Nr. 14.
olange die Technik noch so wenig
durchgebildet war, dass jeder
gefertigte Gegenstand wegen
der nicht zu vermeidenden Zu-
fälligkeiten bei der Herstellung,
um diesen Ausdruck zu ge-
brauchen, ein technisches In-
dividuum war, musste jedes
Stück, von dessen Haltbarkeit viel abhing, also ins-
besondere jedes Geschützrohr, einzeln auf seine
Festigkeit geprüft werden. Bis in dieses Jahrhundert
hinein war man nun der nicht unberechtigten An-
sicht, dass eine fortgesetzte normale Beanspruchung
doch zur Zerstörung der Konstruktion führen könne,
auch wenn dieselbe einer probeweisen, der nor-
malen entsprechenden Anstrengung standgehalten
hatte. Man wählte daher zu der Haltbarkeitsprobe
eine wesentlich höhere Beanspruchung, indem man
annahm, dass das Geschütz etc., wenn es diese
bestanden, die normale Beanspruchung ganz sicher
auf die Dauer aushalten werde. Man bedachte da-
bei allerdings nicht, dass gerade die erhöhte Be-
anspruchung bei der Probe den Grund zu Schädi-
gungen der Konstruktion legen kann, welche dann
auch der normalen Anstrengung nicht mehr ge-
wachsen ist, während sie ohne diese Kraftprobe
lange Zeit ausgehalten hätte. Es wurde also bis in
das 19. Jahrhundert hinein jedes Geschütz mit einer
wesentlich erhöhten Ladung auf Haltbarkeit geprüft.
Bei geschmiedeten Geschützen war dieses Verfahren
nicht unangebracht. Das Gelingen einer guten
Schweissnaht ist lediglich von der Geschicklichkeit
des Arbeiters abhängig und dem besten Schmied
läuft manchmal eine schlechte Schweissung mit
unter, deren Natur erst bei sehr hoher Beanspruchung
zu Tage tritt und meist verbessert werden kann.
Weniger notwendig erscheint eine solche Gewalt-
probe bei gegossenen Rohren, deren homogenes
Metall bei einmal als genügend erkannter Stärke
stets dieselbe Haltbarkeit besitzen muss. Indessen
scheint man in früherer Zeit zu der Giesskunst kein
besonders hohes Vertrauen gehabt zu haben, man
fürchtete Saigerungen (Ausscheidungen eines der
legierten Metalle in Streifen oder Nestern) und
Blasen und wollte daher auch hier nicht auf die
Gewaltprobe verzichten.
Bereits aus der ältesten Zeit, dem Ende des
14. Jahrhunderts, liegt uns eine authentische Nach-
richt über das «Beschiessen» von Geschützrohren
vor und zwar giebt Essenwein1) eine bezügliche
l) Essenwein, Quellen zur Geschichte der Feuerwaffen,
Blatt A. 1.
Vorschrift in Faksimile wieder (vergl. die verklei-
nerte Reproduktion auf S. 72).- Es heisst dort: «Eyn
nevve puchsen sol man also beschissen. Item lad die
püchsen wast wol mit pulu(er) an klotz. Vnd ver-
slach den pumhart vor mit ainem h(ar)ten klotz
vnd sag den klotz var der püchsen abe vnd stell
den podem vber sich und den pumhart vnder sich
auf ain hertt (harte Unterlage) vnd lazz die püch-
sen sich selb(er) beschissen und weihe püchsen
also bestet, die ist sich(er) gut und beleibt wol, man
woll dann mutwil treiben.» Allerdings passt die
darüber befindliche Zeichnung durchaus nicht zu
dieser Beschreibung. Man sieht da ein bis zur
Mündung mit Pulver gefülltes Geschützrohr auf
einer viereckigen Unterlage aufrecht, also nicht, wie
in der Vorschrift gesagt, mit dem Boden nach
oben, hingestellt. Ein Mann, der sein Gesicht mit
der vorgehaltenen Hand schützt, scheint im Begriff
zu sein, das Geschütz mit einer Lunte oder
glühendem Eisen abzufeuern. Wenn das Geschütz
mit der Mündung nach unten aufgestellt wäre,
würde er wohl nicht so nahe herangehen. Das
Bild scheint sich also nicht direkt auf den Text zu
beziehen. Das in der obigen Vorschrift angegebene
Verfahren des Beschiessens von Geschützen ist, so
merkwürdig es auf den ersten Blick erscheint, doch
mit Verständnis den damaligen ballistischen Zu-
ständen angepasst. Man hatte es mit sehr kurzen
Rohren zu thun, deren verhältnismässig grosse
Ladung ungekörnten Pulvers mit dem vorgeschlage-
nen Holzklotz bereits einen grossen Teil der Rohr-
länge ausfüllte, das aufgesetzte Geschoss sass nicht
mehr weit von der Mündung. Zudem bildete
weniger das verhältnismässig leichte, wenn auch
selbst mit Werg etc. festgesetzte Steingeschoss, als
vielmehr der festgekeilte Holzpflock den von dem
Pulver zu überwindenden Widerstand. Eine ge-
steigerte Pulverladung wäre bei der trägen Ver-
brennung des mehlförmigen Pulvers mit dem Holz-
pflock und dem Geschoss zum Teil unverbrannt
herausgeschleudert worden, eine wesentlich schwerere
Belastung war bei dem Mangel eiserner Geschosse
und bei der Kürze des Rohres unthunlich. Man
liess daher das Geschoss ganz fort, nahm eine
möglichst grosse Ladung und verkeilte sie so fest
wie möglich mit einem Klotz, den man dann vor
der Mündung absägte. Die Belastung des Klotzes
gab dann das Rohr selbst, indem man es auf den
Kopf stellte. Je schwerfälliger und plumper die
Konstruktion, um so grösser war hier also auch die
Beanspruchung des Rohres bei der Probe, ein Um-
stand, der in kurzer Zeit die Auffindung einer Kon-
Zeitschrift für historische Waffenfcunde.
71
Das Geschützprobieren.
Von Paul Reimer,
Oberleutnant im Badischen Fussartillerie-Regiment Nr. 14.
olange die Technik noch so wenig
durchgebildet war, dass jeder
gefertigte Gegenstand wegen
der nicht zu vermeidenden Zu-
fälligkeiten bei der Herstellung,
um diesen Ausdruck zu ge-
brauchen, ein technisches In-
dividuum war, musste jedes
Stück, von dessen Haltbarkeit viel abhing, also ins-
besondere jedes Geschützrohr, einzeln auf seine
Festigkeit geprüft werden. Bis in dieses Jahrhundert
hinein war man nun der nicht unberechtigten An-
sicht, dass eine fortgesetzte normale Beanspruchung
doch zur Zerstörung der Konstruktion führen könne,
auch wenn dieselbe einer probeweisen, der nor-
malen entsprechenden Anstrengung standgehalten
hatte. Man wählte daher zu der Haltbarkeitsprobe
eine wesentlich höhere Beanspruchung, indem man
annahm, dass das Geschütz etc., wenn es diese
bestanden, die normale Beanspruchung ganz sicher
auf die Dauer aushalten werde. Man bedachte da-
bei allerdings nicht, dass gerade die erhöhte Be-
anspruchung bei der Probe den Grund zu Schädi-
gungen der Konstruktion legen kann, welche dann
auch der normalen Anstrengung nicht mehr ge-
wachsen ist, während sie ohne diese Kraftprobe
lange Zeit ausgehalten hätte. Es wurde also bis in
das 19. Jahrhundert hinein jedes Geschütz mit einer
wesentlich erhöhten Ladung auf Haltbarkeit geprüft.
Bei geschmiedeten Geschützen war dieses Verfahren
nicht unangebracht. Das Gelingen einer guten
Schweissnaht ist lediglich von der Geschicklichkeit
des Arbeiters abhängig und dem besten Schmied
läuft manchmal eine schlechte Schweissung mit
unter, deren Natur erst bei sehr hoher Beanspruchung
zu Tage tritt und meist verbessert werden kann.
Weniger notwendig erscheint eine solche Gewalt-
probe bei gegossenen Rohren, deren homogenes
Metall bei einmal als genügend erkannter Stärke
stets dieselbe Haltbarkeit besitzen muss. Indessen
scheint man in früherer Zeit zu der Giesskunst kein
besonders hohes Vertrauen gehabt zu haben, man
fürchtete Saigerungen (Ausscheidungen eines der
legierten Metalle in Streifen oder Nestern) und
Blasen und wollte daher auch hier nicht auf die
Gewaltprobe verzichten.
Bereits aus der ältesten Zeit, dem Ende des
14. Jahrhunderts, liegt uns eine authentische Nach-
richt über das «Beschiessen» von Geschützrohren
vor und zwar giebt Essenwein1) eine bezügliche
l) Essenwein, Quellen zur Geschichte der Feuerwaffen,
Blatt A. 1.
Vorschrift in Faksimile wieder (vergl. die verklei-
nerte Reproduktion auf S. 72).- Es heisst dort: «Eyn
nevve puchsen sol man also beschissen. Item lad die
püchsen wast wol mit pulu(er) an klotz. Vnd ver-
slach den pumhart vor mit ainem h(ar)ten klotz
vnd sag den klotz var der püchsen abe vnd stell
den podem vber sich und den pumhart vnder sich
auf ain hertt (harte Unterlage) vnd lazz die püch-
sen sich selb(er) beschissen und weihe püchsen
also bestet, die ist sich(er) gut und beleibt wol, man
woll dann mutwil treiben.» Allerdings passt die
darüber befindliche Zeichnung durchaus nicht zu
dieser Beschreibung. Man sieht da ein bis zur
Mündung mit Pulver gefülltes Geschützrohr auf
einer viereckigen Unterlage aufrecht, also nicht, wie
in der Vorschrift gesagt, mit dem Boden nach
oben, hingestellt. Ein Mann, der sein Gesicht mit
der vorgehaltenen Hand schützt, scheint im Begriff
zu sein, das Geschütz mit einer Lunte oder
glühendem Eisen abzufeuern. Wenn das Geschütz
mit der Mündung nach unten aufgestellt wäre,
würde er wohl nicht so nahe herangehen. Das
Bild scheint sich also nicht direkt auf den Text zu
beziehen. Das in der obigen Vorschrift angegebene
Verfahren des Beschiessens von Geschützen ist, so
merkwürdig es auf den ersten Blick erscheint, doch
mit Verständnis den damaligen ballistischen Zu-
ständen angepasst. Man hatte es mit sehr kurzen
Rohren zu thun, deren verhältnismässig grosse
Ladung ungekörnten Pulvers mit dem vorgeschlage-
nen Holzklotz bereits einen grossen Teil der Rohr-
länge ausfüllte, das aufgesetzte Geschoss sass nicht
mehr weit von der Mündung. Zudem bildete
weniger das verhältnismässig leichte, wenn auch
selbst mit Werg etc. festgesetzte Steingeschoss, als
vielmehr der festgekeilte Holzpflock den von dem
Pulver zu überwindenden Widerstand. Eine ge-
steigerte Pulverladung wäre bei der trägen Ver-
brennung des mehlförmigen Pulvers mit dem Holz-
pflock und dem Geschoss zum Teil unverbrannt
herausgeschleudert worden, eine wesentlich schwerere
Belastung war bei dem Mangel eiserner Geschosse
und bei der Kürze des Rohres unthunlich. Man
liess daher das Geschoss ganz fort, nahm eine
möglichst grosse Ladung und verkeilte sie so fest
wie möglich mit einem Klotz, den man dann vor
der Mündung absägte. Die Belastung des Klotzes
gab dann das Rohr selbst, indem man es auf den
Kopf stellte. Je schwerfälliger und plumper die
Konstruktion, um so grösser war hier also auch die
Beanspruchung des Rohres bei der Probe, ein Um-
stand, der in kurzer Zeit die Auffindung einer Kon-