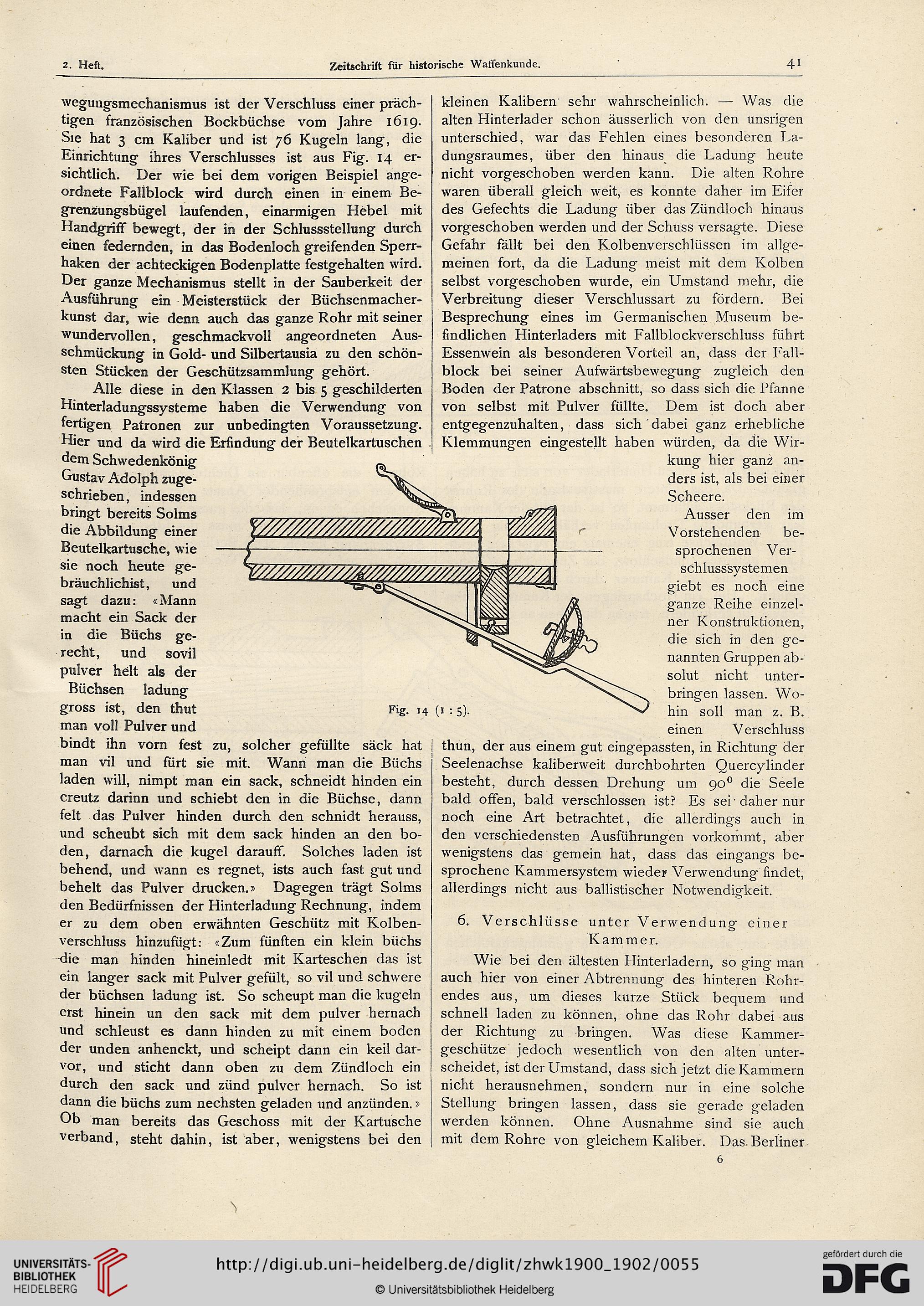2. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
41
wegungsmechanismus ist der Verschluss einer präch-
tigen französischen Bockbüchse vom Jahre 1619.
Sie hat 3 cm Kaliber und ist 76 Kugeln lang, die
Einrichtung ihres Verschlusses ist aus Fig. 14 er-
sichtlich. Der wie bei dem vorigen Beispiel ange-
ordnete Fallblock wird durch einen in einem Be-
grenzungsbügel laufenden, einarmigen Hebel mit
Handgriff bewegt, der in der Schlussstellung durch
einen federnden, in das Bodenloch greifenden Sperr-
haken der achteckigen Bodenplatte festgehalten wird.
Der ganze Mechanismus stellt in der Sauberkeit der
Ausführung ein Meisterstück der Büchsenmacher-
kunst dar, wie denn auch das ganze Rohr mit seiner
wundervollen, geschmackvoll angeordneten Aus-
schmückung in Gold- und Silbertausia zu den schön-
sten Stücken der Geschützsammlung gehört.
Alle diese in den Klassen 2 bis 5 geschilderten
Hinterladungssysteme haben die Verwendung von
fertigen Patronen zur unbedingten Voraussetzung.
Hier und da wird die Erfindung der Beutelkartuschen
dem Schwedenkönig
Gustav Adolph zuge-
schrieben , indessen
bringt bereits Solms
die Abbildung einer
Beutelkartusche, wie
sie noch heute ge-
bräuchlichist, und
sagt dazu: «Mann
macht ein Sack der
in die Büchs ge-
recht, und sovil
pulver heit als der
Büchsen ladung
gross ist, den thut
man voll Pulver und
bindt ihn vorn fest zu, solcher gefüllte säck hat
man vil und fürt sie mit. Wann man die Büchs
laden will, nimpt man ein sack, schneidt hinden ein
creutz darinn und schiebt den in die Büchse, dann
feit das Pulver hinden durch den schnidt herauss,
und scheubt sich mit dem sack hinden an den bo-
den, darnach die kugel darauff. Solches laden ist
behend, und wann es regnet, ists auch fast gut und
behelt das Pulver drucken.» Dagegen trägt Solms
den Bedürfnissen der Hinterladung Rechnung, indem
er zu dem oben erwähnten Geschütz mit Kolben-
verschluss hinzufügt: «Zum fünften ein klein büchs
die man hinden hineinledt mit Karteschen das ist
ein langer sack mit Pulver gefült, so vil und schwere
der büchsen ladung ist. So scheupt man die kugeln
erst hinein un den sack mit dem pulver hernach
und schleust es dann hinden zu mit einem boden
der unden anhenckt, und scheipt dann ein keil dar-
vor, und sticht dann oben zu dem Zündloch ein
durch den sack und zünd pulver hernach. So ist
dann die büchs zum nechsten geladen und anzünden.»
Ob man bereits das Geschoss mit der Kartusche
verband, steht dahin, ist aber, wenigstens bei den
kleinen Kalibern sehr wahrscheinlich. — Was die
alten Hinterlader schon äusserlich von den unsrigen
unterschied, war das Fehlen eines besonderen La-
dungsraumes, über den hinaus die Ladung heute
nicht vorgeschoben werden kann. Die alten Rohre
waren überall gleich weit, es konnte daher im Eifer
des Gefechts die Ladung über das Zündloch hinaus
vorgeschoben werden und der Schuss versagte. Diese
Gefahr fällt bei den Kolbenverschlüssen im allge-
meinen fort, da die Ladung meist mit dem Kolben
selbst vorgeschoben wurde, ein Umstand mehr, die
Verbreitung dieser Verschlussart zu fördern. Bei
Besprechung eines im Germanischen Museum be-
findlichen Hinterladers mit Fallblockverschluss führt
Essenwein als besonderen Vorteil an, dass der Fall-
block bei seiner Aufwärtsbewegung zugleich den
Boden der Patrone abschnitt, so dass sich die Pfanne
von selbst mit Pulver füllte. Dem ist doch aber
entgegenzuhalten, dass sich dabei ganz erhebliche
Klemmungen eingestellt haben würden, da die Wir-
kung hier ganz an-
ders ist, als bei einer
Scheere.
Ausser den im
Vorstehenden be-
sprochenen V er-
schlusssystemen
giebt es noch eine
ganze Reihe einzel-
ner Konstruktionen,
die sich in den ge-
nannten Gruppen ab-
solut nicht unter-
bringen lassen. Wo-
hin soll man z. B.
einen Verschluss
thun, der aus einem gut eingepassten, in Richtung der
Seelenachse kaliberweit durchbohrten Quercylinder
besteht, durch dessen Drehung um 90° die Seele
bald offen, bald verschlossen ist? Es sei daher nur
noch eine Art betrachtet, die allerdings auch in
den verschiedensten Ausführungen vorkommt, aber
wenigstens das gemein hat, dass das eingangs be-
sprochene Kammersystem wieder Verwendung findet,
allerdings nicht aus ballistischer Notwendigkeit.
6. Verschlüsse unter Verwendung einer
Kammer.
Wie bei den ältesten Hinterladern, so ging man
auch hier von einer Abtrennung des hinteren Rohr-
endes aus, um dieses kurze Stück bequem und
schnell laden zu können, ohne das Rohr dabei aus
der Richtung zu bringen. Was diese Kammer-
geschütze jedoch wesentlich von den alten unter-
scheidet, ist der Umstand, dass sich jetzt die Kammern
nicht herausnehmen, sondern nur in eine solche
Stellung bringen lassen, dass sie gerade geladen
werden können. Ohne Ausnahme sind sie auch
mit dem Rohre von gleichem Kaliber. Das. Berliner
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
41
wegungsmechanismus ist der Verschluss einer präch-
tigen französischen Bockbüchse vom Jahre 1619.
Sie hat 3 cm Kaliber und ist 76 Kugeln lang, die
Einrichtung ihres Verschlusses ist aus Fig. 14 er-
sichtlich. Der wie bei dem vorigen Beispiel ange-
ordnete Fallblock wird durch einen in einem Be-
grenzungsbügel laufenden, einarmigen Hebel mit
Handgriff bewegt, der in der Schlussstellung durch
einen federnden, in das Bodenloch greifenden Sperr-
haken der achteckigen Bodenplatte festgehalten wird.
Der ganze Mechanismus stellt in der Sauberkeit der
Ausführung ein Meisterstück der Büchsenmacher-
kunst dar, wie denn auch das ganze Rohr mit seiner
wundervollen, geschmackvoll angeordneten Aus-
schmückung in Gold- und Silbertausia zu den schön-
sten Stücken der Geschützsammlung gehört.
Alle diese in den Klassen 2 bis 5 geschilderten
Hinterladungssysteme haben die Verwendung von
fertigen Patronen zur unbedingten Voraussetzung.
Hier und da wird die Erfindung der Beutelkartuschen
dem Schwedenkönig
Gustav Adolph zuge-
schrieben , indessen
bringt bereits Solms
die Abbildung einer
Beutelkartusche, wie
sie noch heute ge-
bräuchlichist, und
sagt dazu: «Mann
macht ein Sack der
in die Büchs ge-
recht, und sovil
pulver heit als der
Büchsen ladung
gross ist, den thut
man voll Pulver und
bindt ihn vorn fest zu, solcher gefüllte säck hat
man vil und fürt sie mit. Wann man die Büchs
laden will, nimpt man ein sack, schneidt hinden ein
creutz darinn und schiebt den in die Büchse, dann
feit das Pulver hinden durch den schnidt herauss,
und scheubt sich mit dem sack hinden an den bo-
den, darnach die kugel darauff. Solches laden ist
behend, und wann es regnet, ists auch fast gut und
behelt das Pulver drucken.» Dagegen trägt Solms
den Bedürfnissen der Hinterladung Rechnung, indem
er zu dem oben erwähnten Geschütz mit Kolben-
verschluss hinzufügt: «Zum fünften ein klein büchs
die man hinden hineinledt mit Karteschen das ist
ein langer sack mit Pulver gefült, so vil und schwere
der büchsen ladung ist. So scheupt man die kugeln
erst hinein un den sack mit dem pulver hernach
und schleust es dann hinden zu mit einem boden
der unden anhenckt, und scheipt dann ein keil dar-
vor, und sticht dann oben zu dem Zündloch ein
durch den sack und zünd pulver hernach. So ist
dann die büchs zum nechsten geladen und anzünden.»
Ob man bereits das Geschoss mit der Kartusche
verband, steht dahin, ist aber, wenigstens bei den
kleinen Kalibern sehr wahrscheinlich. — Was die
alten Hinterlader schon äusserlich von den unsrigen
unterschied, war das Fehlen eines besonderen La-
dungsraumes, über den hinaus die Ladung heute
nicht vorgeschoben werden kann. Die alten Rohre
waren überall gleich weit, es konnte daher im Eifer
des Gefechts die Ladung über das Zündloch hinaus
vorgeschoben werden und der Schuss versagte. Diese
Gefahr fällt bei den Kolbenverschlüssen im allge-
meinen fort, da die Ladung meist mit dem Kolben
selbst vorgeschoben wurde, ein Umstand mehr, die
Verbreitung dieser Verschlussart zu fördern. Bei
Besprechung eines im Germanischen Museum be-
findlichen Hinterladers mit Fallblockverschluss führt
Essenwein als besonderen Vorteil an, dass der Fall-
block bei seiner Aufwärtsbewegung zugleich den
Boden der Patrone abschnitt, so dass sich die Pfanne
von selbst mit Pulver füllte. Dem ist doch aber
entgegenzuhalten, dass sich dabei ganz erhebliche
Klemmungen eingestellt haben würden, da die Wir-
kung hier ganz an-
ders ist, als bei einer
Scheere.
Ausser den im
Vorstehenden be-
sprochenen V er-
schlusssystemen
giebt es noch eine
ganze Reihe einzel-
ner Konstruktionen,
die sich in den ge-
nannten Gruppen ab-
solut nicht unter-
bringen lassen. Wo-
hin soll man z. B.
einen Verschluss
thun, der aus einem gut eingepassten, in Richtung der
Seelenachse kaliberweit durchbohrten Quercylinder
besteht, durch dessen Drehung um 90° die Seele
bald offen, bald verschlossen ist? Es sei daher nur
noch eine Art betrachtet, die allerdings auch in
den verschiedensten Ausführungen vorkommt, aber
wenigstens das gemein hat, dass das eingangs be-
sprochene Kammersystem wieder Verwendung findet,
allerdings nicht aus ballistischer Notwendigkeit.
6. Verschlüsse unter Verwendung einer
Kammer.
Wie bei den ältesten Hinterladern, so ging man
auch hier von einer Abtrennung des hinteren Rohr-
endes aus, um dieses kurze Stück bequem und
schnell laden zu können, ohne das Rohr dabei aus
der Richtung zu bringen. Was diese Kammer-
geschütze jedoch wesentlich von den alten unter-
scheidet, ist der Umstand, dass sich jetzt die Kammern
nicht herausnehmen, sondern nur in eine solche
Stellung bringen lassen, dass sie gerade geladen
werden können. Ohne Ausnahme sind sie auch
mit dem Rohre von gleichem Kaliber. Das. Berliner