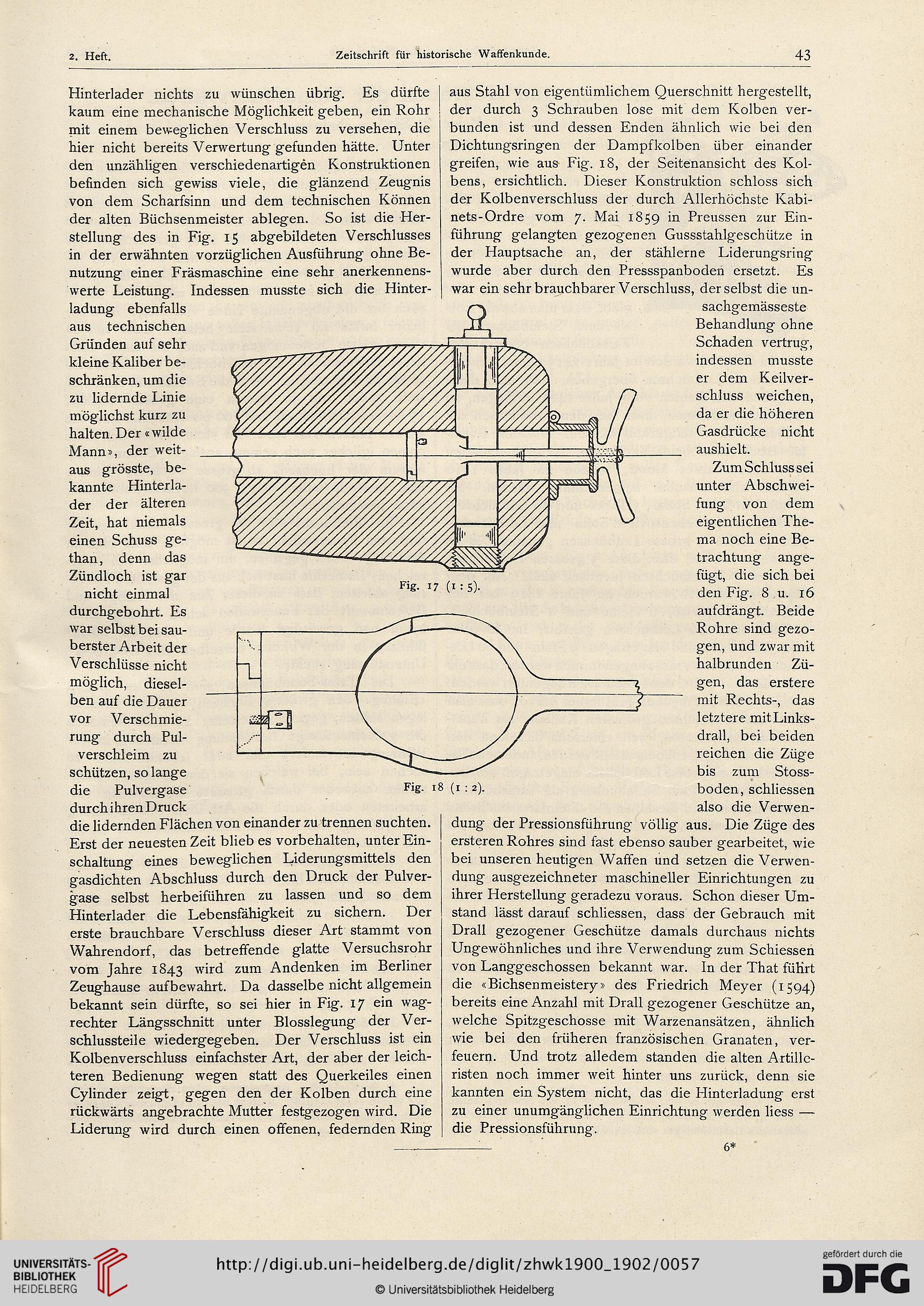2. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
43
Fig. 17 (1 : 5).
Hinterlader nichts zu wünschen übrig. Es dürfte
kaum eine mechanische Möglichkeit geben, ein Rohr
mit einem beweglichen Verschluss zu versehen, die
hier nicht bereits Verwertung gefunden hätte. Unter
den unzähligen verschiedenartigen Konstruktionen
befinden sich gewiss viele, die glänzend Zeugnis
von dem Scharfsinn und dem technischen Können
der alten Büchsenmeister ablegen. So ist die Her-
stellung des in Fig. 15 abgebildeten Verschlusses
in der erwähnten vorzüglichen Ausführung ohne Be-
nutzung einer Fräsmaschine eine sehr anerkennens-
werte Leistung. Indessen musste sich die Hinter-
ladung ebenfalls
aus technischen
Gründen auf sehr
kleine Kaliber be-
schränken, um die
zu lidernde Linie
mög'lichst kurz zu
halten. Der«wilde
Mann», der weit-
aus grösste, be-
kannte Hinterla-
der der älteren
Zeit, hat niemals
einen Schuss ge-
than, denn das
Zündloch ist gar
nicht einmal
durchgebohrt. Es
war selbst bei sau-
berster Arbeit der
Verschlüsse nicht
möglich, diesel-
ben auf die Dauer
vor Verschmie-
rung durch Pul-
verschleim zu
schützen, so lange
die Pulvergase Fig. 18
durchihren Druck
die lidernden Flächen von einander zu trennen suchten.
Erst der neuesten Zeit blieb es Vorbehalten, unter Ein-
schaltung eines beweglichen Liderungsmittels den
gasdichten Abschluss durch den Druck der Pulver-
gase selbst herbeiführen zu lassen und so dem
Hinterlader die Lebensfähigkeit zu sichern. Der
erste brauchbare Verschluss dieser Art stammt von
Wahrendorf, das betreffende glatte Versuchsrohr
vom Jahre 1843 wird zum Andenken im Berliner
Zeughause aufbewahrt. Da dasselbe nicht allgemein
bekannt sein dürfte, so sei hier in Fig. 17 ein wag-
rechter Längsschnitt unter Blosslegung der Ver-
schlussteile wiedergegeben. Der Verschluss ist ein
Kolbenverschluss einfachster Art, der aber der leich-
teren Bedienung wegen statt des Querkeiles einen
Cylinder zeigt, gegen den der Kolben durch eine
rückwärts angebrachte Mutter festgezogen wird. Die
Liderung wird durch einen offenen, federnden Ring
aus Stahl von eigentümlichem Querschnitt hergestellt,
der durch 3 Schrauben lose mit dem Kolben ver-
bunden ist und dessen Enden ähnlich wie bei den
Dichtungsringen der Dampfkolben über einander
greifen, wie aus Fig. 18, der Seitenansicht des Kol-
bens, ersichtlich. Dieser Konstruktion schloss sich
der Kolbenverschluss der durch Allerhöchste Kabi-
nets-Ordre vom 7. Mai 1859 m Preussen zur Ein-
führung gelangten gezogenen Gussstahlgeschütze in
der Hauptsache an, der stählerne Liderungsring
wurde aber durch den Pressspanboden ersetzt. Es
war ein sehr brauchbarer Verschluss, der selbst die un-
sachgemässeste
Behandlung ohne
Schaden vertrug,
indessen musste
er dem Keilver-
schluss weichen,
da er die höheren
Gasdrücke nicht
aushielt.
Zum Schluss sei
unter Abschwei-
fung von dem
eigentlichen The-
ma noch eine Be-
trachtung ange-
fügt, die sich bei
den Fig. 8 u. 16
aufdrängt. Beide
Rohre sind gezo-
gen, und zwar mit
halbrunden Zü-
gen, das erstere
mit Rechts-, das
letztere mit Links-
drall, bei beiden
reichen die Züge
bis zum Stoss-
(* : 2)- boden, schliessen
also die Verwen-
dung der Pressionsführung völlig' aus. Die Züge des
ersteren Rohres sind fast ebenso sauber gearbeitet, wie
bei unseren heutigen Waffen und setzen die Verwen-
dung ausgezeichneter maschineller Einrichtungen zu
ihrer Herstellung geradezu voraus. Schon dieser Um-
stand lässt darauf schliessen, dass der Gebrauch mit
Drall gezogener Geschütze damals durchaus nichts
Ungewöhnliches und ihre Verwendung zum Schiessen
von Langgeschossen bekannt war. In der That führt
die «Bichsenmeistery» des Friedrich Meyer (1594)
bereits eine Anzahl mit Drall gezogener Geschütze an,
welche Spitzgeschosse mit Warzenansätzen, ähnlich
wie bei den früheren französischen Granaten, ver-
feuern. Und trotz alledem standen die alten Artille-
risten noch immer weit hinter uns zurück, denn sie
kannten ein System nicht, das die Hinterladung erst
zu einer unumgänglichen Einrichtung werden liess —
die Pressionsführung.
T.
1
r T ^
2 -
6*
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
43
Fig. 17 (1 : 5).
Hinterlader nichts zu wünschen übrig. Es dürfte
kaum eine mechanische Möglichkeit geben, ein Rohr
mit einem beweglichen Verschluss zu versehen, die
hier nicht bereits Verwertung gefunden hätte. Unter
den unzähligen verschiedenartigen Konstruktionen
befinden sich gewiss viele, die glänzend Zeugnis
von dem Scharfsinn und dem technischen Können
der alten Büchsenmeister ablegen. So ist die Her-
stellung des in Fig. 15 abgebildeten Verschlusses
in der erwähnten vorzüglichen Ausführung ohne Be-
nutzung einer Fräsmaschine eine sehr anerkennens-
werte Leistung. Indessen musste sich die Hinter-
ladung ebenfalls
aus technischen
Gründen auf sehr
kleine Kaliber be-
schränken, um die
zu lidernde Linie
mög'lichst kurz zu
halten. Der«wilde
Mann», der weit-
aus grösste, be-
kannte Hinterla-
der der älteren
Zeit, hat niemals
einen Schuss ge-
than, denn das
Zündloch ist gar
nicht einmal
durchgebohrt. Es
war selbst bei sau-
berster Arbeit der
Verschlüsse nicht
möglich, diesel-
ben auf die Dauer
vor Verschmie-
rung durch Pul-
verschleim zu
schützen, so lange
die Pulvergase Fig. 18
durchihren Druck
die lidernden Flächen von einander zu trennen suchten.
Erst der neuesten Zeit blieb es Vorbehalten, unter Ein-
schaltung eines beweglichen Liderungsmittels den
gasdichten Abschluss durch den Druck der Pulver-
gase selbst herbeiführen zu lassen und so dem
Hinterlader die Lebensfähigkeit zu sichern. Der
erste brauchbare Verschluss dieser Art stammt von
Wahrendorf, das betreffende glatte Versuchsrohr
vom Jahre 1843 wird zum Andenken im Berliner
Zeughause aufbewahrt. Da dasselbe nicht allgemein
bekannt sein dürfte, so sei hier in Fig. 17 ein wag-
rechter Längsschnitt unter Blosslegung der Ver-
schlussteile wiedergegeben. Der Verschluss ist ein
Kolbenverschluss einfachster Art, der aber der leich-
teren Bedienung wegen statt des Querkeiles einen
Cylinder zeigt, gegen den der Kolben durch eine
rückwärts angebrachte Mutter festgezogen wird. Die
Liderung wird durch einen offenen, federnden Ring
aus Stahl von eigentümlichem Querschnitt hergestellt,
der durch 3 Schrauben lose mit dem Kolben ver-
bunden ist und dessen Enden ähnlich wie bei den
Dichtungsringen der Dampfkolben über einander
greifen, wie aus Fig. 18, der Seitenansicht des Kol-
bens, ersichtlich. Dieser Konstruktion schloss sich
der Kolbenverschluss der durch Allerhöchste Kabi-
nets-Ordre vom 7. Mai 1859 m Preussen zur Ein-
führung gelangten gezogenen Gussstahlgeschütze in
der Hauptsache an, der stählerne Liderungsring
wurde aber durch den Pressspanboden ersetzt. Es
war ein sehr brauchbarer Verschluss, der selbst die un-
sachgemässeste
Behandlung ohne
Schaden vertrug,
indessen musste
er dem Keilver-
schluss weichen,
da er die höheren
Gasdrücke nicht
aushielt.
Zum Schluss sei
unter Abschwei-
fung von dem
eigentlichen The-
ma noch eine Be-
trachtung ange-
fügt, die sich bei
den Fig. 8 u. 16
aufdrängt. Beide
Rohre sind gezo-
gen, und zwar mit
halbrunden Zü-
gen, das erstere
mit Rechts-, das
letztere mit Links-
drall, bei beiden
reichen die Züge
bis zum Stoss-
(* : 2)- boden, schliessen
also die Verwen-
dung der Pressionsführung völlig' aus. Die Züge des
ersteren Rohres sind fast ebenso sauber gearbeitet, wie
bei unseren heutigen Waffen und setzen die Verwen-
dung ausgezeichneter maschineller Einrichtungen zu
ihrer Herstellung geradezu voraus. Schon dieser Um-
stand lässt darauf schliessen, dass der Gebrauch mit
Drall gezogener Geschütze damals durchaus nichts
Ungewöhnliches und ihre Verwendung zum Schiessen
von Langgeschossen bekannt war. In der That führt
die «Bichsenmeistery» des Friedrich Meyer (1594)
bereits eine Anzahl mit Drall gezogener Geschütze an,
welche Spitzgeschosse mit Warzenansätzen, ähnlich
wie bei den früheren französischen Granaten, ver-
feuern. Und trotz alledem standen die alten Artille-
risten noch immer weit hinter uns zurück, denn sie
kannten ein System nicht, das die Hinterladung erst
zu einer unumgänglichen Einrichtung werden liess —
die Pressionsführung.
T.
1
r T ^
2 -
6*