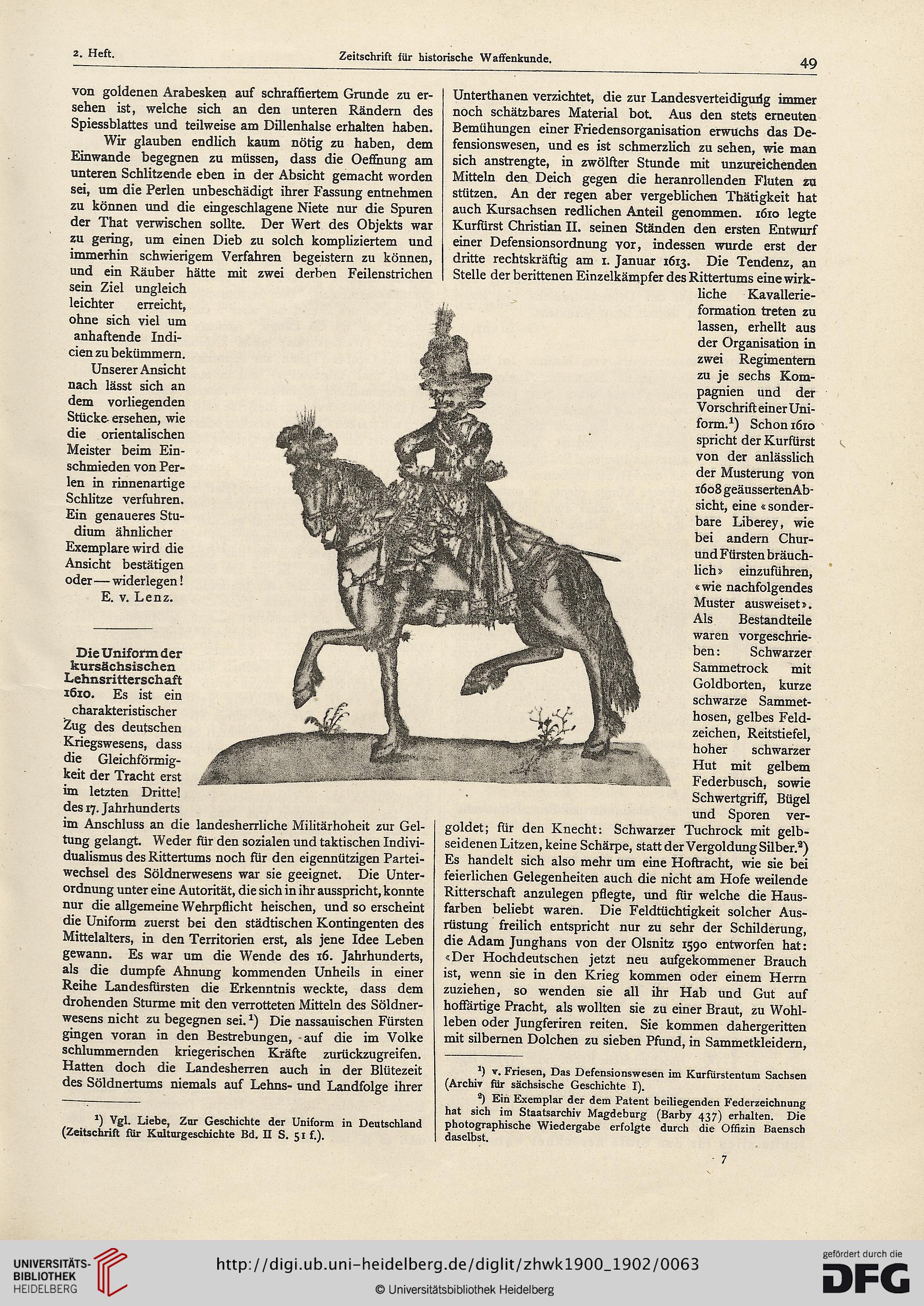2. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
49
von goldenen Arabesken auf schraffiertem Grunde zu er-
sehen ist, welche sich an den unteren Rändern des
Spiessblattes und teilweise am Dillenhalse erhalten haben.
Wir glauben endlich kaum nötig zu haben, dem
Einwande begegnen zu müssen, dass die Oefinung am
unteren Schlitzende eben in der Absicht gemacht worden
sei, um die Perlen unbeschädigt ihrer Fassung entnehmen
zu können und die eingeschlagene Niete nur die Spuren
der That verwischen sollte. Der Wert des Objekts war
zu gering, um einen Dieb zu solch kompliziertem und
immerhin schwierigem Verfahren begeistern zu können,
und ein Räuber hätte mit zwei derben Feilenstrichen
sein Ziel ungleich
leichter erreicht,
ohne sich viel um
anhaftende Indi-
cien zu bekümmern.
Unserer Ansicht
nach lässt sich an
dem vorliegenden
Stücke- ersehen, wie
die orientalischen
Meister beim Ein-
schmieden von Per-
len in rinnenartige
Schlitze verfuhren.
Ein genaueres Stu-
dium ähnlicher
Exemplare wird die
Ansicht bestätigen
oder— widerlegen!
E. v. Lenz.
Die Uniform der
kursächsischen
Lehnsritterschaft
1610. Es ist ein
charakteristischer
Zug des deutschen
Kriegswesens, dass
die Gleichförmig-
keit der Tracht erst
im letzten Dritte!
des 17. Jahrhunderts
im Anschluss an die landesherrliche Militärhoheit zur Gel-
tung gelangt. Weder für den sozialen und taktischen Indivi-
dualismus des Rittertums noch für den eigennützigen Partei-
wechsel des Söldnerwesens war sie geeignet. Die Unter-
ordnung unter eine Autorität, die sich in ihr ausspricht, konnte
nur die allgemeine Wehrpflicht heischen, und so erscheint
die Uniform zuerst bei den städtischen Kontingenten des
Mittelalters, in den Territorien erst, als jene Idee Leben
gewann. Es war um die Wende des 16. Jahrhunderts,
als die dumpfe Ahnung kommenden Unheils in einer
Reihe Landesfürsten die Erkenntnis weckte, dass dem
drohenden Sturme mit den verrotteten Mitteln des Söldner-
wesens nicht zu begegnen sei.1) Die nassauischen Fürsten
gingen voran in den Bestrebungen, auf die im Volke
schlummernden kriegerischen Kräfte zurückzugreifen.
Hatten doch die Landesherren auch in der Blütezeit
des Söldnertums niemals auf Lehns- und Landfolge ihrer
*) Vgl. Liebe, Zur Geschichte der Uniform in Deutschland
(Zeitschrift für Kulturgeschichte Bd. II S. 51 f.).
Unterthanen verzichtet, die zur Landesverteidigung immer
noch schätzbares Material bot. Aus den stets erneuten
Bemühungen einer Friedensorganisation erwuchs das De-
fensionswesen, und es ist schmerzlich zu sehen, wie man
sich anstrengte, in zwölfter Stunde mit unzureichenden
Mitteln den Deich gegen die heranrollenden Fluten zu
stützen. An der regen aber vergeblichen Thätigkeit hat
auch Kursachsen redlichen Anteil genommen. 1610 legte
Kurfürst Christian II. seinen Ständen den ersten Entwurf
einer Defensionsordnung vor, indessen wurde erst der
dritte rechtskräftig am 1. Januar 1613. Die Tendenz, an
Stelle der berittenen Einzelkämpfer des Rittertums eine wirk-
liche Kavallerie-
formation treten zu
lassen, erhellt aus
der Organisation in
zwei Regimentern
zu je sechs Kom-
pagnien und der
Vorschrift einer Uni-
form.1) Schon 1610
spricht der Kurfürst
von der anlässlich
der Musterung von
1608 geäussertenAb-
sicht, eine « sonder-
bare Liberey, wie
bei andern Chur-
und Fürsten bräuch-
lich» einzuführen,
«wie nachfolgendes
Muster ausweiset».
Als Bestandteile
waren vorgeschrie-
ben : Schwarzer
Sammetrock mit
Goldborten, kurze
schwarze Sammet-
hosen, gelbes Feld-
zeichen, Reitstiefel,
hoher schwarzer
Hut mit gelbem
Federbusch, sowie
Schwertgriff, Bügel
und Sporen ver-
goldet; für den Knecht: Schwarzer Tuchrock mit gelb-
seidenen Litzen, keine Schärpe, statt der Vergoldung Silber.2)
Es handelt sich also mehr um eine Hoftracht, wie sie bei
feierlichen Gelegenheiten auch die nicht am Hofe weilende
Ritterschaft anzulegen pflegte, und für welche die Haus-
farben beliebt waren. Die Feldtüchtigkeit solcher Aus-
rüstung freilich entspricht nur zu sehr der Schilderung,
die Adam Junghans von der Olsnitz 1590 entworfen hat:
«Der Hochdeutschen jetzt neu aufgekommener Brauch
ist, wenn sie in den Krieg kommen oder einem Herrn
zuziehen, so wenden sie all ihr Hab und Gut auf
hoflartige Pracht, als wollten sie zu einer Braut, zu Wohl-
leben oder Jungferiren reiten. Sie kommen dahergeritten
mit silbernen Dolchen zu sieben Pfund, in Sammetkleidem,
1) v. Friesen, Das Defensionswesen im Kurfürstentum Sachsen
(Archiv für sächsische Geschichte I).
^ Ein Exemplar der dem Patent beiliegenden Federzeichnung
hat sich im Staatsarchiv Magdeburg (Barby 437) erhalten. Die
photographische Wiedergabe erfolgte durch die Offizin Baensch
daselbst.
■ 7
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
49
von goldenen Arabesken auf schraffiertem Grunde zu er-
sehen ist, welche sich an den unteren Rändern des
Spiessblattes und teilweise am Dillenhalse erhalten haben.
Wir glauben endlich kaum nötig zu haben, dem
Einwande begegnen zu müssen, dass die Oefinung am
unteren Schlitzende eben in der Absicht gemacht worden
sei, um die Perlen unbeschädigt ihrer Fassung entnehmen
zu können und die eingeschlagene Niete nur die Spuren
der That verwischen sollte. Der Wert des Objekts war
zu gering, um einen Dieb zu solch kompliziertem und
immerhin schwierigem Verfahren begeistern zu können,
und ein Räuber hätte mit zwei derben Feilenstrichen
sein Ziel ungleich
leichter erreicht,
ohne sich viel um
anhaftende Indi-
cien zu bekümmern.
Unserer Ansicht
nach lässt sich an
dem vorliegenden
Stücke- ersehen, wie
die orientalischen
Meister beim Ein-
schmieden von Per-
len in rinnenartige
Schlitze verfuhren.
Ein genaueres Stu-
dium ähnlicher
Exemplare wird die
Ansicht bestätigen
oder— widerlegen!
E. v. Lenz.
Die Uniform der
kursächsischen
Lehnsritterschaft
1610. Es ist ein
charakteristischer
Zug des deutschen
Kriegswesens, dass
die Gleichförmig-
keit der Tracht erst
im letzten Dritte!
des 17. Jahrhunderts
im Anschluss an die landesherrliche Militärhoheit zur Gel-
tung gelangt. Weder für den sozialen und taktischen Indivi-
dualismus des Rittertums noch für den eigennützigen Partei-
wechsel des Söldnerwesens war sie geeignet. Die Unter-
ordnung unter eine Autorität, die sich in ihr ausspricht, konnte
nur die allgemeine Wehrpflicht heischen, und so erscheint
die Uniform zuerst bei den städtischen Kontingenten des
Mittelalters, in den Territorien erst, als jene Idee Leben
gewann. Es war um die Wende des 16. Jahrhunderts,
als die dumpfe Ahnung kommenden Unheils in einer
Reihe Landesfürsten die Erkenntnis weckte, dass dem
drohenden Sturme mit den verrotteten Mitteln des Söldner-
wesens nicht zu begegnen sei.1) Die nassauischen Fürsten
gingen voran in den Bestrebungen, auf die im Volke
schlummernden kriegerischen Kräfte zurückzugreifen.
Hatten doch die Landesherren auch in der Blütezeit
des Söldnertums niemals auf Lehns- und Landfolge ihrer
*) Vgl. Liebe, Zur Geschichte der Uniform in Deutschland
(Zeitschrift für Kulturgeschichte Bd. II S. 51 f.).
Unterthanen verzichtet, die zur Landesverteidigung immer
noch schätzbares Material bot. Aus den stets erneuten
Bemühungen einer Friedensorganisation erwuchs das De-
fensionswesen, und es ist schmerzlich zu sehen, wie man
sich anstrengte, in zwölfter Stunde mit unzureichenden
Mitteln den Deich gegen die heranrollenden Fluten zu
stützen. An der regen aber vergeblichen Thätigkeit hat
auch Kursachsen redlichen Anteil genommen. 1610 legte
Kurfürst Christian II. seinen Ständen den ersten Entwurf
einer Defensionsordnung vor, indessen wurde erst der
dritte rechtskräftig am 1. Januar 1613. Die Tendenz, an
Stelle der berittenen Einzelkämpfer des Rittertums eine wirk-
liche Kavallerie-
formation treten zu
lassen, erhellt aus
der Organisation in
zwei Regimentern
zu je sechs Kom-
pagnien und der
Vorschrift einer Uni-
form.1) Schon 1610
spricht der Kurfürst
von der anlässlich
der Musterung von
1608 geäussertenAb-
sicht, eine « sonder-
bare Liberey, wie
bei andern Chur-
und Fürsten bräuch-
lich» einzuführen,
«wie nachfolgendes
Muster ausweiset».
Als Bestandteile
waren vorgeschrie-
ben : Schwarzer
Sammetrock mit
Goldborten, kurze
schwarze Sammet-
hosen, gelbes Feld-
zeichen, Reitstiefel,
hoher schwarzer
Hut mit gelbem
Federbusch, sowie
Schwertgriff, Bügel
und Sporen ver-
goldet; für den Knecht: Schwarzer Tuchrock mit gelb-
seidenen Litzen, keine Schärpe, statt der Vergoldung Silber.2)
Es handelt sich also mehr um eine Hoftracht, wie sie bei
feierlichen Gelegenheiten auch die nicht am Hofe weilende
Ritterschaft anzulegen pflegte, und für welche die Haus-
farben beliebt waren. Die Feldtüchtigkeit solcher Aus-
rüstung freilich entspricht nur zu sehr der Schilderung,
die Adam Junghans von der Olsnitz 1590 entworfen hat:
«Der Hochdeutschen jetzt neu aufgekommener Brauch
ist, wenn sie in den Krieg kommen oder einem Herrn
zuziehen, so wenden sie all ihr Hab und Gut auf
hoflartige Pracht, als wollten sie zu einer Braut, zu Wohl-
leben oder Jungferiren reiten. Sie kommen dahergeritten
mit silbernen Dolchen zu sieben Pfund, in Sammetkleidem,
1) v. Friesen, Das Defensionswesen im Kurfürstentum Sachsen
(Archiv für sächsische Geschichte I).
^ Ein Exemplar der dem Patent beiliegenden Federzeichnung
hat sich im Staatsarchiv Magdeburg (Barby 437) erhalten. Die
photographische Wiedergabe erfolgte durch die Offizin Baensch
daselbst.
■ 7