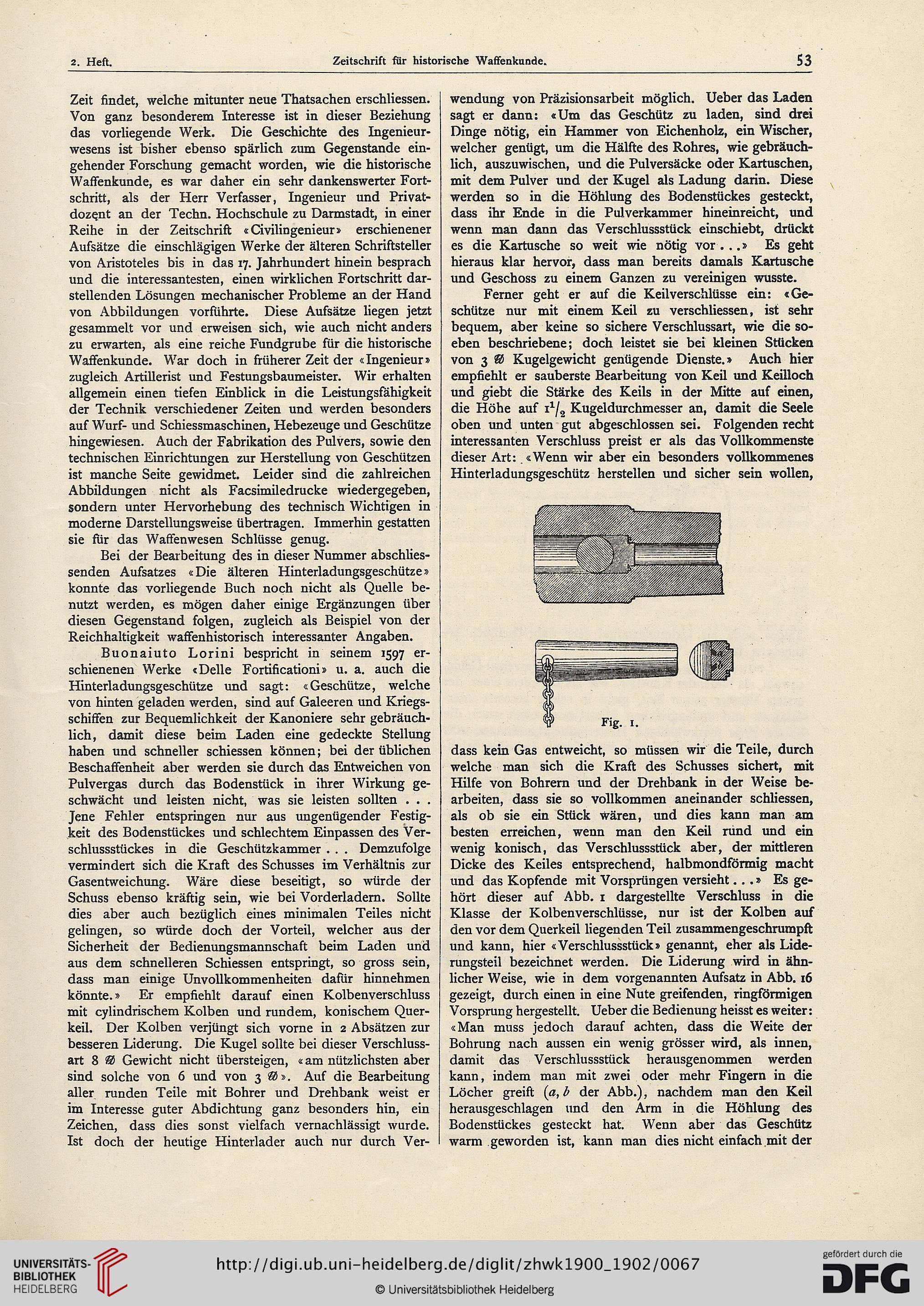2. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
53
Zeit findet, welche mitunter neue Thatsachen erschliessen.
Von ganz besonderem Interesse ist in dieser Beziehung
das vorliegende Werk. Die Geschichte des Ingenieur-
wesens ist bisher ebenso spärlich zum Gegenstände ein-
gehender Forschung gemacht worden, wie die historische
Waffenkunde, es war daher ein sehr dankenswerter Fort-
schritt, als der Herr Verfasser, Ingenieur und Privat-
dozent an der Techn. Hochschule zu Darmstadt, in einer
Reihe in der Zeitschrift «Civilingenieur» erschienener
Aufsätze die einschlägigen Werke der älteren Schriftsteller
von Aristoteles bis in das 17. Jahrhundert hinein besprach
und die interessantesten, einen wirklichen Fortschritt dar-
stellenden Lösungen mechanischer Probleme an der Hand
von Abbildungen vorftihrte. Diese Aufsätze liegen jetzt
gesammelt vor und erweisen sich, wie auch nicht anders
zu erwarten, als eine reiche Fundgrube für die historische
Waffenkunde. War doch in früherer Zeit der «Ingenieur»
zugleich Artillerist und Festungsbaumeister. Wir erhalten
allgemein einen tiefen Einblick in die Leistungsfähigkeit
der Technik verschiedener Zeiten und werden besonders
auf Wurf- und Schiessmaschinen, Hebezeuge und Geschütze
hingewiesen. Auch der Fabrikation des Pulvers, sowie den
technischen Einrichtungen zur Herstellung von Geschützen
ist manche Seite gewidmet. Leider sind die zahlreichen
Abbildungen nicht als Facsimiledrucke wiedergegeben,
sondern unter Hervorhebung des technisch Wichtigen in
moderne Darstellungsweise übertragen. Immerhin gestatten
sie flir das Waffenwesen Schlüsse genug.
Bei der Bearbeitung des in dieser Nummer abschlies-
senden Aufsatzes «Die älteren Hinterladungsgeschütze»
konnte das vorliegende Buch noch nicht als Quelle be-
nutzt werden, es mögen daher einige Ergänzungen über
diesen Gegenstand folgen, zugleich als Beispiel von der
Reichhaltigkeit waffenhistorisch interessanter Angaben.
Buonaiuto Lorini bespricht in seinem 1597 er-
schienenen Werke «Delle Fortificationi» u. a. auch die
Hinterladungsgeschütze und sagt: «Geschütze, welche
von hinten geladen werden, sind auf Galeeren und Kriegs-
schiffen zur Bequemlichkeit der Kanoniere sehr gebräuch-
lich, damit diese beim Laden eine gedeckte Stellung
haben und schneller schiessen können; bei der üblichen
Beschaffenheit aber werden sie durch das Entweichen von
Pulvergas durch das Bodenstück in ihrer Wirkung ge-
schwächt und leisten nicht, was sie leisten sollten . . .
Jene Fehler entspringen nur aus ungenügender Festig-
keit des Bodenstückes und schlechtem Einpassen des Ver-
schlussstückes in die Geschützkammer . . . Demzufolge
vermindert sich die Kraft des Schusses im Verhältnis zur
Gasentweichung. Wäre diese beseitigt, so würde der
Schuss ebenso kräftig sein, wie bei Vorderladern. Sollte
dies aber auch bezüglich eines minimalen Teiles nicht
gelingen, so würde doch der Vorteil, welcher aus der
Sicherheit der Bedienungsmannschaft beim Laden und
aus dem schnelleren Schiessen entspringt, so gross sein,
dass man einige Unvollkommenheiten dafür hinnehmen
könnte.» Er empfiehlt darauf einen Kolben Verschluss
mit cylindrischem Kolben und rundem, konischem Quer-
keil. Der Kolben verjüngt sich vorne in 2 Absätzen zur
besseren Liderung. Die Kugel sollte bei dieser Verschluss-
art 8 @ Gewicht nicht übersteigen, «am nützlichsten aber
sind solche von 6 und von 3 ®». Auf die Bearbeitung
aller runden Teile mit Bohrer und Drehbank weist er
im Interesse guter Abdichtung ganz besonders hin, ein
Zeichen, dass dies sonst vielfach vernachlässigt wurde.
Ist doch der heutige Hinterlader auch nur durch Ver-
wendung von Präzisionsarbeit möglich. Ueber das Laden
sagt er dann: «Um das Geschütz zu laden, sind drei
Dinge nötig, ein Hammer von Eichenholz, ein Wischer,
welcher genügt, um die Hälfte des Rohres, wie gebräuch-
lich, auszuwischen, und die Pulversäcke oder Kartuschen,
mit dem Pulver und der Kugel als Ladung darin. Diese
werden so in die Höhlung des Bodenstückes gesteckt,
dass ihr Ende in die Pulverkammer hineinreicht, und
wenn man dann das Verschlussstück einschiebt, drückt
es die Kartusche so weit wie nötig vor ...» Es geht
hieraus klar hervor, dass man bereits damals Kartusche
und Geschoss zu einem Ganzen zu vereinigen wusste.
Ferner geht er auf die Keilverschlüsse ein: «Ge-
schütze nur mit einem Keil zu verschliessen, ist sehr
bequem, aber keine so sichere Verschlussart, wie die so-
eben beschriebene; doch leistet sie bei kleinen Stücken
von 3 @ Kugelgewicht genügende Dienste.» Auch hier
empfiehlt er sauberste Bearbeitung von Keil und Keilloch
und giebt die Stärke des Keils in der Mitte auf einen,
die Höhe auf ix/0 Kugeldurchmesser an, damit die Seele
oben und unten gut abgeschlossen sei. Folgenden recht
interessanten Verschluss preist er als das Vollkommenste
dieser Art: «Wenn wir aber ein besonders vollkommenes
Hinterladungsgeschütz hersteilen und sicher sein wollen,
dass kein Gas entweicht, so müssen wir die Teile, durch
welche man sich die Kraft des Schusses sichert, mit
Hilfe von Bohrern und der Drehbank in der Weise be-
arbeiten, dass sie so vollkommen aneinander schliessen,
als ob sie ein Stück Wären, und dies kann man am
besten erreichen, wenn man den Keil rund und ein
wenig konisch, das Verschlussstück aber, der mittleren
Dicke des Keiles entsprechend, halbmondförmig macht
und das Kopfende mit Vorsprüngen versieht...» Es ge-
hört dieser auf Abb. 1 dargestellte Verschluss in die
Klasse der Kolbenverschlüsse, nur ist der Kolben auf
den vor dem Querkeil liegenden Teil zusammengeschrumpft
und kann, hier «Verschlussstück» genannt, eher als Lide-
rungsteil bezeichnet werden. Die Liderung wird in ähn-
licher Weise, wie in dem vorgenannten Aufsatz in Abb. 16
gezeigt, durch einen in eine Nute greifenden, ringförmigen
Vorsprung hergestellt. Ueber die Bedienung heisst es weiter:
«Man muss jedoch darauf achten, dass die Weite der
Bohrung nach aussen ein wenig grösser wird, als innen,
damit das Verschlussstück herausgenommen werden
kann, indem man mit zwei oder mehr Fingern in die
Löcher greift (a, b der Abb.), nachdem man den Keil
herausgeschlagen und den Arm in die Höhlung des
Bodenstückes gesteckt hat. Wenn aber das Geschütz
warm geworden ist, kann man dies nicht einfach mit der
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
53
Zeit findet, welche mitunter neue Thatsachen erschliessen.
Von ganz besonderem Interesse ist in dieser Beziehung
das vorliegende Werk. Die Geschichte des Ingenieur-
wesens ist bisher ebenso spärlich zum Gegenstände ein-
gehender Forschung gemacht worden, wie die historische
Waffenkunde, es war daher ein sehr dankenswerter Fort-
schritt, als der Herr Verfasser, Ingenieur und Privat-
dozent an der Techn. Hochschule zu Darmstadt, in einer
Reihe in der Zeitschrift «Civilingenieur» erschienener
Aufsätze die einschlägigen Werke der älteren Schriftsteller
von Aristoteles bis in das 17. Jahrhundert hinein besprach
und die interessantesten, einen wirklichen Fortschritt dar-
stellenden Lösungen mechanischer Probleme an der Hand
von Abbildungen vorftihrte. Diese Aufsätze liegen jetzt
gesammelt vor und erweisen sich, wie auch nicht anders
zu erwarten, als eine reiche Fundgrube für die historische
Waffenkunde. War doch in früherer Zeit der «Ingenieur»
zugleich Artillerist und Festungsbaumeister. Wir erhalten
allgemein einen tiefen Einblick in die Leistungsfähigkeit
der Technik verschiedener Zeiten und werden besonders
auf Wurf- und Schiessmaschinen, Hebezeuge und Geschütze
hingewiesen. Auch der Fabrikation des Pulvers, sowie den
technischen Einrichtungen zur Herstellung von Geschützen
ist manche Seite gewidmet. Leider sind die zahlreichen
Abbildungen nicht als Facsimiledrucke wiedergegeben,
sondern unter Hervorhebung des technisch Wichtigen in
moderne Darstellungsweise übertragen. Immerhin gestatten
sie flir das Waffenwesen Schlüsse genug.
Bei der Bearbeitung des in dieser Nummer abschlies-
senden Aufsatzes «Die älteren Hinterladungsgeschütze»
konnte das vorliegende Buch noch nicht als Quelle be-
nutzt werden, es mögen daher einige Ergänzungen über
diesen Gegenstand folgen, zugleich als Beispiel von der
Reichhaltigkeit waffenhistorisch interessanter Angaben.
Buonaiuto Lorini bespricht in seinem 1597 er-
schienenen Werke «Delle Fortificationi» u. a. auch die
Hinterladungsgeschütze und sagt: «Geschütze, welche
von hinten geladen werden, sind auf Galeeren und Kriegs-
schiffen zur Bequemlichkeit der Kanoniere sehr gebräuch-
lich, damit diese beim Laden eine gedeckte Stellung
haben und schneller schiessen können; bei der üblichen
Beschaffenheit aber werden sie durch das Entweichen von
Pulvergas durch das Bodenstück in ihrer Wirkung ge-
schwächt und leisten nicht, was sie leisten sollten . . .
Jene Fehler entspringen nur aus ungenügender Festig-
keit des Bodenstückes und schlechtem Einpassen des Ver-
schlussstückes in die Geschützkammer . . . Demzufolge
vermindert sich die Kraft des Schusses im Verhältnis zur
Gasentweichung. Wäre diese beseitigt, so würde der
Schuss ebenso kräftig sein, wie bei Vorderladern. Sollte
dies aber auch bezüglich eines minimalen Teiles nicht
gelingen, so würde doch der Vorteil, welcher aus der
Sicherheit der Bedienungsmannschaft beim Laden und
aus dem schnelleren Schiessen entspringt, so gross sein,
dass man einige Unvollkommenheiten dafür hinnehmen
könnte.» Er empfiehlt darauf einen Kolben Verschluss
mit cylindrischem Kolben und rundem, konischem Quer-
keil. Der Kolben verjüngt sich vorne in 2 Absätzen zur
besseren Liderung. Die Kugel sollte bei dieser Verschluss-
art 8 @ Gewicht nicht übersteigen, «am nützlichsten aber
sind solche von 6 und von 3 ®». Auf die Bearbeitung
aller runden Teile mit Bohrer und Drehbank weist er
im Interesse guter Abdichtung ganz besonders hin, ein
Zeichen, dass dies sonst vielfach vernachlässigt wurde.
Ist doch der heutige Hinterlader auch nur durch Ver-
wendung von Präzisionsarbeit möglich. Ueber das Laden
sagt er dann: «Um das Geschütz zu laden, sind drei
Dinge nötig, ein Hammer von Eichenholz, ein Wischer,
welcher genügt, um die Hälfte des Rohres, wie gebräuch-
lich, auszuwischen, und die Pulversäcke oder Kartuschen,
mit dem Pulver und der Kugel als Ladung darin. Diese
werden so in die Höhlung des Bodenstückes gesteckt,
dass ihr Ende in die Pulverkammer hineinreicht, und
wenn man dann das Verschlussstück einschiebt, drückt
es die Kartusche so weit wie nötig vor ...» Es geht
hieraus klar hervor, dass man bereits damals Kartusche
und Geschoss zu einem Ganzen zu vereinigen wusste.
Ferner geht er auf die Keilverschlüsse ein: «Ge-
schütze nur mit einem Keil zu verschliessen, ist sehr
bequem, aber keine so sichere Verschlussart, wie die so-
eben beschriebene; doch leistet sie bei kleinen Stücken
von 3 @ Kugelgewicht genügende Dienste.» Auch hier
empfiehlt er sauberste Bearbeitung von Keil und Keilloch
und giebt die Stärke des Keils in der Mitte auf einen,
die Höhe auf ix/0 Kugeldurchmesser an, damit die Seele
oben und unten gut abgeschlossen sei. Folgenden recht
interessanten Verschluss preist er als das Vollkommenste
dieser Art: «Wenn wir aber ein besonders vollkommenes
Hinterladungsgeschütz hersteilen und sicher sein wollen,
dass kein Gas entweicht, so müssen wir die Teile, durch
welche man sich die Kraft des Schusses sichert, mit
Hilfe von Bohrern und der Drehbank in der Weise be-
arbeiten, dass sie so vollkommen aneinander schliessen,
als ob sie ein Stück Wären, und dies kann man am
besten erreichen, wenn man den Keil rund und ein
wenig konisch, das Verschlussstück aber, der mittleren
Dicke des Keiles entsprechend, halbmondförmig macht
und das Kopfende mit Vorsprüngen versieht...» Es ge-
hört dieser auf Abb. 1 dargestellte Verschluss in die
Klasse der Kolbenverschlüsse, nur ist der Kolben auf
den vor dem Querkeil liegenden Teil zusammengeschrumpft
und kann, hier «Verschlussstück» genannt, eher als Lide-
rungsteil bezeichnet werden. Die Liderung wird in ähn-
licher Weise, wie in dem vorgenannten Aufsatz in Abb. 16
gezeigt, durch einen in eine Nute greifenden, ringförmigen
Vorsprung hergestellt. Ueber die Bedienung heisst es weiter:
«Man muss jedoch darauf achten, dass die Weite der
Bohrung nach aussen ein wenig grösser wird, als innen,
damit das Verschlussstück herausgenommen werden
kann, indem man mit zwei oder mehr Fingern in die
Löcher greift (a, b der Abb.), nachdem man den Keil
herausgeschlagen und den Arm in die Höhlung des
Bodenstückes gesteckt hat. Wenn aber das Geschütz
warm geworden ist, kann man dies nicht einfach mit der