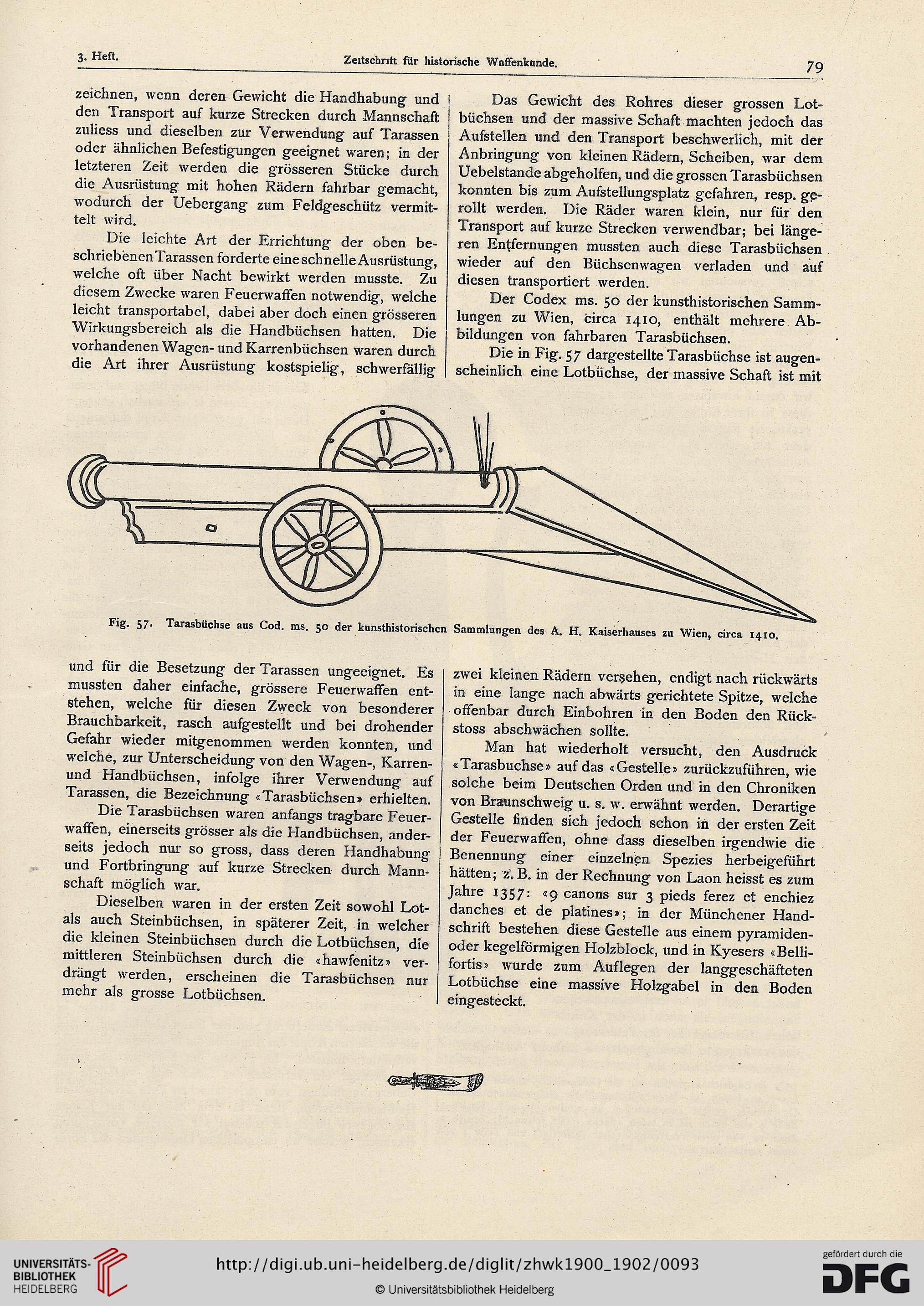3. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenkünde.
79
zeichnen, wenn deren Gewicht die Handhabung und
den Transport auf kurze Strecken durch Mannschaft
zuliess und dieselben zur Verwendung auf Tarassen
oder ähnlichen Befestigungen geeignet waren; in der
letzteren Zeit werden die grösseren Stücke durch
die Ausrüstung mit hohen Rädern fahrbar gemacht,
wodurch der Uebergang zum Feldgeschütz vermit-
telt wird.
Die leichte Art der Errichtung der oben be-
schriebencnTarassen forderte eine schnelle Ausrüstung,
welche oft über Nacht bewirkt werden musste. Zu
diesem Zwecke waren Feuerwaffen notwendig, welche
leicht transportabel, dabei aber doch einen grösseren
Wirkungsbereich als die Handbüchsen hatten. Die
vorhandenen Wagen- und Karrenbüchsen waren durch
die Art ihrer Ausrüstung kostspielig, schwerfällig
Das Gewicht des Rohres dieser grossen Lot-
büchsen und der massive Schaft machten jedoch das
Aufstellen und den Transport beschwerlich, mit der
Anbringung von kleinen Rädern, Scheiben, war dem
Uebelstande abgeholfen, und die grossen Tarasbüchsen
konnten bis zum Aufstellungsplatz gefahren, resp. ge-
rollt werden. Die Räder waren klein, nur für den
Transport auf kurze Strecken verwendbar; bei länge-
ren Entfernungen mussten auch diese Tarasbüchsen
wieder auf den Büchsenwagen verladen und auf
diesen transportiert werden.
Der Codex ms. 50 der kunsthistorischen Samm-
lungen zu Wien, circa 1410, enthält mehrere Ab-
bildungen von fahrbaren Tarasbüchsen.
Die in Fig. 57 dargestellte Tarasbüchse ist augen-
scheinlich eine Lotbüchse, der massive Schaft ist mit
*
Fig- 57- Tarasbüchse aus Cod. ms. 50 der kunsthistorischen Sammlungen des A. H. Kaiserhauses zu Wien, circa 1410.
und für die Besetzung der Tarassen ungeeignet. Es
mussten daher einfache, grössere Feuerwaffen ent-
stehen, welche für diesen Zweck von besonderer
Brauchbarkeit, rasch aufgestellt und bei drohender
Gefahr wieder mitgenommen werden konnten, und
welche, zur Unterscheidung von den Wagen-, Karren-
und Handbüchsen, infolge ihrer Verwendung auf
Tarassen, die Bezeichnung «Tarasbüchsen» erhielten.
Die Tarasbüchsen waren anfangs tragbare Feuer-
waffen, einerseits grösser als die Handbüchsen, ander-
seits jedoch nur so gross, dass deren Handhabung
und Fortbringung auf kurze Strecken durch Mann-
schaft möglich war.
Dieselben waren in der ersten Zeit sowohl Lot-
ais auch Steinbüchsen, in späterer Zeit, in welcher
die kleinen Steinbüchsen durch die Lotbüchsen, die
mittleren Steinbüchsen durch die «hawfenitz» ver-
drängt werden, erscheinen die Tarasbüchsen nur
mehr als grosse Lotbüchsen.
zwei kleinen Rädern vergehen, endigt nach rückwärts
in eine lange nach abwärts gerichtete Spitze, welche
offenbar durch Einbohren in den Boden den Rück-
stoss abschwächen sollte.
Man hat wiederholt versucht, den Ausdruck
«Tarasbüchse» auf das «Gestelle» zurückzuführen, wie
solche beim Deutschen Orden und in den Chroniken
von Braunschweig u. s. w. erwähnt werden. Derartige
Gestelle finden sich jedoch schon in der ersten Zeit
der Feuerwaffen, ohne dass dieselben irgendwie die
Benennung einer einzelnen Spezies herbeigeführt
hätten; z. B. in der Rechnung von Laon heisst es zum
Jahre 1357: «9 canons sur 3 pieds ferez et enchiez
danches et de platines»; in der Münchener Hand-
schrift bestehen diese Gestelle aus einem pyramiden-
oder kegelförmigen Holzblock, und in Kyesers «Belli-
fortis» wurde zum Auflegen der langgeschäfteten
Lotbüchse eine massive Holzgabel in den Boden
eingesteckt.
Zeitschrift für historische Waffenkünde.
79
zeichnen, wenn deren Gewicht die Handhabung und
den Transport auf kurze Strecken durch Mannschaft
zuliess und dieselben zur Verwendung auf Tarassen
oder ähnlichen Befestigungen geeignet waren; in der
letzteren Zeit werden die grösseren Stücke durch
die Ausrüstung mit hohen Rädern fahrbar gemacht,
wodurch der Uebergang zum Feldgeschütz vermit-
telt wird.
Die leichte Art der Errichtung der oben be-
schriebencnTarassen forderte eine schnelle Ausrüstung,
welche oft über Nacht bewirkt werden musste. Zu
diesem Zwecke waren Feuerwaffen notwendig, welche
leicht transportabel, dabei aber doch einen grösseren
Wirkungsbereich als die Handbüchsen hatten. Die
vorhandenen Wagen- und Karrenbüchsen waren durch
die Art ihrer Ausrüstung kostspielig, schwerfällig
Das Gewicht des Rohres dieser grossen Lot-
büchsen und der massive Schaft machten jedoch das
Aufstellen und den Transport beschwerlich, mit der
Anbringung von kleinen Rädern, Scheiben, war dem
Uebelstande abgeholfen, und die grossen Tarasbüchsen
konnten bis zum Aufstellungsplatz gefahren, resp. ge-
rollt werden. Die Räder waren klein, nur für den
Transport auf kurze Strecken verwendbar; bei länge-
ren Entfernungen mussten auch diese Tarasbüchsen
wieder auf den Büchsenwagen verladen und auf
diesen transportiert werden.
Der Codex ms. 50 der kunsthistorischen Samm-
lungen zu Wien, circa 1410, enthält mehrere Ab-
bildungen von fahrbaren Tarasbüchsen.
Die in Fig. 57 dargestellte Tarasbüchse ist augen-
scheinlich eine Lotbüchse, der massive Schaft ist mit
*
Fig- 57- Tarasbüchse aus Cod. ms. 50 der kunsthistorischen Sammlungen des A. H. Kaiserhauses zu Wien, circa 1410.
und für die Besetzung der Tarassen ungeeignet. Es
mussten daher einfache, grössere Feuerwaffen ent-
stehen, welche für diesen Zweck von besonderer
Brauchbarkeit, rasch aufgestellt und bei drohender
Gefahr wieder mitgenommen werden konnten, und
welche, zur Unterscheidung von den Wagen-, Karren-
und Handbüchsen, infolge ihrer Verwendung auf
Tarassen, die Bezeichnung «Tarasbüchsen» erhielten.
Die Tarasbüchsen waren anfangs tragbare Feuer-
waffen, einerseits grösser als die Handbüchsen, ander-
seits jedoch nur so gross, dass deren Handhabung
und Fortbringung auf kurze Strecken durch Mann-
schaft möglich war.
Dieselben waren in der ersten Zeit sowohl Lot-
ais auch Steinbüchsen, in späterer Zeit, in welcher
die kleinen Steinbüchsen durch die Lotbüchsen, die
mittleren Steinbüchsen durch die «hawfenitz» ver-
drängt werden, erscheinen die Tarasbüchsen nur
mehr als grosse Lotbüchsen.
zwei kleinen Rädern vergehen, endigt nach rückwärts
in eine lange nach abwärts gerichtete Spitze, welche
offenbar durch Einbohren in den Boden den Rück-
stoss abschwächen sollte.
Man hat wiederholt versucht, den Ausdruck
«Tarasbüchse» auf das «Gestelle» zurückzuführen, wie
solche beim Deutschen Orden und in den Chroniken
von Braunschweig u. s. w. erwähnt werden. Derartige
Gestelle finden sich jedoch schon in der ersten Zeit
der Feuerwaffen, ohne dass dieselben irgendwie die
Benennung einer einzelnen Spezies herbeigeführt
hätten; z. B. in der Rechnung von Laon heisst es zum
Jahre 1357: «9 canons sur 3 pieds ferez et enchiez
danches et de platines»; in der Münchener Hand-
schrift bestehen diese Gestelle aus einem pyramiden-
oder kegelförmigen Holzblock, und in Kyesers «Belli-
fortis» wurde zum Auflegen der langgeschäfteten
Lotbüchse eine massive Holzgabel in den Boden
eingesteckt.