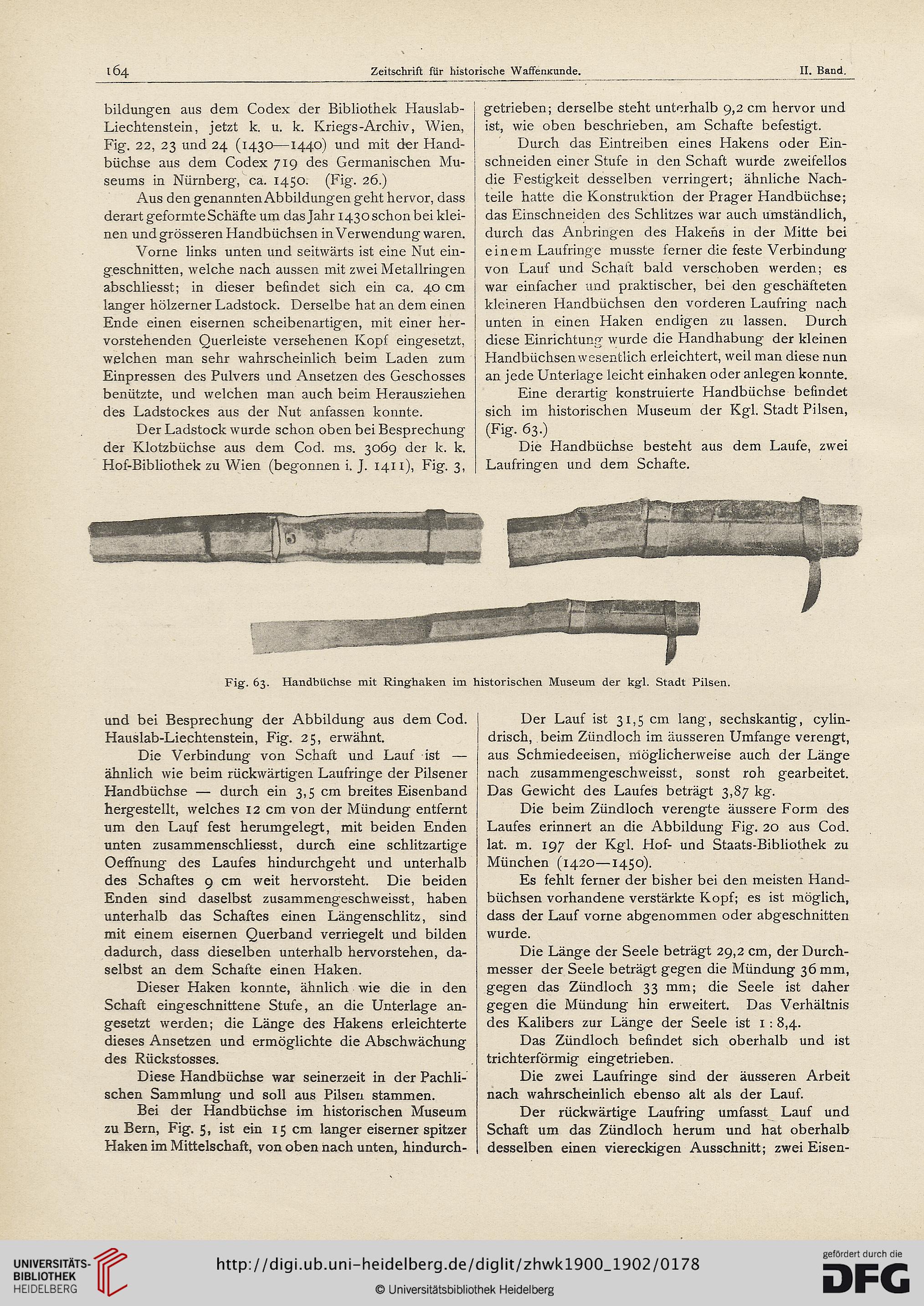164
Zeitschrift für historische Waffennunde.
II. Band.
bildungen aus dem Codex der Bibliothek Hauslab-
Liechtenstein, jetzt k. u. k. Kriegs-Archiv, Wien,
Fig. 22, 23 und 24 (1430—1440) und mit der Hand-
büchse aus dem Codex 719 des Germanischen Mu-
seums in Nürnberg, ca. 1450. (Fig. 26.)
Aus den genannten Abbildungen geht hervor, dass
derart geformte Schäfte um das Jahr 1430 schon bei klei-
nen und grösseren Handbüchsen in Verwendung waren.
Vorne links unten und seitwärts ist eine Nut ein-
geschnitten, welche nach aussen mit zwei Metallringen
abschliesst; in dieser befindet sich ein ca. 40 cm
langer hölzerner Ladstock. Derselbe hat an dem einen
Ende einen eisernen scheibenartigen, mit einer her-
vorstehenden Querleiste versehenen Kopf eingesetzt,
welchen man sehr wahrscheinlich beim Laden zum
Einpressen des Pulvers und Ansetzen des Geschosses
benützte, und welchen man auch beim Herausziehen
des Ladstockes aus der Nut anfassen konnte.
Der Ladstock wurde schon oben bei Besprechung
der Klotzbüchse aus dem Cod. ms. 3069 der k. k.
Hof-Bibliothek zu Wien (begonnen i. J. 1411), Fig. 3,
getrieben; derselbe steht unterhalb 9,2 cm hervor und
ist, wie oben beschrieben, am Schafte befestigt.
Durch das Eintreiben eines Hakens oder Ein-
schneiden einer Stufe in den Schaft wurde zweifellos
die Festigkeit desselben verringert; ähnliche Nach-
teile hatte die Konstruktion der Prager Handbüchse;
das Einschneiden des Schlitzes war auch umständlich,
durch das Anbringen des Hakens in der Mitte bei
einem Laufringe musste ferner die feste Verbindung
von Lauf und Schaft bald verschoben werden; es
war einfacher und praktischer, bei den geschäfteten
kleineren Handbüchsen den vorderen Laufring nach
unten in einen Haken endigen zu lassen. Durch
diese Einrichtung wurde die Handhabung der kleinen
Handbüchsen wesentlich erleichtert, weil man diese nun
an jede Unterlage leicht einhaken oder anlegen konnte.
Eine derartig konstruierte Handbüchse befindet
sich im historischen Museum der Kgl. Stadt Pilsen,
(Fig. 63.)
Die Handbüchse besteht aus dem Laufe, zwei
Laufringen und dem Schafte.
Fig. 63. Handbüchse mit Ringhaken im historischen Museum der kgl. Stadt Pilsen.
und bei Besprechung der Abbildung aus dem Cod.
Hauslab-Liechtenstein, Fig. 25, erwähnt.
Die Verbindung von Schaft und Lauf ist —
ähnlich wie beim rückwärtigen Laufringe der Pilsener
Handbüchse — durch ein 3,5 cm breites Eisenband
hergestellt, welches 12 cm von der Mündung entfernt
um den Lauf fest herumgelegt, mit beiden Enden
unten zusammenschliesst, durch eine schlitzartige
Oeffnung des Laufes hindurchgeht und unterhalb
des Schaftes 9 cm weit hervorsteht. Die beiden
Enden sind daselbst zusammengeschweisst, haben
unterhalb das Schaftes einen Längenschlitz, sind
mit einem eisernen Querband verriegelt und bilden
dadurch, dass dieselben unterhalb hervorstehen, da-
selbst an dem Schafte einen Haken.
Dieser Haken konnte, ähnlich wie die in den
Schaft eingeschnittene Stufe, an die Unterlage an-
gesetzt werden; die Länge des Hakens erleichterte
dieses Ansetzen und ermöglichte die Abschwächung
des Rückstosses.
Diese Handbüchse war seinerzeit in der Pachli-
schen Sammlung und soll aus Pilsen stammen.
Bei der Handbüchse im historischen Museum
zu Bern, Fig. 5, ist ein 15 cm langer eiserner spitzer
Haken im Mittelschaft, von oben nach unten, hindurch-
Der Lauf ist 31,5 cm lang, sechskantig, cylin-
drisch, beim Zündloch im äusseren Umfange verengt,
aus Schmiedeeisen, möglicherweise auch der Länge
nach zusammengeschweisst, sonst roh gearbeitet.
Das Gewicht des Laufes beträgt 3,87 kg.
Die beim Zündloch verengte äussere Form des
Laufes erinnert an die Abbildung Fig. 20 aus Cod.
lat. m. 197 der Kgl. Hof- und Staats-Bibliothek zu
München (1420—1450).
Es fehlt ferner der bisher bei den meisten Hand-
büchsen vorhandene verstärkte Kopf; es ist möglich,
dass der Lauf vorne abgenommen oder abgeschnitten
wurde.
Die Länge der Seele beträgt 29,2 cm, der Durch-
messer der Seele beträgt gegen die Mündung 36 mm,
gegen das Zündloch 33 mm; die Seele ist daher
gegen die Mündung hin erweitert. Das Verhältnis
des Kalibers zur Länge der Seele ist 1: 8,4.
Das Zündloch befindet sich oberhalb und ist
trichterförmig eingetrieben.
Die zwei Laufringe sind der äusseren Arbeit
nach wahrscheinlich ebenso alt als der Lauf.
Der rückwärtige Laufring umfasst Lauf und
Schaft um das Zündloch herum und hat oberhalb
desselben einen viereckigen Ausschnitt; zwei Eisen-
Zeitschrift für historische Waffennunde.
II. Band.
bildungen aus dem Codex der Bibliothek Hauslab-
Liechtenstein, jetzt k. u. k. Kriegs-Archiv, Wien,
Fig. 22, 23 und 24 (1430—1440) und mit der Hand-
büchse aus dem Codex 719 des Germanischen Mu-
seums in Nürnberg, ca. 1450. (Fig. 26.)
Aus den genannten Abbildungen geht hervor, dass
derart geformte Schäfte um das Jahr 1430 schon bei klei-
nen und grösseren Handbüchsen in Verwendung waren.
Vorne links unten und seitwärts ist eine Nut ein-
geschnitten, welche nach aussen mit zwei Metallringen
abschliesst; in dieser befindet sich ein ca. 40 cm
langer hölzerner Ladstock. Derselbe hat an dem einen
Ende einen eisernen scheibenartigen, mit einer her-
vorstehenden Querleiste versehenen Kopf eingesetzt,
welchen man sehr wahrscheinlich beim Laden zum
Einpressen des Pulvers und Ansetzen des Geschosses
benützte, und welchen man auch beim Herausziehen
des Ladstockes aus der Nut anfassen konnte.
Der Ladstock wurde schon oben bei Besprechung
der Klotzbüchse aus dem Cod. ms. 3069 der k. k.
Hof-Bibliothek zu Wien (begonnen i. J. 1411), Fig. 3,
getrieben; derselbe steht unterhalb 9,2 cm hervor und
ist, wie oben beschrieben, am Schafte befestigt.
Durch das Eintreiben eines Hakens oder Ein-
schneiden einer Stufe in den Schaft wurde zweifellos
die Festigkeit desselben verringert; ähnliche Nach-
teile hatte die Konstruktion der Prager Handbüchse;
das Einschneiden des Schlitzes war auch umständlich,
durch das Anbringen des Hakens in der Mitte bei
einem Laufringe musste ferner die feste Verbindung
von Lauf und Schaft bald verschoben werden; es
war einfacher und praktischer, bei den geschäfteten
kleineren Handbüchsen den vorderen Laufring nach
unten in einen Haken endigen zu lassen. Durch
diese Einrichtung wurde die Handhabung der kleinen
Handbüchsen wesentlich erleichtert, weil man diese nun
an jede Unterlage leicht einhaken oder anlegen konnte.
Eine derartig konstruierte Handbüchse befindet
sich im historischen Museum der Kgl. Stadt Pilsen,
(Fig. 63.)
Die Handbüchse besteht aus dem Laufe, zwei
Laufringen und dem Schafte.
Fig. 63. Handbüchse mit Ringhaken im historischen Museum der kgl. Stadt Pilsen.
und bei Besprechung der Abbildung aus dem Cod.
Hauslab-Liechtenstein, Fig. 25, erwähnt.
Die Verbindung von Schaft und Lauf ist —
ähnlich wie beim rückwärtigen Laufringe der Pilsener
Handbüchse — durch ein 3,5 cm breites Eisenband
hergestellt, welches 12 cm von der Mündung entfernt
um den Lauf fest herumgelegt, mit beiden Enden
unten zusammenschliesst, durch eine schlitzartige
Oeffnung des Laufes hindurchgeht und unterhalb
des Schaftes 9 cm weit hervorsteht. Die beiden
Enden sind daselbst zusammengeschweisst, haben
unterhalb das Schaftes einen Längenschlitz, sind
mit einem eisernen Querband verriegelt und bilden
dadurch, dass dieselben unterhalb hervorstehen, da-
selbst an dem Schafte einen Haken.
Dieser Haken konnte, ähnlich wie die in den
Schaft eingeschnittene Stufe, an die Unterlage an-
gesetzt werden; die Länge des Hakens erleichterte
dieses Ansetzen und ermöglichte die Abschwächung
des Rückstosses.
Diese Handbüchse war seinerzeit in der Pachli-
schen Sammlung und soll aus Pilsen stammen.
Bei der Handbüchse im historischen Museum
zu Bern, Fig. 5, ist ein 15 cm langer eiserner spitzer
Haken im Mittelschaft, von oben nach unten, hindurch-
Der Lauf ist 31,5 cm lang, sechskantig, cylin-
drisch, beim Zündloch im äusseren Umfange verengt,
aus Schmiedeeisen, möglicherweise auch der Länge
nach zusammengeschweisst, sonst roh gearbeitet.
Das Gewicht des Laufes beträgt 3,87 kg.
Die beim Zündloch verengte äussere Form des
Laufes erinnert an die Abbildung Fig. 20 aus Cod.
lat. m. 197 der Kgl. Hof- und Staats-Bibliothek zu
München (1420—1450).
Es fehlt ferner der bisher bei den meisten Hand-
büchsen vorhandene verstärkte Kopf; es ist möglich,
dass der Lauf vorne abgenommen oder abgeschnitten
wurde.
Die Länge der Seele beträgt 29,2 cm, der Durch-
messer der Seele beträgt gegen die Mündung 36 mm,
gegen das Zündloch 33 mm; die Seele ist daher
gegen die Mündung hin erweitert. Das Verhältnis
des Kalibers zur Länge der Seele ist 1: 8,4.
Das Zündloch befindet sich oberhalb und ist
trichterförmig eingetrieben.
Die zwei Laufringe sind der äusseren Arbeit
nach wahrscheinlich ebenso alt als der Lauf.
Der rückwärtige Laufring umfasst Lauf und
Schaft um das Zündloch herum und hat oberhalb
desselben einen viereckigen Ausschnitt; zwei Eisen-