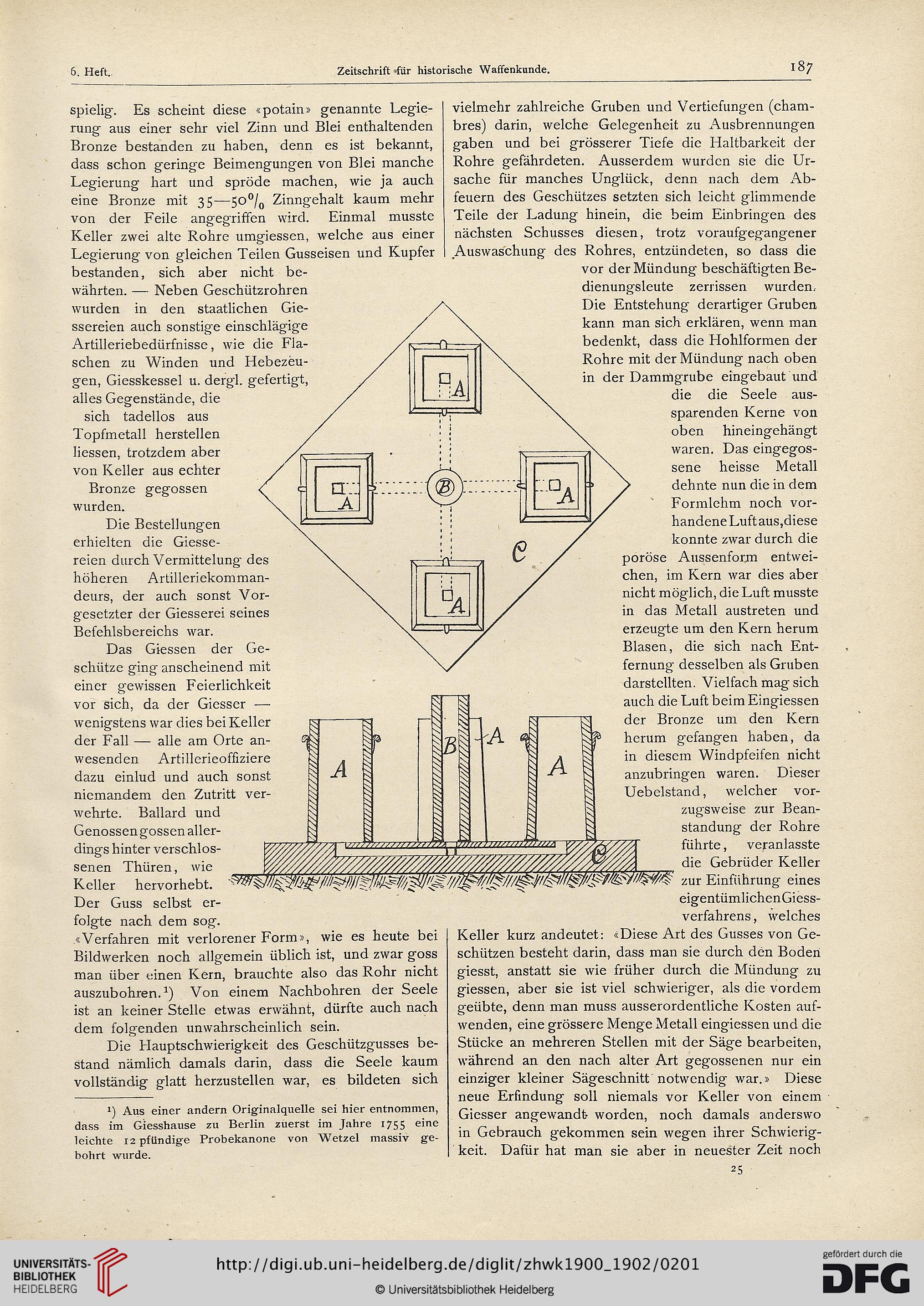6. Heft.
Zeitschrift «für historische Waffenkunde.
187
spielig'. Es scheint diese «potain» genannte Legie-
rung aus einer sehr viel Zinn und Blei enthaltenden
Bronze bestanden zu haben, denn es ist bekannt,
dass schon geringe Beimengungen von Blei manche
Legierung hart und spröde machen, wie ja auch
eine Bronze mit 35—50°/0 Zinngehalt kaum mehr
von der Feile angegriffen wird. Einmal musste
Keller zwei alte Rohre umgiessen, welche aus einer
Legierung von gleichen Teilen Gusseisen und Kupfer
bestanden, sich aber nicht be-
währten. — Neben Geschützrohren
wurden in den staatlichen Gie-
ssereien auch sonstige einschlägige
Artilleriebedürfnisse, wie die Fla-
schen zu Winden und Hebezeu-
gen, Giesskessel u. dergl. gefertigt,
alles Gegenstände, die
sich tadellos aus
Topfmetall herstellen
Hessen, trotzdem aber
von Keller aus echter
Bronze gegossen
wurden.
Die Bestellungen
erhielten die Giesse-
reien durch Vermittelung des
höheren Artilleriekomman-
deurs, der auch sonst Vor-
gesetzter der Giesserei seines
Befehlsbereichs war.
Das Giessen der Ge-
schütze ging anscheinend mit
einer gewissen Feierlichkeit
vor sich, da der Giesser —
wenigstens war dies bei Keller
der Fall — alle am Orte an-
wesenden Artillerieoffiziere
dazu einlud und auch sonst
niemandem den Zutritt
wehrte. Ballard und
Genossen gossen aller-
dings hinter verschlos-
senen Thüren, wie
Keller hervorhebt.
Der Guss selbst er-
folgte nach dem sog.
ver-
A
B
vielmehr zahlreiche Gruben und Vertiefungen (cham-
bres) darin, welche Gelegenheit zu Ausbrennungen
gaben und bei grösserer Tiefe die Haltbarkeit der
Rohre gefährdeten. Ausserdem wurden sie die Ur-
sache für manches Unglück, denn nach dem Ab-
feuern des Geschützes setzten sich leicht glimmende
Teile der Ladung hinein, die beim Einbringen des
nächsten Schusses diesen, trotz voraufgegangener
.Auswaschung des Rohres, entzündeten, so dass die
vor der Mündung beschäftigten Be-
dienungsleute zerrissen wurden.
Die Entstehung derartiger Gruben
kann man sich erklären, wenn man
bedenkt, dass die Hohlformen der
Rohre mit der Mündung nach oben
in der Dammgrube eingebaut und
die die Seele aus-
sparenden Kerne von
oben hineingehängt
waren. Das eingegos-
sene heisse Metall
dehnte nun die in dem
Formlehm noch vor-
handene Luftaus,diese
konnte zwar durch die
poröse Aussenform entwei-
chen, im Kern war dies aber
nicht möglich, die Luft musste
in das Metall austreten und
erzeugte um den Kern herum
Blasen, die sich nach Ent-
fernung desselben als Gruben
darstcllten. Vielfach mag sich
auch die Luft beim Eingiessen
der Bronze um den Kern
herum gefangen haben, da
in diesem Windpfeifen nicht
anzubringen waren. Dieser
Uebelstand, welcher vor-
zugsweise zur Bean-
standung der Rohre
führte, veranlasste
die Gebrüder Keller
A
A
zur Einführung eines
eigentümlichenGiess-
verfahrens, welches
Keller kurz andeutet: «Diese Art des Gusses von Ge-
schützen besteht darin, dass man sie durch den Boden
giesst, anstatt sie wie früher durch die Mündung zu
giessen, aber sie ist viel schwieriger, als die vordem
geübte, denn man muss ausserordentliche Kosten auf-
wenden, eine grössere Menge Metall eingiessen und die
Stücke an mehreren Stellen mit der Säge bearbeiten,
während an den nach alter Art gegossenen nur ein
einziger kleiner Sägeschnitt notwendig war.» Diese
neue Erfindung soll niemals vor Keller von einem
Giesser angewandt- worden, noch damals anderswo
in Gebrauch gekommen sein wegen ihrer Schwierig-
keit. Dafür hat man sie aber in neuester Zeit noch
«Verfahren mit verlorener Form», wie es heute bei
Bildwerken noch allgemein üblich ist, und zwar goss
man über einen Kern, brauchte also das Rohr nicht
auszubohren.1) Von einem Nachbohren der Seele
ist an keiner Stelle etwas erwähnt, dürfte auch nach
dem folgenden unwahrscheinlich sein.
Die Flauptschwierigkeit des Geschützgusses be-
stand nämlich damals darin, dass die Seele kaum
vollständig glatt herzustellen war, es bildeten sich
i) Aus einer andern Originalquelle sei hier entnommen,
dass im Giesshause zu Berlin zuerst im Jahre 1755 eine
leichte 12 pfündige Probekanone von Wetzel massiv ge-
bohrt wurde.
25
Zeitschrift «für historische Waffenkunde.
187
spielig'. Es scheint diese «potain» genannte Legie-
rung aus einer sehr viel Zinn und Blei enthaltenden
Bronze bestanden zu haben, denn es ist bekannt,
dass schon geringe Beimengungen von Blei manche
Legierung hart und spröde machen, wie ja auch
eine Bronze mit 35—50°/0 Zinngehalt kaum mehr
von der Feile angegriffen wird. Einmal musste
Keller zwei alte Rohre umgiessen, welche aus einer
Legierung von gleichen Teilen Gusseisen und Kupfer
bestanden, sich aber nicht be-
währten. — Neben Geschützrohren
wurden in den staatlichen Gie-
ssereien auch sonstige einschlägige
Artilleriebedürfnisse, wie die Fla-
schen zu Winden und Hebezeu-
gen, Giesskessel u. dergl. gefertigt,
alles Gegenstände, die
sich tadellos aus
Topfmetall herstellen
Hessen, trotzdem aber
von Keller aus echter
Bronze gegossen
wurden.
Die Bestellungen
erhielten die Giesse-
reien durch Vermittelung des
höheren Artilleriekomman-
deurs, der auch sonst Vor-
gesetzter der Giesserei seines
Befehlsbereichs war.
Das Giessen der Ge-
schütze ging anscheinend mit
einer gewissen Feierlichkeit
vor sich, da der Giesser —
wenigstens war dies bei Keller
der Fall — alle am Orte an-
wesenden Artillerieoffiziere
dazu einlud und auch sonst
niemandem den Zutritt
wehrte. Ballard und
Genossen gossen aller-
dings hinter verschlos-
senen Thüren, wie
Keller hervorhebt.
Der Guss selbst er-
folgte nach dem sog.
ver-
A
B
vielmehr zahlreiche Gruben und Vertiefungen (cham-
bres) darin, welche Gelegenheit zu Ausbrennungen
gaben und bei grösserer Tiefe die Haltbarkeit der
Rohre gefährdeten. Ausserdem wurden sie die Ur-
sache für manches Unglück, denn nach dem Ab-
feuern des Geschützes setzten sich leicht glimmende
Teile der Ladung hinein, die beim Einbringen des
nächsten Schusses diesen, trotz voraufgegangener
.Auswaschung des Rohres, entzündeten, so dass die
vor der Mündung beschäftigten Be-
dienungsleute zerrissen wurden.
Die Entstehung derartiger Gruben
kann man sich erklären, wenn man
bedenkt, dass die Hohlformen der
Rohre mit der Mündung nach oben
in der Dammgrube eingebaut und
die die Seele aus-
sparenden Kerne von
oben hineingehängt
waren. Das eingegos-
sene heisse Metall
dehnte nun die in dem
Formlehm noch vor-
handene Luftaus,diese
konnte zwar durch die
poröse Aussenform entwei-
chen, im Kern war dies aber
nicht möglich, die Luft musste
in das Metall austreten und
erzeugte um den Kern herum
Blasen, die sich nach Ent-
fernung desselben als Gruben
darstcllten. Vielfach mag sich
auch die Luft beim Eingiessen
der Bronze um den Kern
herum gefangen haben, da
in diesem Windpfeifen nicht
anzubringen waren. Dieser
Uebelstand, welcher vor-
zugsweise zur Bean-
standung der Rohre
führte, veranlasste
die Gebrüder Keller
A
A
zur Einführung eines
eigentümlichenGiess-
verfahrens, welches
Keller kurz andeutet: «Diese Art des Gusses von Ge-
schützen besteht darin, dass man sie durch den Boden
giesst, anstatt sie wie früher durch die Mündung zu
giessen, aber sie ist viel schwieriger, als die vordem
geübte, denn man muss ausserordentliche Kosten auf-
wenden, eine grössere Menge Metall eingiessen und die
Stücke an mehreren Stellen mit der Säge bearbeiten,
während an den nach alter Art gegossenen nur ein
einziger kleiner Sägeschnitt notwendig war.» Diese
neue Erfindung soll niemals vor Keller von einem
Giesser angewandt- worden, noch damals anderswo
in Gebrauch gekommen sein wegen ihrer Schwierig-
keit. Dafür hat man sie aber in neuester Zeit noch
«Verfahren mit verlorener Form», wie es heute bei
Bildwerken noch allgemein üblich ist, und zwar goss
man über einen Kern, brauchte also das Rohr nicht
auszubohren.1) Von einem Nachbohren der Seele
ist an keiner Stelle etwas erwähnt, dürfte auch nach
dem folgenden unwahrscheinlich sein.
Die Flauptschwierigkeit des Geschützgusses be-
stand nämlich damals darin, dass die Seele kaum
vollständig glatt herzustellen war, es bildeten sich
i) Aus einer andern Originalquelle sei hier entnommen,
dass im Giesshause zu Berlin zuerst im Jahre 1755 eine
leichte 12 pfündige Probekanone von Wetzel massiv ge-
bohrt wurde.
25