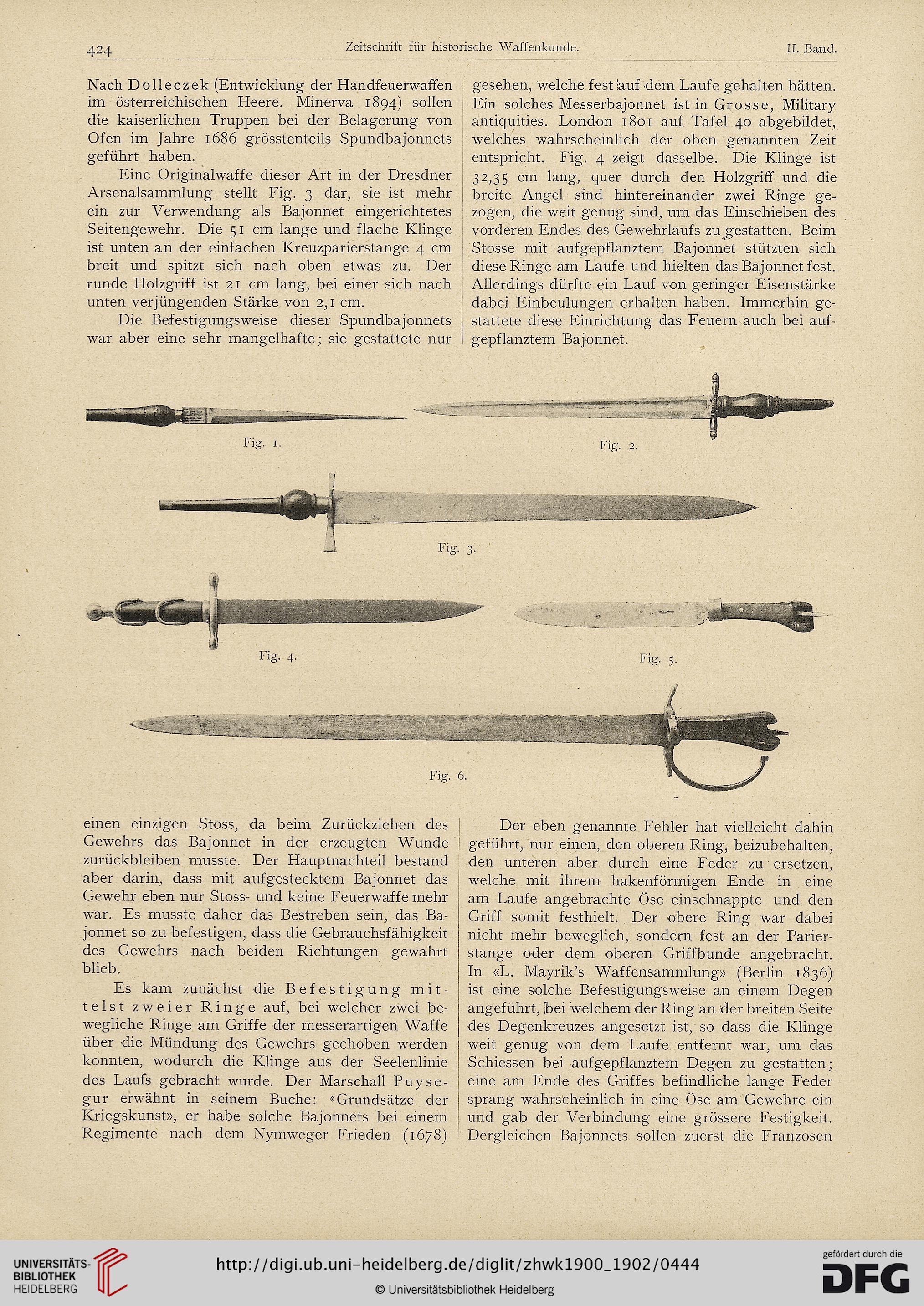424
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
II. Band.
Nach Dolleczek (Entwicklung der Handfeuerwaffen
im österreichischen Heere. Minerva 1894) sollen
die kaiserlichen Truppen bei der Belagerung von
Ofen im Jahre 1686 grösstenteils Spundbajonnets
geführt haben.
Eine Originalwaffe dieser Art in der Dresdner
Arsenalsammlung stellt Fig. 3 dar, sie ist mehr
ein zur Verwendung als Bajonnet eingerichtetes
Seitengewehr. Die 51 cm lange und flache Klinge
ist unten an der einfachen Kreuzparierstange 4 cm
breit und spitzt sich nach oben etwas zu. Der
runde Holzgriff ist 21 cm lang, bei einer sich nach
unten verjüngenden Stärke von 2,1 cm.
Die Befestigungsweise dieser Spundbajonnets
war aber eine sehr mangelhafte; sie gestattete nur
gesehen, welche fest lauf dem Laufe gehalten hätten.
Ein solches Messerbajonnet ist in Grosse, Military
antiquities. London 1801 auf, Tafel 40 abgebildet,
welches wahrscheinlich der oben genannten Zeit
entspricht. Fig. 4 zeigt dasselbe. Die Klinge ist
32,35 cm lang, quer durch den Holzgriff und die
breite Angel sind hintereinander zwei Ringe ge-
zogen, die weit genug sind, um das Einschieben des
vorderen Endes des Gewehrlaufs zu gestatten. Beim
Stosse mit aufgepflanztem Bajonnet stützten sich
diese Ringe am Laufe und hielten das Bajonnet fest.
Allerdings dürfte ein Lauf von geringer Eisenstärke
dabei Einbeulungen erhalten haben. Immerhin ge-
stattete diese Einrichtung das Feuern auch bei auf-
gepflanztem Bajonnet.
einen einzigen Stoss, da beim Zurückziehen des
Gewehrs das Bajonnet in der erzeugten Wunde
Zurückbleiben musste. Der Hauptnachteil bestand
aber darin, dass mit aufgestecktem Bajonnet das
Gewehr eben nur Stoss- und keine Feuerwaffe mehr
war. Es musste daher das Bestreben sein, das Ba-
jonnet so zu befestigen, dass die Gebrauchsfähigkeit
des Gewehrs nach beiden Richtungen gewahrt
blieb.
Es kam zunächst die Befestigung mit-
telst zweier Ringe auf, bei welcher zwei be-
wegliche Ringe am Griffe der messerartigen Waffe
über die Mündung des Gewehrs gechoben werden
konnten, wodurch die Klinge aus der Seelenlinie
des Laufs gebracht wurde. Der Marschall Puyse-
gur erwähnt in seinem Buche: «Grundsätze der
Kriegskunst», er habe solche Bajonnets bei einem
Regimente nach dem Nymweger Frieden (16.78)
Der eben genannte Fehler hat vielleicht dahin
geführt, nur einen, den oberen Ring, beizubehalten,
den unteren aber durch eine Feder zu ersetzen,
welche mit ihrem hakenförmigen Ende in eine
am Laufe angebrachte Öse einschnappte und den
Griff somit festhielt. Der obere Ring war dabei
nicht mehr beweglich, sondern fest an der Parier-
stange oder dem oberen Griffbunde angebracht.
In «L. Mayrik’s Waffensammlung» (Berlin 1836)
ist eine solche Befestigungsweise an einem Degen
angeführt, bei welchem der Ring an der breiten Seite
des Degenkreuzes angesetzt ist, so dass die Klinge
weit genug von dem Laufe entfernt war, um das
Schiessen bei aufgepflanztem Degen zu gestatten;
eine am Ende des Griffes befindliche lange Feder
sprang wahrscheinlich in eine Öse am Gewehre ein
und gab der Verbindung eine grössere Festigkeit.
Dergleichen Bajonnets sollen zuerst die Franzosen
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
II. Band.
Nach Dolleczek (Entwicklung der Handfeuerwaffen
im österreichischen Heere. Minerva 1894) sollen
die kaiserlichen Truppen bei der Belagerung von
Ofen im Jahre 1686 grösstenteils Spundbajonnets
geführt haben.
Eine Originalwaffe dieser Art in der Dresdner
Arsenalsammlung stellt Fig. 3 dar, sie ist mehr
ein zur Verwendung als Bajonnet eingerichtetes
Seitengewehr. Die 51 cm lange und flache Klinge
ist unten an der einfachen Kreuzparierstange 4 cm
breit und spitzt sich nach oben etwas zu. Der
runde Holzgriff ist 21 cm lang, bei einer sich nach
unten verjüngenden Stärke von 2,1 cm.
Die Befestigungsweise dieser Spundbajonnets
war aber eine sehr mangelhafte; sie gestattete nur
gesehen, welche fest lauf dem Laufe gehalten hätten.
Ein solches Messerbajonnet ist in Grosse, Military
antiquities. London 1801 auf, Tafel 40 abgebildet,
welches wahrscheinlich der oben genannten Zeit
entspricht. Fig. 4 zeigt dasselbe. Die Klinge ist
32,35 cm lang, quer durch den Holzgriff und die
breite Angel sind hintereinander zwei Ringe ge-
zogen, die weit genug sind, um das Einschieben des
vorderen Endes des Gewehrlaufs zu gestatten. Beim
Stosse mit aufgepflanztem Bajonnet stützten sich
diese Ringe am Laufe und hielten das Bajonnet fest.
Allerdings dürfte ein Lauf von geringer Eisenstärke
dabei Einbeulungen erhalten haben. Immerhin ge-
stattete diese Einrichtung das Feuern auch bei auf-
gepflanztem Bajonnet.
einen einzigen Stoss, da beim Zurückziehen des
Gewehrs das Bajonnet in der erzeugten Wunde
Zurückbleiben musste. Der Hauptnachteil bestand
aber darin, dass mit aufgestecktem Bajonnet das
Gewehr eben nur Stoss- und keine Feuerwaffe mehr
war. Es musste daher das Bestreben sein, das Ba-
jonnet so zu befestigen, dass die Gebrauchsfähigkeit
des Gewehrs nach beiden Richtungen gewahrt
blieb.
Es kam zunächst die Befestigung mit-
telst zweier Ringe auf, bei welcher zwei be-
wegliche Ringe am Griffe der messerartigen Waffe
über die Mündung des Gewehrs gechoben werden
konnten, wodurch die Klinge aus der Seelenlinie
des Laufs gebracht wurde. Der Marschall Puyse-
gur erwähnt in seinem Buche: «Grundsätze der
Kriegskunst», er habe solche Bajonnets bei einem
Regimente nach dem Nymweger Frieden (16.78)
Der eben genannte Fehler hat vielleicht dahin
geführt, nur einen, den oberen Ring, beizubehalten,
den unteren aber durch eine Feder zu ersetzen,
welche mit ihrem hakenförmigen Ende in eine
am Laufe angebrachte Öse einschnappte und den
Griff somit festhielt. Der obere Ring war dabei
nicht mehr beweglich, sondern fest an der Parier-
stange oder dem oberen Griffbunde angebracht.
In «L. Mayrik’s Waffensammlung» (Berlin 1836)
ist eine solche Befestigungsweise an einem Degen
angeführt, bei welchem der Ring an der breiten Seite
des Degenkreuzes angesetzt ist, so dass die Klinge
weit genug von dem Laufe entfernt war, um das
Schiessen bei aufgepflanztem Degen zu gestatten;
eine am Ende des Griffes befindliche lange Feder
sprang wahrscheinlich in eine Öse am Gewehre ein
und gab der Verbindung eine grössere Festigkeit.
Dergleichen Bajonnets sollen zuerst die Franzosen