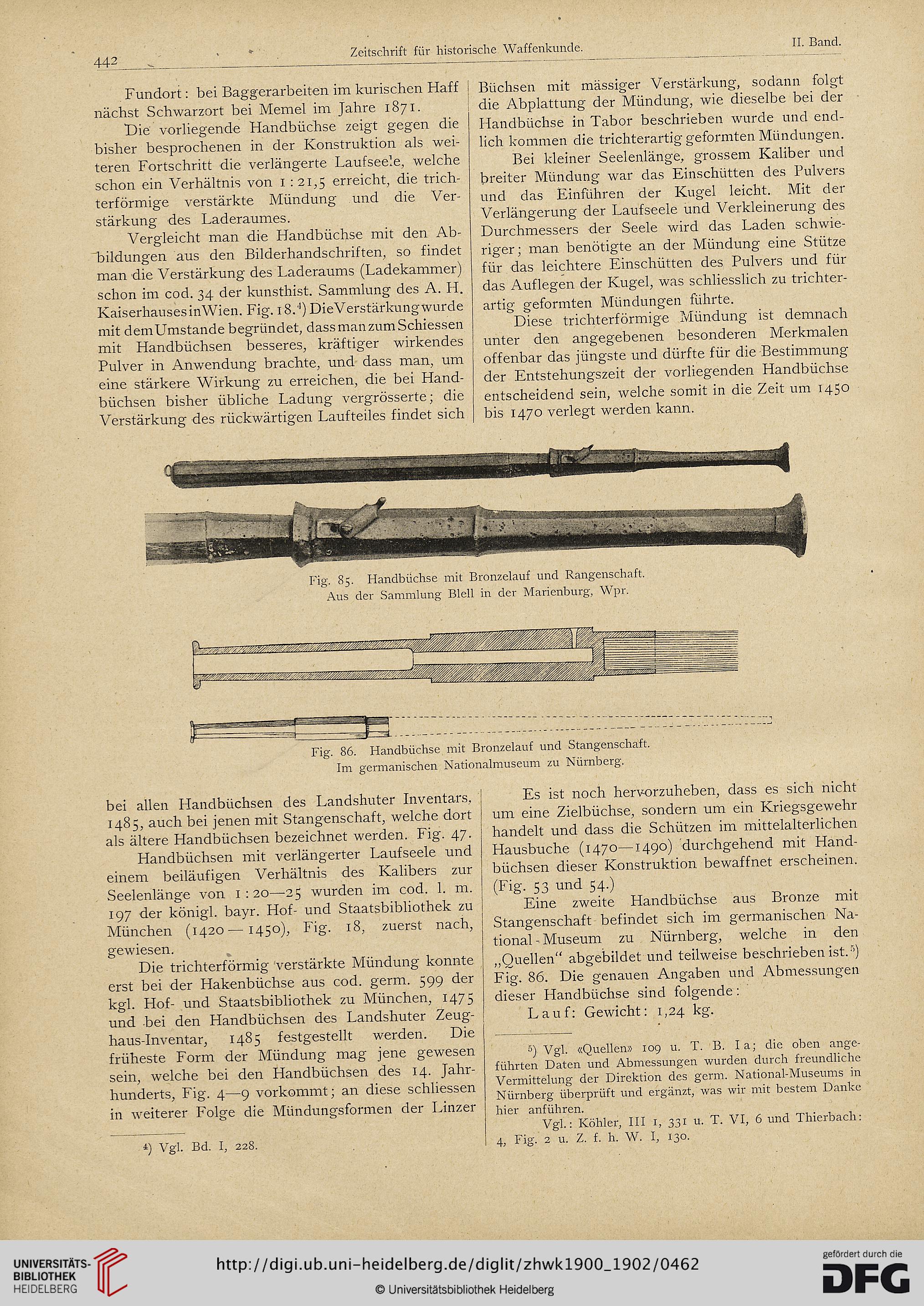442
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
II. Band.
Fundort: bei Baggerarbeiten im kurischen Haff
nächst Schwarzort bei Memel im Jahre 1871.
Hie vorliegende Handbüchse zeigt gegen die
bisher besprochenen in der Konstruktion als wei-
teren Fortschritt die verlängerte Laufseele, welche
schon ein Verhältnis von 1 :2i,5 erreicht, die trich-
terförmige verstärkte Mündung und die Ver-
stärkung des Laderaumes.
Vergleicht man die Handbüchse mit den Ab-
bildungen aus den Bilderhandschriften, so findet
man die Verstärkung des Laderaums (Ladekammer)
schon im cod. 34 der kunsthist. Sammlung des A. H.
KaiserhausesinWien. Fig. 18.* * * 4) DieVerstärkungwurde
mit demUmstande begründet, dass man zum Schiessen
mit Handbüchsen besseres, kräftiger wirkendes
Pulver in Anwendung brachte, und dass man, um
eine stärkere Wirkung zu erreichen, die bei Hand-
büchsen bisher übliche Ladung vergrösserte; die
Verstärkung des rückwärtigen Laufteiles findet sich
Büchsen mit mässiger Verstärkung, sodann folgt
die Abplattung der Mündung, wie dieselbe bei der
Handbüchse in Tabor beschrieben wurde und end-
lich kommen die trichterartig geformten Mündungen.
Bei kleiner Seelenlänge, grossem Kaliber und
breiter Mündung war das Einschütten des Pulvers
und das Einführen der Kugel leicht. Mit der
Verlängerung der Laufseele und Verkleinerung des
Durchmessers der Seele wird das Laden schwie-
riger; man benötigte an der Mündung eine Stütze
für das leichtere Einschütten des Pulvers und für
das Auflegen der Kugel, was schliesslich zu trichter-
artig geformten Mündungen führte.
Diese trichterförmige Mündung ist demnach
unter den angegebenen besonderen Merkmalen
offenbar das jüngste und dürfte für die Bestimmung
der Entstehungszeit der vorliegenden Handbüchse
entscheidend sein, welche somit in die Zeit um 1450
bis 1470 verlegt werden kann.
Fig. 85. Handbüchse mit Bronzclauf und Rangenschaft.
Aus der Sammlung Blell in der Marienburg, Wpr.
Fig. 86. Handbüchse mit Bronzelauf und Stangenschaft.
Im germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg.
bei allen Handbüchsen des Landshuter Inventars,
1485, auch bei jenen mit Stangenschaft, welche dort
als ältere Handbüchsen bezeichnet werden. Fig. 47.
Handbüchsen mit verlängerter Laufseele und
einem beiläufigen Verhältnis des Kalibers zur
Seelenlänge von 1 : 20—25 wurden im cod. 1. m.
197 der königl. bayr. Hof- und Staatsbibliothek zu
München (1420—1450), Fig. 18, zuerst nach,
gewiesen.
Die trichterförmig verstärkte Mündung konnte
erst bei der Hakenbüchse aus cod. germ. 599 der
kgl. Flof- und Staatsbibliothek zu München, 1475
und bei den Handbüchsen des Landshuter Zeug-
haus-Inventar, 1485 festgestellt werden. Die
früheste Form der Mündung mag jene gewesen
sein, welche bei den Handbüchsen des 14. Jahr-
hunderts, Fig. 4—9 vorkommt; an diese schliessen
in weiterer Folge die Mündungsformen der Linzer
Es ist noch hervorzuheben, dass es sich nicht
um eine Zielbüchse, sondern um ein Kriegsgewehr
handelt und dass die Schützen im mittelalterlichen
Hausbuche (1470--1490) durchgehend mit Hand-
büchsen dieser Konstruktion bewaffnet erscheinen.
(Fig. 53 und 54.)
Eine zweite Handbüchse aus Bronze mit
Stangenschaft befindet sich im germanischen Na-
tional - Museum zu Nürnberg, welche in den
„Quellen“ abgebildet und teilweise beschrieben ist.5)
Fig. 86. Die genauen Angaben und Abmessungen
dieser Handbüchse sind folgende:
Lauf: Gewicht: 1,24 kg.
5) Vgl. «Quellen» 109 u. T. B. I a; die oben ange-
führten Daten und Abmessungen wurden durch freundliche
Vermittelung der Direktion des germ. National-Museums in
Nürnberg überprüft und ergänzt, was wir mit bestem Danke
hier anführen.
Vgl.: Köhler, III 1, 331 u. T. VI, 6 und Thierbach:
4, Fig. 2 u. Z. f. h. W. I, 130.
4) Vgl. Bd. I, 228.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
II. Band.
Fundort: bei Baggerarbeiten im kurischen Haff
nächst Schwarzort bei Memel im Jahre 1871.
Hie vorliegende Handbüchse zeigt gegen die
bisher besprochenen in der Konstruktion als wei-
teren Fortschritt die verlängerte Laufseele, welche
schon ein Verhältnis von 1 :2i,5 erreicht, die trich-
terförmige verstärkte Mündung und die Ver-
stärkung des Laderaumes.
Vergleicht man die Handbüchse mit den Ab-
bildungen aus den Bilderhandschriften, so findet
man die Verstärkung des Laderaums (Ladekammer)
schon im cod. 34 der kunsthist. Sammlung des A. H.
KaiserhausesinWien. Fig. 18.* * * 4) DieVerstärkungwurde
mit demUmstande begründet, dass man zum Schiessen
mit Handbüchsen besseres, kräftiger wirkendes
Pulver in Anwendung brachte, und dass man, um
eine stärkere Wirkung zu erreichen, die bei Hand-
büchsen bisher übliche Ladung vergrösserte; die
Verstärkung des rückwärtigen Laufteiles findet sich
Büchsen mit mässiger Verstärkung, sodann folgt
die Abplattung der Mündung, wie dieselbe bei der
Handbüchse in Tabor beschrieben wurde und end-
lich kommen die trichterartig geformten Mündungen.
Bei kleiner Seelenlänge, grossem Kaliber und
breiter Mündung war das Einschütten des Pulvers
und das Einführen der Kugel leicht. Mit der
Verlängerung der Laufseele und Verkleinerung des
Durchmessers der Seele wird das Laden schwie-
riger; man benötigte an der Mündung eine Stütze
für das leichtere Einschütten des Pulvers und für
das Auflegen der Kugel, was schliesslich zu trichter-
artig geformten Mündungen führte.
Diese trichterförmige Mündung ist demnach
unter den angegebenen besonderen Merkmalen
offenbar das jüngste und dürfte für die Bestimmung
der Entstehungszeit der vorliegenden Handbüchse
entscheidend sein, welche somit in die Zeit um 1450
bis 1470 verlegt werden kann.
Fig. 85. Handbüchse mit Bronzclauf und Rangenschaft.
Aus der Sammlung Blell in der Marienburg, Wpr.
Fig. 86. Handbüchse mit Bronzelauf und Stangenschaft.
Im germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg.
bei allen Handbüchsen des Landshuter Inventars,
1485, auch bei jenen mit Stangenschaft, welche dort
als ältere Handbüchsen bezeichnet werden. Fig. 47.
Handbüchsen mit verlängerter Laufseele und
einem beiläufigen Verhältnis des Kalibers zur
Seelenlänge von 1 : 20—25 wurden im cod. 1. m.
197 der königl. bayr. Hof- und Staatsbibliothek zu
München (1420—1450), Fig. 18, zuerst nach,
gewiesen.
Die trichterförmig verstärkte Mündung konnte
erst bei der Hakenbüchse aus cod. germ. 599 der
kgl. Flof- und Staatsbibliothek zu München, 1475
und bei den Handbüchsen des Landshuter Zeug-
haus-Inventar, 1485 festgestellt werden. Die
früheste Form der Mündung mag jene gewesen
sein, welche bei den Handbüchsen des 14. Jahr-
hunderts, Fig. 4—9 vorkommt; an diese schliessen
in weiterer Folge die Mündungsformen der Linzer
Es ist noch hervorzuheben, dass es sich nicht
um eine Zielbüchse, sondern um ein Kriegsgewehr
handelt und dass die Schützen im mittelalterlichen
Hausbuche (1470--1490) durchgehend mit Hand-
büchsen dieser Konstruktion bewaffnet erscheinen.
(Fig. 53 und 54.)
Eine zweite Handbüchse aus Bronze mit
Stangenschaft befindet sich im germanischen Na-
tional - Museum zu Nürnberg, welche in den
„Quellen“ abgebildet und teilweise beschrieben ist.5)
Fig. 86. Die genauen Angaben und Abmessungen
dieser Handbüchse sind folgende:
Lauf: Gewicht: 1,24 kg.
5) Vgl. «Quellen» 109 u. T. B. I a; die oben ange-
führten Daten und Abmessungen wurden durch freundliche
Vermittelung der Direktion des germ. National-Museums in
Nürnberg überprüft und ergänzt, was wir mit bestem Danke
hier anführen.
Vgl.: Köhler, III 1, 331 u. T. VI, 6 und Thierbach:
4, Fig. 2 u. Z. f. h. W. I, 130.
4) Vgl. Bd. I, 228.