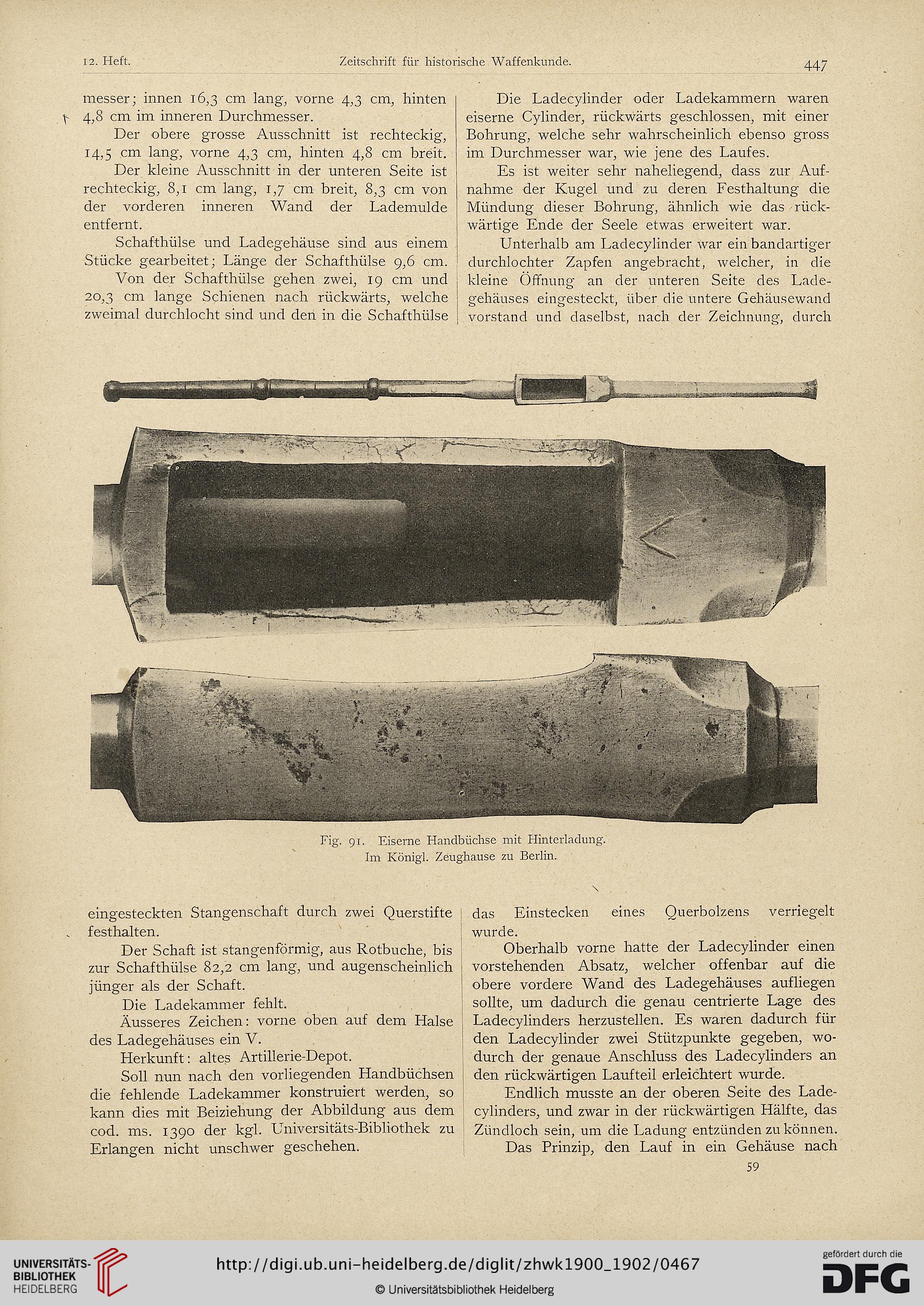Verein für Historische Waffenkunde [Hrsg.]; Verein für Historische Waffenkunde [Mitarb.]
Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde: Organ des Vereins für Historische Waffenkunde
— 2.1900-1902
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.37716#0467
DOI Heft:
Heft 12
DOI Artikel:Sixl, P.: Entwicklung und Gebrauch der Handfeuerwaffen, [18]
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.37716#0467
12. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
447
messer; innen 16,3 cm lang, vorne 4,3 cm, hinten
V 4,8 cm im inneren Durchmesser.
Der obere grosse Ausschnitt ist rechteckig,
14,5 cm lang, vorne 4,3 cm, hinten 4,8 cm breit.
Der kleine Ausschnitt in der unteren Seite ist
rechteckig, 8,1 cm lang, 1,7'cm- breit, 8,3 cm von
der vorderen inneren Wand der Lademulde
entfernt.
Schafthülse und Ladegehäuse sind aus einem
Stücke gearbeitet; Länge der Schafthülse 9,6 cm.
Von der Schafthülse gehen zwei, 19 cm und
20,3 cm lange Schienen nach rückwärts, welche
zweimal durchlocht sind und den in die Schafthülse
Die Ladecylinder oder Ladekammern waren
eiserne Cylinder, rückwärts geschlossen, mit einer
Bohrung, welche sehr wahrscheinlich ebenso gross
im Durchmesser war, wie jene des Laufes.
Es ist weiter sehr naheliegend, dass zur Auf-
nahme der Kugel und zu deren Festhaltung die
Mündung dieser Bohrung, ähnlich wie das rück-
wärtige Ende der Seele etwas erweitert war.
Unterhalb am Ladecylinder war ein bandartiger
durchlochter Zapfen angebracht, welcher, in die
kleine Öffnung an der unteren Seite des Lade-
gehäuses eingesteckt, über die untere Gehäusewand
Vorstand und daselbst, nach der Zeichnung, durch
Fig. 91. Eiserne Handbüchse mit Hinterladung.
Im König!. Zeughause zu Berlin.
eingesteckten Stangenschaft durch zwei Querstifte
festhalten.
Der Schaft ist stangenförmig, aus Rotbuche, bis
zur Schafthülse 82,2 cm lang, und augenscheinlich
jünger als der Schaft.
Die Ladekammer fehlt.
Äusseres Zeichen: vorne oben auf dem Halse
des Ladegehäuses ein V.
Herkunft: altes Artillerie-Depot.
Soll nun nach den vorliegenden Handbüchsen
die fehlende Ladekammer konstruiert werden, so
kann dies mit Beiziehung der Abbildung aus dem
cod. ms. 1390 der kgl. Universitäts-Bibliothek zu
Erlangen nicht unschwer geschehen.
das Einstecken eines Querbolzens verriegelt
wurde.
Oberhalb vorne hatte der Ladecylinder einen
vorstehenden Absatz, welcher offenbar auf die
obere vordere Wand des Ladegehäuses aufliegen
sollte, um dadurch die genau centrierte Lage des
Ladecylinders herzustellen. Es waren dadurch für
den Ladecylinder zwei Stützpunkte gegeben, wo-
durch der genaue Anschluss des Ladecylinders an
den rückwärtigen Laufteil erleichtert wurde.
Endlich musste an der oberen Seite des Lade-
cylinders, und zwar in der rückwärtigen Hälfte, das
Zündloch sein, um die Ladung entzünden zu können.
Das Prinzip, den Lauf in ein Gehäuse nach
59
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
447
messer; innen 16,3 cm lang, vorne 4,3 cm, hinten
V 4,8 cm im inneren Durchmesser.
Der obere grosse Ausschnitt ist rechteckig,
14,5 cm lang, vorne 4,3 cm, hinten 4,8 cm breit.
Der kleine Ausschnitt in der unteren Seite ist
rechteckig, 8,1 cm lang, 1,7'cm- breit, 8,3 cm von
der vorderen inneren Wand der Lademulde
entfernt.
Schafthülse und Ladegehäuse sind aus einem
Stücke gearbeitet; Länge der Schafthülse 9,6 cm.
Von der Schafthülse gehen zwei, 19 cm und
20,3 cm lange Schienen nach rückwärts, welche
zweimal durchlocht sind und den in die Schafthülse
Die Ladecylinder oder Ladekammern waren
eiserne Cylinder, rückwärts geschlossen, mit einer
Bohrung, welche sehr wahrscheinlich ebenso gross
im Durchmesser war, wie jene des Laufes.
Es ist weiter sehr naheliegend, dass zur Auf-
nahme der Kugel und zu deren Festhaltung die
Mündung dieser Bohrung, ähnlich wie das rück-
wärtige Ende der Seele etwas erweitert war.
Unterhalb am Ladecylinder war ein bandartiger
durchlochter Zapfen angebracht, welcher, in die
kleine Öffnung an der unteren Seite des Lade-
gehäuses eingesteckt, über die untere Gehäusewand
Vorstand und daselbst, nach der Zeichnung, durch
Fig. 91. Eiserne Handbüchse mit Hinterladung.
Im König!. Zeughause zu Berlin.
eingesteckten Stangenschaft durch zwei Querstifte
festhalten.
Der Schaft ist stangenförmig, aus Rotbuche, bis
zur Schafthülse 82,2 cm lang, und augenscheinlich
jünger als der Schaft.
Die Ladekammer fehlt.
Äusseres Zeichen: vorne oben auf dem Halse
des Ladegehäuses ein V.
Herkunft: altes Artillerie-Depot.
Soll nun nach den vorliegenden Handbüchsen
die fehlende Ladekammer konstruiert werden, so
kann dies mit Beiziehung der Abbildung aus dem
cod. ms. 1390 der kgl. Universitäts-Bibliothek zu
Erlangen nicht unschwer geschehen.
das Einstecken eines Querbolzens verriegelt
wurde.
Oberhalb vorne hatte der Ladecylinder einen
vorstehenden Absatz, welcher offenbar auf die
obere vordere Wand des Ladegehäuses aufliegen
sollte, um dadurch die genau centrierte Lage des
Ladecylinders herzustellen. Es waren dadurch für
den Ladecylinder zwei Stützpunkte gegeben, wo-
durch der genaue Anschluss des Ladecylinders an
den rückwärtigen Laufteil erleichtert wurde.
Endlich musste an der oberen Seite des Lade-
cylinders, und zwar in der rückwärtigen Hälfte, das
Zündloch sein, um die Ladung entzünden zu können.
Das Prinzip, den Lauf in ein Gehäuse nach
59