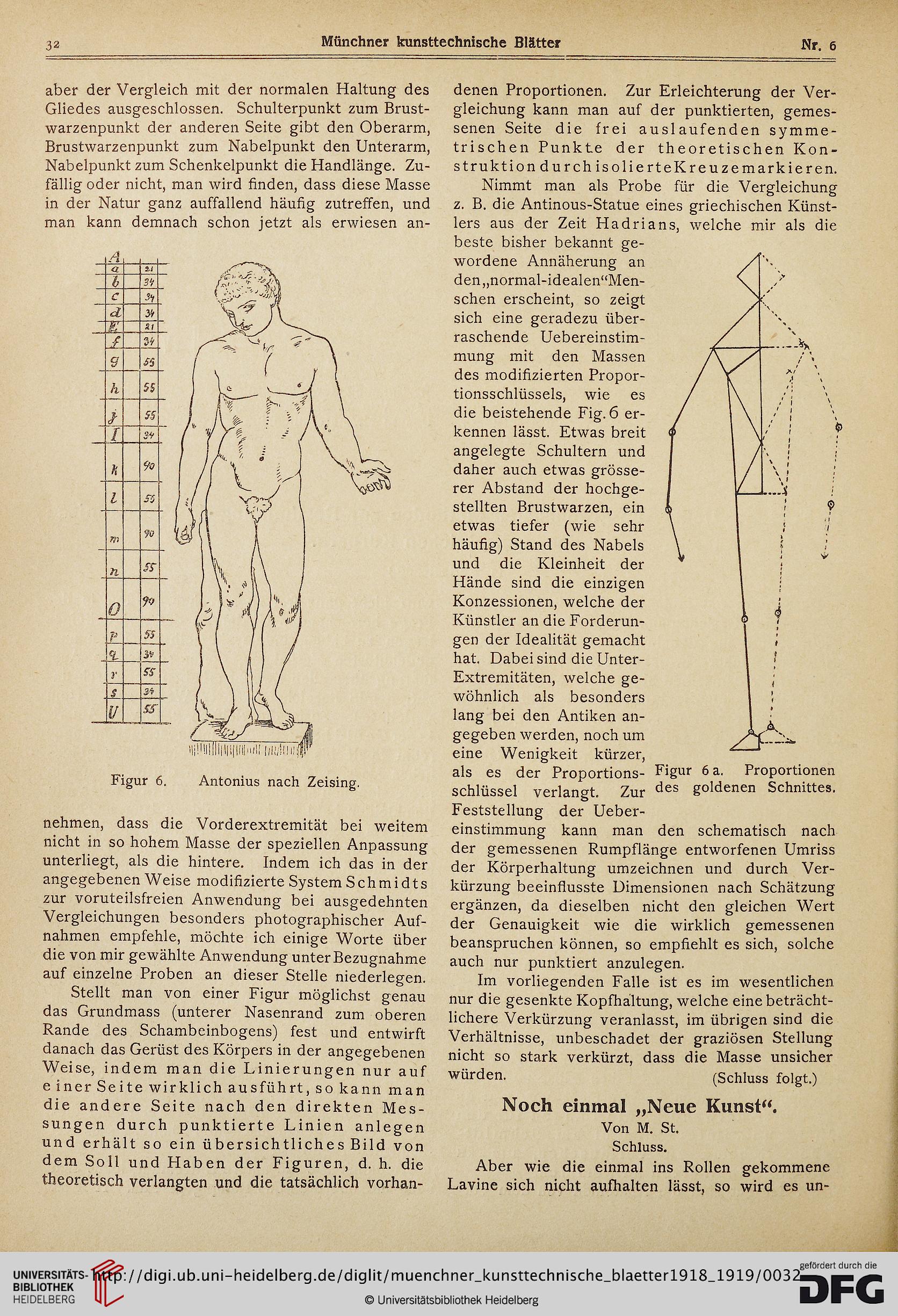32
Münchner kunsttechnische Blätter
Nr 6
aber der Vergleich mit der normalen Haltung des
Gliedes ausgeschlossen. Schulterpunkt zum Brust-
warzenpunkt der anderen Seite gibt den Oberarm,
Brustwarzenpunkt zum Nabelpunkt den Unterarm,
Nabelpunkt zum Schenkelpunkt die Handlänge. Zu-
fällig oder nicht, man wird Anden, dass diese Masse
in der Natur ganz auffallend häufig zutreffen, und
man kann demnach schon jetzt als erwiesen an-
nehmen, dass die Vorderextremität bei weitem
nicht in so hohem Masse der speziellen Anpassung
unterliegt, als die hintere. Indem ich das in der
angegebenen Weise modifizierte System Schmidts
zur voruteilsfreien Anwendung bei ausgedehnten
Vergleichungen besonders photographischer Auf-
nahmen empfehle, möchte ich einige Worte über
die von mir gewählte Anwendung unter Bezugnahme
auf einzelne Proben an dieser Stelle niederlegen.
Stellt man von einer Figur möglichst genau
das Grundmass (unterer Nasenrand zum oberen
Rande des Schambeinbogens) fest und entwirft
danach das Gerüst des Körpers in der angegebenen
Weise, indem man die Linierungen nur auf
e iner Seite wirklich ausführt, so kann man
die andere Seite nach den direkten Mes-
sungen durch punktierte Linien anlegen
und erhält so ein übersichtlichesBild von
dem Soll und Haben der Figuren, d. h. die
theoretisch verlangten und die tatsächlich vorhan-
denen Proportionen. Zur Erleichterung der Ver-
gleichung kann man auf der punktierten, gemes-
senen Seite die frei auslaufenden symme-
trischen Punkte der theoretischen Kon-
struktion durch isolierteKreuzemarkieren.
Nimmt man als Probe für die Vergleichung
z. B. die Antinous-Statue eines griechischen Künst-
lers aus der Zeit Hadrians, welche mir als die
beste bisher bekannt ge-
wordene Annäherung an
den„norma!-idealen"Men-
schen erscheint, so zeigt
sich eine geradezu über-
raschende Uebereinstim-
mung mit den Massen
des modiAzierten Propor-
tionsschlüssels, wie es
die beistehende Fig. 6 er-
kennen lässt. Etwas breit
angelegte Schultern und
daher auch etwas grösse-
rer Abstand der hochge-
stellten Brustwarzen, ein
etwas tiefer (wie sehr
häuAg) Stand des Nabels
und die Kleinheit der
Hände sind die einzigen
Konzessionen, welche der
Künstler an die Forderun-
gen der Idealität gemacht
hat. Dabei sind die Unter-
Extremitäten, welche ge-
wöhnlich als besonders
lang bei den Antiken an-
gegeben werden, noch um
eine Wenigkeit kürzer,
als es der Proportions- Figur 6 a.
Schlüssel verlangt. Zur
Feststellung der Ueber-
einstimmung kann man
Proportionen
des goldenen Schnittes.
den schematisch nach
der gemessenen Rumpfiänge entworfenen Umriss
der Körperhaltung umzeichnen und durch Ver-
kürzung beeinAusste Dimensionen nach Schätzung
ergänzen, da dieselben nicht den gleichen Wert
der Genauigkeit wie die wirklich gemessenen
beanspruchen können, so empAehlt es sich, solche
auch nur punktiert anzulegen.
Im vorliegenden Falle ist es im wesentlichen
nur die gesenkte Kopfhaltung, welche eine beträcht-
lichere Verkürzung veranlasst, im übrigen sind die
Verhältnisse, unbeschadet der graziösen Stellung
nicht so stark verkürzt, dass die Masse unsicher
würden. (Schluss folgt.)
Noch einmal „Neue Kunst".
Von M. St.
Schluss.
Aber wie die einmal ins Rollen gekommene
Lavine sich nicht aufhalten lässt, so wird es un-
Münchner kunsttechnische Blätter
Nr 6
aber der Vergleich mit der normalen Haltung des
Gliedes ausgeschlossen. Schulterpunkt zum Brust-
warzenpunkt der anderen Seite gibt den Oberarm,
Brustwarzenpunkt zum Nabelpunkt den Unterarm,
Nabelpunkt zum Schenkelpunkt die Handlänge. Zu-
fällig oder nicht, man wird Anden, dass diese Masse
in der Natur ganz auffallend häufig zutreffen, und
man kann demnach schon jetzt als erwiesen an-
nehmen, dass die Vorderextremität bei weitem
nicht in so hohem Masse der speziellen Anpassung
unterliegt, als die hintere. Indem ich das in der
angegebenen Weise modifizierte System Schmidts
zur voruteilsfreien Anwendung bei ausgedehnten
Vergleichungen besonders photographischer Auf-
nahmen empfehle, möchte ich einige Worte über
die von mir gewählte Anwendung unter Bezugnahme
auf einzelne Proben an dieser Stelle niederlegen.
Stellt man von einer Figur möglichst genau
das Grundmass (unterer Nasenrand zum oberen
Rande des Schambeinbogens) fest und entwirft
danach das Gerüst des Körpers in der angegebenen
Weise, indem man die Linierungen nur auf
e iner Seite wirklich ausführt, so kann man
die andere Seite nach den direkten Mes-
sungen durch punktierte Linien anlegen
und erhält so ein übersichtlichesBild von
dem Soll und Haben der Figuren, d. h. die
theoretisch verlangten und die tatsächlich vorhan-
denen Proportionen. Zur Erleichterung der Ver-
gleichung kann man auf der punktierten, gemes-
senen Seite die frei auslaufenden symme-
trischen Punkte der theoretischen Kon-
struktion durch isolierteKreuzemarkieren.
Nimmt man als Probe für die Vergleichung
z. B. die Antinous-Statue eines griechischen Künst-
lers aus der Zeit Hadrians, welche mir als die
beste bisher bekannt ge-
wordene Annäherung an
den„norma!-idealen"Men-
schen erscheint, so zeigt
sich eine geradezu über-
raschende Uebereinstim-
mung mit den Massen
des modiAzierten Propor-
tionsschlüssels, wie es
die beistehende Fig. 6 er-
kennen lässt. Etwas breit
angelegte Schultern und
daher auch etwas grösse-
rer Abstand der hochge-
stellten Brustwarzen, ein
etwas tiefer (wie sehr
häuAg) Stand des Nabels
und die Kleinheit der
Hände sind die einzigen
Konzessionen, welche der
Künstler an die Forderun-
gen der Idealität gemacht
hat. Dabei sind die Unter-
Extremitäten, welche ge-
wöhnlich als besonders
lang bei den Antiken an-
gegeben werden, noch um
eine Wenigkeit kürzer,
als es der Proportions- Figur 6 a.
Schlüssel verlangt. Zur
Feststellung der Ueber-
einstimmung kann man
Proportionen
des goldenen Schnittes.
den schematisch nach
der gemessenen Rumpfiänge entworfenen Umriss
der Körperhaltung umzeichnen und durch Ver-
kürzung beeinAusste Dimensionen nach Schätzung
ergänzen, da dieselben nicht den gleichen Wert
der Genauigkeit wie die wirklich gemessenen
beanspruchen können, so empAehlt es sich, solche
auch nur punktiert anzulegen.
Im vorliegenden Falle ist es im wesentlichen
nur die gesenkte Kopfhaltung, welche eine beträcht-
lichere Verkürzung veranlasst, im übrigen sind die
Verhältnisse, unbeschadet der graziösen Stellung
nicht so stark verkürzt, dass die Masse unsicher
würden. (Schluss folgt.)
Noch einmal „Neue Kunst".
Von M. St.
Schluss.
Aber wie die einmal ins Rollen gekommene
Lavine sich nicht aufhalten lässt, so wird es un-