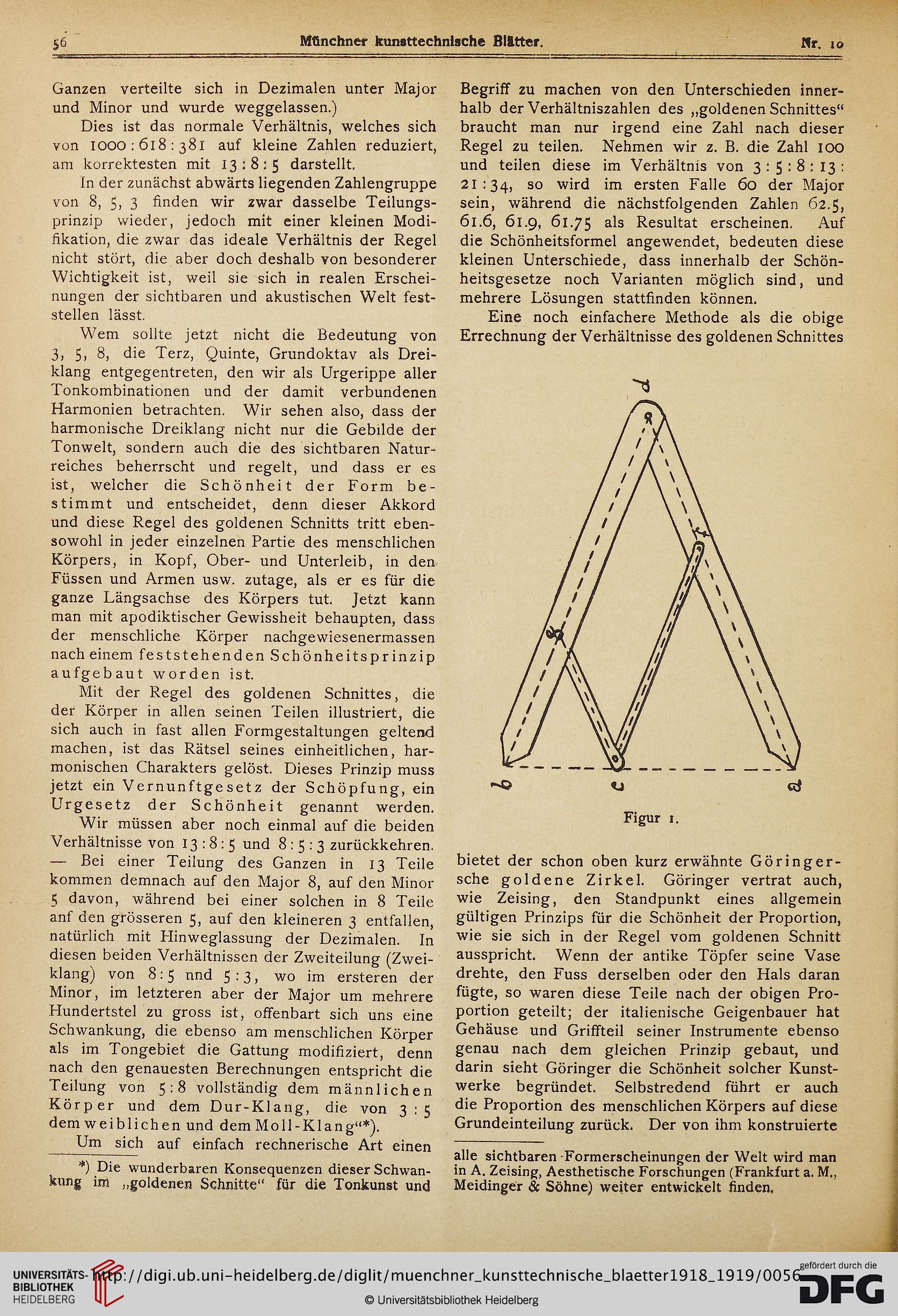Münchner kunattechnische BUttcf.
Kr. io
^6
Ganzen verteilte sich in Dezimaien unter Major
und Minor und wurde weggelassen.)
Dies ist das normale Verhältnis, weiches sich
von 1000:618:381 auf kieine Zahlen reduziert,
am korrektesten mit Iß: 8:$ darsteiit.
in der zunächst abwärts liegenden Zahlengruppe
von 8, ß, ß finden wir zwar dasselbe Teilungs-
prinzip wieder, jedoch mit einer kleinen Modi-
fikation, die zwar das ideale Verhältnis der Regel
nicht stört, die aber doch deshalb von besonderer
Wichtigkeit ist, weil sie sich in realen Erschei-
nungen der sichtbaren und akustischen Welt fest-
stellen lässt.
Wem sollte jetzt nicht die Bedeutung von
ß, $, 8, die Terz, Quinte, Grundoktav als Drei-
klang entgegentreten, den wir als Urgerippe aller
Tonkombinationen und der damit verbundenen
Harmonien betrachten. Wir sehen also, dass der
harmonische Dreiklang nicht nur die Gebilde der
Tonwelt, sondern auch die des sichtbaren Natur-
reiches beherrscht und regelt, und dass er es
ist, welcher die Schönheit der Form be-
stimmt und entscheidet, denn dieser Akkord
und diese Regel des goldenen Schnitts tritt eben-
sowohl in jeder einzelnen Partie des menschlichen
Körpers, in Kopf, Ober- und Unterleib, in den
Füssen und Armen usw. zutage, als er es für die
ganze Längsachse des Körpers tut. Jetzt kann
man mit apodiktischer Gewissheit behaupten, dass
der menschliche Körper nachgewiesenermassen
nach einem feststehenden Schönheitsprinzip
aufgebaut worden ist.
Mit der Regel des goldenen Schnittes, die
der Körper in allen seinen Teilen illustriert, die
sich auch in fast allen Formgestaltungen geltend
machen, ist das Rätsel seines einheitlichen, har-
monischen Charakters gelöst. Dieses Prinzip muss
jetzt ein Vernunftgesetz der Schöpfung, ein
Urgesetz der Schönheit genannt werden.
Wir müssen aber noch einmal auf die beiden
Verhältnisse von Iß : 8 : $ und 8 : $ : ß zurückkehren.
— Bei einer Teilung des Ganzen in iß Teile
kommen demnach auf den Major 8, auf den Minor
$ davon, während bei einer solchen in 8 Teile
anf den grösseren $, auf den kleineren ß entfallen,
natürlich mit Hinweglassung der Dezimalen. In
diesen beiden Verhältnissen der Zweiteilung (Zwei-
klang) von 8: $ und ß:ß, wo im ersteren der
Minor, im letzteren aber der Major um mehrere
Hundertstel zu gross ist, offenbart sich uns eine
Schwankung, die ebenso am menschlichen Körper
als im Tongebiet die Gattung modifiziert, denn
nach den genauesten Berechnungen entspricht die
Teilung von ß:8 vollständig dem männlichen
Körper und dem Dur-Klang, die von ß:$
demweiblichen und demMoll-Klang"*).
Um sich auf einfach rechnerische Art einen
*) Die wunderbaren Konsequenzen dieser Schwan-
kung im „goldenen Schnitte" für die Tonkunst und
Begriff zu machen von den Unterschieden inner-
halb der Verhältniszahlen des „goldenen Schnittes"
braucht man nur irgend eine Zahl nach dieser
Regel zu teilen. Nehmen wir z. B. die Zahl 100
und teilen diese im Verhältnis von 3 : $ : 8 : Iß :
21:34, so wird im ersten Falle 60 der Major
sein, während die nächstfolgenden Zahlen 62.$,
61.6, 61.9, 61.7$ als Resultat erscheinen. Auf
die Schönheitsformel angewendet, bedeuten diese
kleinen Unterschiede, dass innerhalb der Schön-
heitsgesetze noch Varianten möglich sind, und
mehrere Lösungen stattfinden können.
Eine noch einfachere Methode als die obige
Errechnung der Verhältnisse des goldenen Schnittes
"3
bietet der schon oben kurz erwähnte Göringer-
sche goldene Zirkel. Göringer vertrat auch,
wie Zeising, den Standpunkt eines allgemein
gültigen Prinzips für die Schönheit der Proportion,
wie sie sich in der Regel vom goldenen Schnitt
ausspricht. Wenn der antike Töpfer seine Vase
drehte, den Fuss derselben oder den Hals daran
fügte, so waren diese Teile nach der obigen Pro-
portion geteilt; der italienische Geigenbauer hat
Gehäuse und Griffteil seiner Instrumente ebenso
genau nach dem gleichen Prinzip gebaut, und
darin sieht Göringer die Schönheit solcher Kunst-
werke begründet. Selbstredend führt er auch
die Proportion des menschlichen Körpers auf diese
Grundeinteilung zurück. Der von ihm konstruierte
alle sichtbaren Formerscheinungen der Welt wird man
in A. Zeising, Aesthetische Forschungen (Frankfurt a. M.,
Meidinger & Söhne) weiter entwickelt finden.
Kr. io
^6
Ganzen verteilte sich in Dezimaien unter Major
und Minor und wurde weggelassen.)
Dies ist das normale Verhältnis, weiches sich
von 1000:618:381 auf kieine Zahlen reduziert,
am korrektesten mit Iß: 8:$ darsteiit.
in der zunächst abwärts liegenden Zahlengruppe
von 8, ß, ß finden wir zwar dasselbe Teilungs-
prinzip wieder, jedoch mit einer kleinen Modi-
fikation, die zwar das ideale Verhältnis der Regel
nicht stört, die aber doch deshalb von besonderer
Wichtigkeit ist, weil sie sich in realen Erschei-
nungen der sichtbaren und akustischen Welt fest-
stellen lässt.
Wem sollte jetzt nicht die Bedeutung von
ß, $, 8, die Terz, Quinte, Grundoktav als Drei-
klang entgegentreten, den wir als Urgerippe aller
Tonkombinationen und der damit verbundenen
Harmonien betrachten. Wir sehen also, dass der
harmonische Dreiklang nicht nur die Gebilde der
Tonwelt, sondern auch die des sichtbaren Natur-
reiches beherrscht und regelt, und dass er es
ist, welcher die Schönheit der Form be-
stimmt und entscheidet, denn dieser Akkord
und diese Regel des goldenen Schnitts tritt eben-
sowohl in jeder einzelnen Partie des menschlichen
Körpers, in Kopf, Ober- und Unterleib, in den
Füssen und Armen usw. zutage, als er es für die
ganze Längsachse des Körpers tut. Jetzt kann
man mit apodiktischer Gewissheit behaupten, dass
der menschliche Körper nachgewiesenermassen
nach einem feststehenden Schönheitsprinzip
aufgebaut worden ist.
Mit der Regel des goldenen Schnittes, die
der Körper in allen seinen Teilen illustriert, die
sich auch in fast allen Formgestaltungen geltend
machen, ist das Rätsel seines einheitlichen, har-
monischen Charakters gelöst. Dieses Prinzip muss
jetzt ein Vernunftgesetz der Schöpfung, ein
Urgesetz der Schönheit genannt werden.
Wir müssen aber noch einmal auf die beiden
Verhältnisse von Iß : 8 : $ und 8 : $ : ß zurückkehren.
— Bei einer Teilung des Ganzen in iß Teile
kommen demnach auf den Major 8, auf den Minor
$ davon, während bei einer solchen in 8 Teile
anf den grösseren $, auf den kleineren ß entfallen,
natürlich mit Hinweglassung der Dezimalen. In
diesen beiden Verhältnissen der Zweiteilung (Zwei-
klang) von 8: $ und ß:ß, wo im ersteren der
Minor, im letzteren aber der Major um mehrere
Hundertstel zu gross ist, offenbart sich uns eine
Schwankung, die ebenso am menschlichen Körper
als im Tongebiet die Gattung modifiziert, denn
nach den genauesten Berechnungen entspricht die
Teilung von ß:8 vollständig dem männlichen
Körper und dem Dur-Klang, die von ß:$
demweiblichen und demMoll-Klang"*).
Um sich auf einfach rechnerische Art einen
*) Die wunderbaren Konsequenzen dieser Schwan-
kung im „goldenen Schnitte" für die Tonkunst und
Begriff zu machen von den Unterschieden inner-
halb der Verhältniszahlen des „goldenen Schnittes"
braucht man nur irgend eine Zahl nach dieser
Regel zu teilen. Nehmen wir z. B. die Zahl 100
und teilen diese im Verhältnis von 3 : $ : 8 : Iß :
21:34, so wird im ersten Falle 60 der Major
sein, während die nächstfolgenden Zahlen 62.$,
61.6, 61.9, 61.7$ als Resultat erscheinen. Auf
die Schönheitsformel angewendet, bedeuten diese
kleinen Unterschiede, dass innerhalb der Schön-
heitsgesetze noch Varianten möglich sind, und
mehrere Lösungen stattfinden können.
Eine noch einfachere Methode als die obige
Errechnung der Verhältnisse des goldenen Schnittes
"3
bietet der schon oben kurz erwähnte Göringer-
sche goldene Zirkel. Göringer vertrat auch,
wie Zeising, den Standpunkt eines allgemein
gültigen Prinzips für die Schönheit der Proportion,
wie sie sich in der Regel vom goldenen Schnitt
ausspricht. Wenn der antike Töpfer seine Vase
drehte, den Fuss derselben oder den Hals daran
fügte, so waren diese Teile nach der obigen Pro-
portion geteilt; der italienische Geigenbauer hat
Gehäuse und Griffteil seiner Instrumente ebenso
genau nach dem gleichen Prinzip gebaut, und
darin sieht Göringer die Schönheit solcher Kunst-
werke begründet. Selbstredend führt er auch
die Proportion des menschlichen Körpers auf diese
Grundeinteilung zurück. Der von ihm konstruierte
alle sichtbaren Formerscheinungen der Welt wird man
in A. Zeising, Aesthetische Forschungen (Frankfurt a. M.,
Meidinger & Söhne) weiter entwickelt finden.