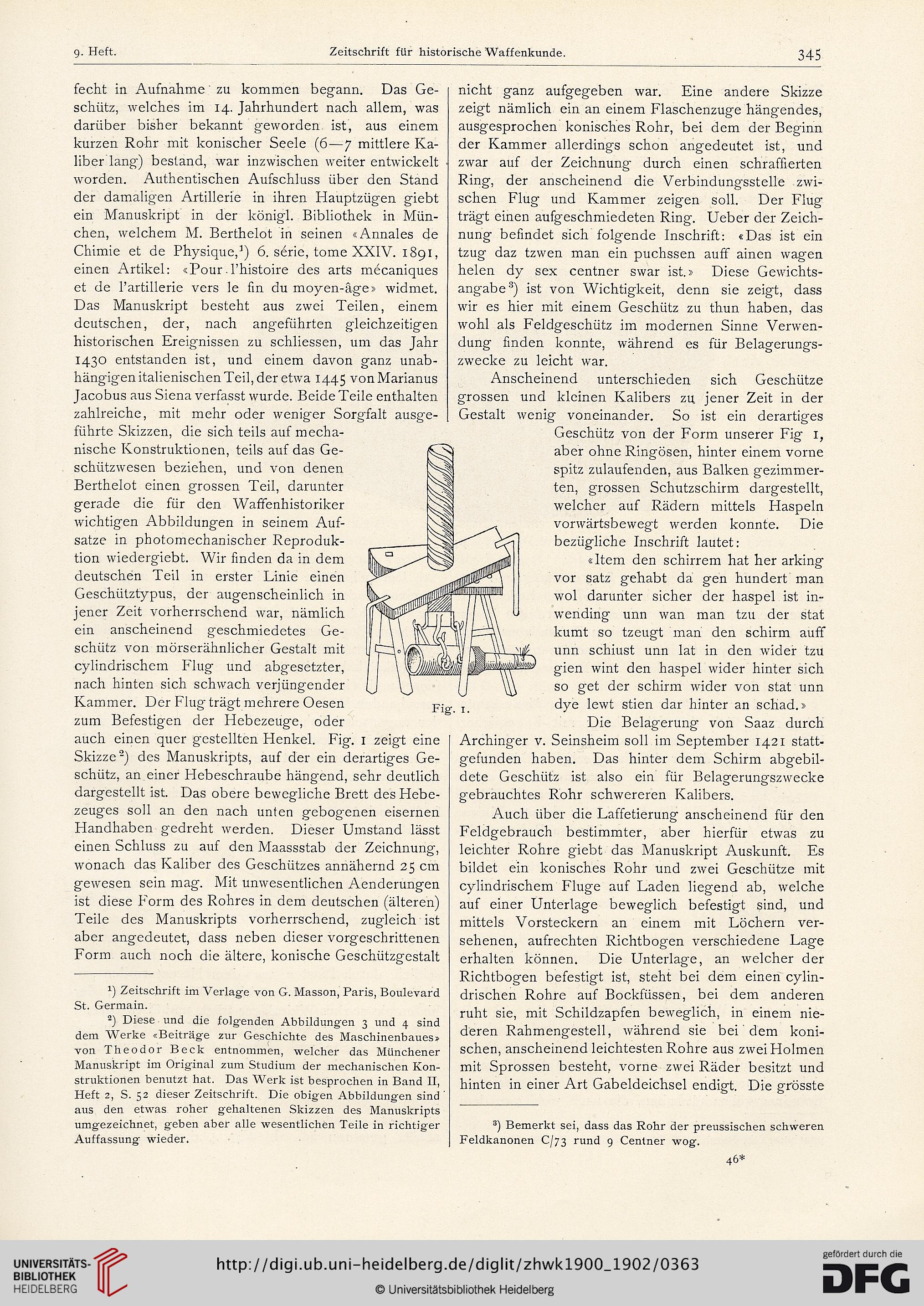g. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
345
fecht in Aufnahme zu kommen begann. Das Ge-
schütz, welches im 14. Jahrhundert nach allem, was
darüber bisher bekannt geworden ist, aus einem
kurzen Rohr mit konischer Seele (6—7 mittlere Ka-
liber lang) bestand, war inzwischen weiter entwickelt
worden. Authentischen Aufschluss über den Stand
der damaligen Artillerie in ihren Hauptzügen giebt
ein Manuskript in der königl. Bibliothek in Mün-
chen, welchem M. Berthelot in seinen «Annales de
Chimie et de Physique,1) 6. Serie, tome XXIV. 1891,
einen Artikel: «Pour l’histoire des arts mecaniques
et de rartillerie vers le fin du moyen-äge» widmet.
Das Manuskript besteht aus zwei Teilen, einem
deutschen, der, nach angeführten gleichzeitigen
historischen Ereignissen zu schliessen, um das Jahr
1430 entstanden ist, und einem davon ganz unab-
hängigenitalienischenTeiljderetwa 1445 von Marianus
Jacobus aus Siena verfasst wurde. Beide Teile enthalten
zahlreiche, mit mehr oder weniger Sorgfalt ausge-
führte Skizzen, die sich teils auf mecha-
nische Konstruktionen, teils auf das Ge-
schützwesen beziehen, und von denen
Berthelot einen grossen Teil, darunter
gerade die für den Waffenhistoriker
wichtigen Abbildungen in seinem Auf-
sätze in photomechanischer Reproduk-
tion wiedergiebt. Wir finden da in dem
deutschen Teil in erster Linie einen
Geschütztypus, der augenscheinlich in
jener Zeit vorherrschend war, nämlich
ein anscheinend geschmiedetes Ge-
schütz von mörserähnlicher Gestalt mit
cylindrischem Flug und abgesetzter,
nach hinten sich schwach verjüngender
Kammer. Der Flug trägt mehrere Oesen
zum Befestigen der Hebezeuge, oder
auch einen quer gestellten Henkel. Fig. 1 zeigt eine
Skizze2 * * * * *) des Manuskripts, auf der ein derartiges Ge-
schütz, an einer Hebeschraube hängend, sehr deutlich
dargestellt ist. Das obere bewegliche Brett des Hebe-
zeuges soll an den nach unten gebogenen eisernen
Handhaben gedreht werden. Dieser Umstand lässt
einen Schluss zu auf den Maassstab der Zeichnung,
wonach das Kaliber des Geschützes annähernd 25 cm
gewesen sein mag. Mit unwesentlichen Aenderungen
ist diese Form des Rohres in dem deutschen (älteren)
Teile des Manuskripts vorherrschend, zugleich ist
aber angedeutet, dass neben dieser vorgeschrittenen
Form auch noch die ältere, konische Geschützgestalt
1) Zeitschrift im Verlage von G. Masson, Paris, Boulevard
St. Germain.
2) Diese und die folgenden Abbildungen 3 und 4 sind
dem Werke «Beiträge zur Geschichte des Maschinenbaues»
von Theodor Beck entnommen, welcher das Münchener
Manuskript im Original zum Studium der mechanischen Kon-
struktionen benutzt hat. Das Werk ist besprochen in Band II,
Heft 2, S. 52 dieser Zeitschrift. Die obigen Abbildungen sind
aus den etwas roher gehaltenen Skizzen des Manuskripts
umgezeichnet, geben aber alle wesentlichen Teile in richtiger
Auffassung wieder.
nicht ganz aufgegeben war. Eine andere Skizze
zeigt nämlich ein an einem Flaschenzuge hängendes,
ausgesprochen konisches Rohr, bei dem der Beginn
der Kammer allerdings schon angedeutet ist, und
zwar auf der Zeichnung durch einen schraffierten
Ring, der anscheinend die Verbindungsstelle zwi-
schen Flug und Kammer zeigen soll. Der Flug
trägt einen aufgeschmiedeten Ring. Ueber der Zeich-
nung befindet sich folgende Inschrift: «Das ist ein
tzug daz tzwen man ein puchssen auff ainen wagen
helen dy sex centner swar ist.» Diese Gewichts-
angabe8) ist von Wichtigkeit, denn sie zeigt, dass
wir es hier mit einem Geschütz zu thun haben, das
wohl als Feldgeschütz im modernen Sinne Verwen-
dung finden konnte, während es für Belagerungs-
zwecke zu leicht war.
Anscheinend unterschieden sich Geschütze
grossen und kleinen Kalibers zu jener Zeit in der
Gestalt wenig voneinander. So ist ein derartiges
Geschütz von der Form unserer Fig 1,
aber ohne Ringösen, hinter einem vorne
spitz zulaufenden, aus Balken gezimmer-
ten, grossen Schutzschirm dargestellt,
welcher auf Rädern mittels Haspeln
vorwärtsbewegt werden konnte. Die
bezügliche Inschrift lautet:
«Item den schirrem hat her arking
vor satz gehabt da gen hundert man
wol darunter sicher der haspel ist in-
wending unn wan man tzu der stat
kumt so tzeugt man den schirm auff
unn schiust unn lat in den wider tzu
gien wint den haspel wider hinter sich
so get der schirm wider von stat unn
dye lewt stien dar hinter an schad.»
Die Belagerung von Saaz durch
Archinger v. Seinsheim soll im September 1421 statt-
gefunden haben. Das hinter dem Schirm abgebil-
dete Geschütz ist also ein für Belagerungszwecke
gebrauchtes Rohr schwereren Kalibers.
Auch über die Laffetierung anscheinend für den
Feldgebrauch bestimmter, aber hierfür etwas zu
leichter Rohre giebt das Manuskript Auskunft. Es
bildet ein konisches Rohr und zwei Geschütze mit
cylindrischem Fluge auf Laden liegend ab, welche
auf einer Unterlage beweglich befestigt sind, und
mittels Vorsteckern an einem mit Löchern ver-
sehenen, aufrechten Richtbogen verschiedene Lage
erhalten können. Die Unterlage, an welcher der
Richtbogen befestigt ist, steht bei dem einen cylin-
drischen Rohre auf Bockfüssen, bei dem anderen
ruht sie, mit Schildzapfen beweglich, in einem nie-
deren Rahmengestell, während sie bei dem koni-
schen, anscheinend leichtesten Rohre aus zwei Holmen
mit Sprossen besteht, vorne zwei Räder besitzt und
hinten in einer Art Gabeldeichsel endigt. Die grösste
3) Bemerkt sei, dass das Rohr der preussischen schweren
Feldkanonen C/73 rund 9 Centner wog\
46*
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
345
fecht in Aufnahme zu kommen begann. Das Ge-
schütz, welches im 14. Jahrhundert nach allem, was
darüber bisher bekannt geworden ist, aus einem
kurzen Rohr mit konischer Seele (6—7 mittlere Ka-
liber lang) bestand, war inzwischen weiter entwickelt
worden. Authentischen Aufschluss über den Stand
der damaligen Artillerie in ihren Hauptzügen giebt
ein Manuskript in der königl. Bibliothek in Mün-
chen, welchem M. Berthelot in seinen «Annales de
Chimie et de Physique,1) 6. Serie, tome XXIV. 1891,
einen Artikel: «Pour l’histoire des arts mecaniques
et de rartillerie vers le fin du moyen-äge» widmet.
Das Manuskript besteht aus zwei Teilen, einem
deutschen, der, nach angeführten gleichzeitigen
historischen Ereignissen zu schliessen, um das Jahr
1430 entstanden ist, und einem davon ganz unab-
hängigenitalienischenTeiljderetwa 1445 von Marianus
Jacobus aus Siena verfasst wurde. Beide Teile enthalten
zahlreiche, mit mehr oder weniger Sorgfalt ausge-
führte Skizzen, die sich teils auf mecha-
nische Konstruktionen, teils auf das Ge-
schützwesen beziehen, und von denen
Berthelot einen grossen Teil, darunter
gerade die für den Waffenhistoriker
wichtigen Abbildungen in seinem Auf-
sätze in photomechanischer Reproduk-
tion wiedergiebt. Wir finden da in dem
deutschen Teil in erster Linie einen
Geschütztypus, der augenscheinlich in
jener Zeit vorherrschend war, nämlich
ein anscheinend geschmiedetes Ge-
schütz von mörserähnlicher Gestalt mit
cylindrischem Flug und abgesetzter,
nach hinten sich schwach verjüngender
Kammer. Der Flug trägt mehrere Oesen
zum Befestigen der Hebezeuge, oder
auch einen quer gestellten Henkel. Fig. 1 zeigt eine
Skizze2 * * * * *) des Manuskripts, auf der ein derartiges Ge-
schütz, an einer Hebeschraube hängend, sehr deutlich
dargestellt ist. Das obere bewegliche Brett des Hebe-
zeuges soll an den nach unten gebogenen eisernen
Handhaben gedreht werden. Dieser Umstand lässt
einen Schluss zu auf den Maassstab der Zeichnung,
wonach das Kaliber des Geschützes annähernd 25 cm
gewesen sein mag. Mit unwesentlichen Aenderungen
ist diese Form des Rohres in dem deutschen (älteren)
Teile des Manuskripts vorherrschend, zugleich ist
aber angedeutet, dass neben dieser vorgeschrittenen
Form auch noch die ältere, konische Geschützgestalt
1) Zeitschrift im Verlage von G. Masson, Paris, Boulevard
St. Germain.
2) Diese und die folgenden Abbildungen 3 und 4 sind
dem Werke «Beiträge zur Geschichte des Maschinenbaues»
von Theodor Beck entnommen, welcher das Münchener
Manuskript im Original zum Studium der mechanischen Kon-
struktionen benutzt hat. Das Werk ist besprochen in Band II,
Heft 2, S. 52 dieser Zeitschrift. Die obigen Abbildungen sind
aus den etwas roher gehaltenen Skizzen des Manuskripts
umgezeichnet, geben aber alle wesentlichen Teile in richtiger
Auffassung wieder.
nicht ganz aufgegeben war. Eine andere Skizze
zeigt nämlich ein an einem Flaschenzuge hängendes,
ausgesprochen konisches Rohr, bei dem der Beginn
der Kammer allerdings schon angedeutet ist, und
zwar auf der Zeichnung durch einen schraffierten
Ring, der anscheinend die Verbindungsstelle zwi-
schen Flug und Kammer zeigen soll. Der Flug
trägt einen aufgeschmiedeten Ring. Ueber der Zeich-
nung befindet sich folgende Inschrift: «Das ist ein
tzug daz tzwen man ein puchssen auff ainen wagen
helen dy sex centner swar ist.» Diese Gewichts-
angabe8) ist von Wichtigkeit, denn sie zeigt, dass
wir es hier mit einem Geschütz zu thun haben, das
wohl als Feldgeschütz im modernen Sinne Verwen-
dung finden konnte, während es für Belagerungs-
zwecke zu leicht war.
Anscheinend unterschieden sich Geschütze
grossen und kleinen Kalibers zu jener Zeit in der
Gestalt wenig voneinander. So ist ein derartiges
Geschütz von der Form unserer Fig 1,
aber ohne Ringösen, hinter einem vorne
spitz zulaufenden, aus Balken gezimmer-
ten, grossen Schutzschirm dargestellt,
welcher auf Rädern mittels Haspeln
vorwärtsbewegt werden konnte. Die
bezügliche Inschrift lautet:
«Item den schirrem hat her arking
vor satz gehabt da gen hundert man
wol darunter sicher der haspel ist in-
wending unn wan man tzu der stat
kumt so tzeugt man den schirm auff
unn schiust unn lat in den wider tzu
gien wint den haspel wider hinter sich
so get der schirm wider von stat unn
dye lewt stien dar hinter an schad.»
Die Belagerung von Saaz durch
Archinger v. Seinsheim soll im September 1421 statt-
gefunden haben. Das hinter dem Schirm abgebil-
dete Geschütz ist also ein für Belagerungszwecke
gebrauchtes Rohr schwereren Kalibers.
Auch über die Laffetierung anscheinend für den
Feldgebrauch bestimmter, aber hierfür etwas zu
leichter Rohre giebt das Manuskript Auskunft. Es
bildet ein konisches Rohr und zwei Geschütze mit
cylindrischem Fluge auf Laden liegend ab, welche
auf einer Unterlage beweglich befestigt sind, und
mittels Vorsteckern an einem mit Löchern ver-
sehenen, aufrechten Richtbogen verschiedene Lage
erhalten können. Die Unterlage, an welcher der
Richtbogen befestigt ist, steht bei dem einen cylin-
drischen Rohre auf Bockfüssen, bei dem anderen
ruht sie, mit Schildzapfen beweglich, in einem nie-
deren Rahmengestell, während sie bei dem koni-
schen, anscheinend leichtesten Rohre aus zwei Holmen
mit Sprossen besteht, vorne zwei Räder besitzt und
hinten in einer Art Gabeldeichsel endigt. Die grösste
3) Bemerkt sei, dass das Rohr der preussischen schweren
Feldkanonen C/73 rund 9 Centner wog\
46*