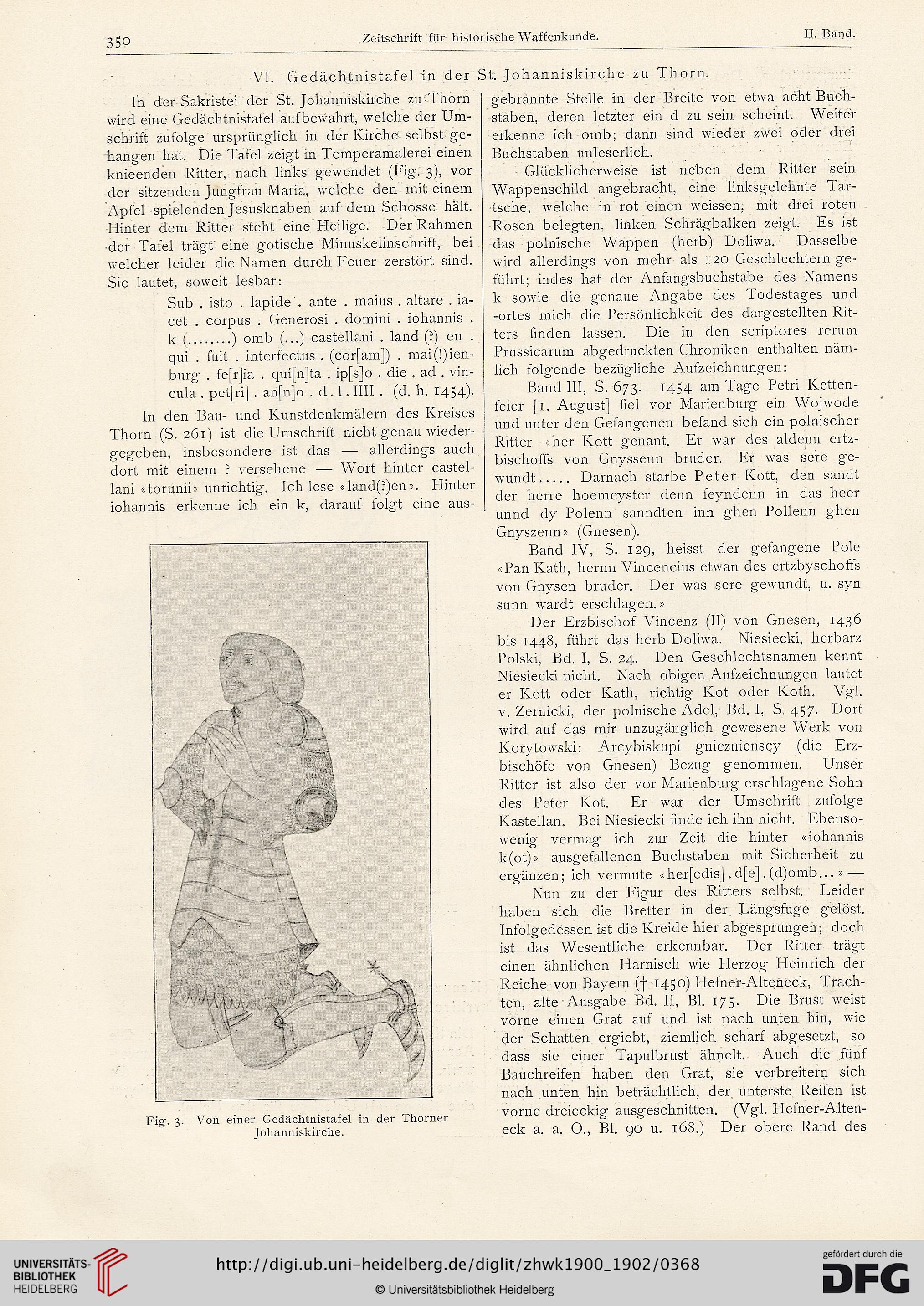35°
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
II. Bänd.
VI. Gedächtnistafel 'in der St: Johanniskirche zu Thorn.
In der Sakristei der St. Johanniskirche zu Thorn
wird eine Gedächtnistafel aufbewahrt, welche der Um-
schrift zufolge ursprünglich in der Kirche- selbst ge-
hangen hat. Die Tafel zeigt in Temperamalerei einen
knieenden Ritter, nach links gewendet (Fig. 3), vor
der sitzenden Jungfrau Maria, welche den mit einem
Apfel spielenden Jesusknaben auf dem Schosse hält.
Hinter dem Ritter steht eine Heilige. Der Rahmen
der Tafel trägt' eine gotische Minuskelinschrift, bei
welcher leider die Namen durch Feuer zerstört sind.
Sie lautet, soweit lesbar:
Sub . isto . lapide . ante . maius . altare . ia-
cet . corpus . Generosi . domini . iohannis .
k (.) omb (...) castellani . land (?) en .
qui . fuit . interfectus . (cor[am]) . mai(!)ien-
burg . fe[r]ia . qui[n]ta . ip[s]o . die . ad . vin-
cula . pct[ri] . an[n]o . d . 1. IIII . (d. h. 1454).
In den Bau- und Kunstdenkmälern des Kreises
Thorn (S. 261) ist die Umschrift nicht genau wieder-
gegeben, insbesondere ist das -— allerdings auch
dort mit einem ? versehene —- Wort hinter castel-
lani «torunii» unrichtig. Ich lese «land(?)en». Hinter
iohannis erkenne ich ein k, darauf folgt eine aus-
Fig-- 3- Von einer Gedächtnistafel in der Thorner
Johanniskirche.
gebrannte Stelle in der Breite von etwa acht Buch-
staben, deren letzter ein d zu sein scheint. Weiter
erkenne ich omb; dann sind wieder zwei oder drei
Buchstaben unleserlich.
Glücklicherweise ist neben dem Ritter sein
Wappenschild angebracht, eine linksgelehnte Tar-
tsche, welche in rot einen weissen, mit drei roten
Rosen belegten, linken Schrägbalken zeigt. Es ist
das polnische Wappen (herb) Doliwa. Dasselbe
wird allerdings von mehr als 120 Geschlechtern ge-
o o
führt; indes hat der Anfangsbuchstabe des Namens
k sowie die genaue Angabe des Todestages und
-ortes mich die Persönlichkeit des dargcstellten Rit-
ters finden lassen. Die in den scriptores rcrum
Prussicarum abgedruckten Chroniken enthalten näm-
lich folgende bezügliche Aufzeichnungen:
Band III, S. 673. 1454 am Tage Petri Ketten-
feier [1. August] fiel vor Marienburg ein Wojwode
und unter den Gefangenen befand sich ein polnischer
Ritter «her Kott genant. Er war des aldenn ertz-
bischoffs von Gnyssenn bruder. Er was scre ge-
wundt. Darnach starbe Peter Kott, den sandt
der herre hoemeyster denn feyndenn in das heer
unnd dy Polenn sanndten inn ghen Pollenn ghen
Gnyszenn» (Gnesen).
Band IV, S. 129, heisst der gefangene Pole
«Pan Kath, hernn Vincencius etwan des ertzbyschoffs
von Gnysen bruder. Der was sere gewundt, u. syn
sunn wardt erschlagen.»
Der Erzbischof Vincenz (II) von Gnesen, 1436
bis 1448, führt das herb Doliwa. Niesiecki, herbarz
Polski, Bd. I, S. 24. Den Geschlechtsnamen kennt
Niesiecki nicht. Nach obigen Aufzeichnungen lautet
er Kott oder Kath, richtig Kot oder lvoth. Vgl.
v. Zernicki, der polnische Adel, Bd. I, S. 457. Dort
wird auf das mir unzugänglich gewesene Werk von
Korytowski: Arcybiskupi gniezniensqy (die Erz-
bischöfe von Gnesen) Bezug genommen. Unser
Ritter ist also der vor Marienburg erschlagene Sohn
des Peter Kot. Er war der Umschrift zufolge
Kastellan. Bei Niesiecki finde ich ihn nicht. Ebenso-
wenig vermag ich zur Zeit die hinter «iohannis
•k(ot)> ausgefallenen Buchstaben mit Sicherheit zu
ergänzen; ich vermute «her[edis]. d[e]. (d)omb... » —
Nun zu der Figur des Ritters selbst. Leider
haben sich die Bretter in dep Längsfuge gelöst.
Infolgedessen ist die Kreide hier abgesprungen; doch
ist das Wesentliche erkennbar. Der Ritter trägt
einen ähnlichen Flämisch wie Fierzog Fleinrich der
Reiche von Bayern (f 1450) Flefner-Alteneck, Trach-
ten, alte Ausgabe Bd. II, Bl. 175. Die Brust weist
vorne einen Grat auf und ist nach unten hin, wie
der Schatten ergiebt, ziemlich scharf abgesetzt, so
dass sie einer Tapulbrust ähnelt. Auch die fünf
Bauchreifen haben den Grat, sie verbreitern sich
nach unten hin beträchtlich, der unterste Reifen ist
vorne dreieckig ausgeschnitten. (Vgl. Hefner-Alten-
eck a. a. 0., Bl. 90 u. 168.) Der obere Rand des
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
II. Bänd.
VI. Gedächtnistafel 'in der St: Johanniskirche zu Thorn.
In der Sakristei der St. Johanniskirche zu Thorn
wird eine Gedächtnistafel aufbewahrt, welche der Um-
schrift zufolge ursprünglich in der Kirche- selbst ge-
hangen hat. Die Tafel zeigt in Temperamalerei einen
knieenden Ritter, nach links gewendet (Fig. 3), vor
der sitzenden Jungfrau Maria, welche den mit einem
Apfel spielenden Jesusknaben auf dem Schosse hält.
Hinter dem Ritter steht eine Heilige. Der Rahmen
der Tafel trägt' eine gotische Minuskelinschrift, bei
welcher leider die Namen durch Feuer zerstört sind.
Sie lautet, soweit lesbar:
Sub . isto . lapide . ante . maius . altare . ia-
cet . corpus . Generosi . domini . iohannis .
k (.) omb (...) castellani . land (?) en .
qui . fuit . interfectus . (cor[am]) . mai(!)ien-
burg . fe[r]ia . qui[n]ta . ip[s]o . die . ad . vin-
cula . pct[ri] . an[n]o . d . 1. IIII . (d. h. 1454).
In den Bau- und Kunstdenkmälern des Kreises
Thorn (S. 261) ist die Umschrift nicht genau wieder-
gegeben, insbesondere ist das -— allerdings auch
dort mit einem ? versehene —- Wort hinter castel-
lani «torunii» unrichtig. Ich lese «land(?)en». Hinter
iohannis erkenne ich ein k, darauf folgt eine aus-
Fig-- 3- Von einer Gedächtnistafel in der Thorner
Johanniskirche.
gebrannte Stelle in der Breite von etwa acht Buch-
staben, deren letzter ein d zu sein scheint. Weiter
erkenne ich omb; dann sind wieder zwei oder drei
Buchstaben unleserlich.
Glücklicherweise ist neben dem Ritter sein
Wappenschild angebracht, eine linksgelehnte Tar-
tsche, welche in rot einen weissen, mit drei roten
Rosen belegten, linken Schrägbalken zeigt. Es ist
das polnische Wappen (herb) Doliwa. Dasselbe
wird allerdings von mehr als 120 Geschlechtern ge-
o o
führt; indes hat der Anfangsbuchstabe des Namens
k sowie die genaue Angabe des Todestages und
-ortes mich die Persönlichkeit des dargcstellten Rit-
ters finden lassen. Die in den scriptores rcrum
Prussicarum abgedruckten Chroniken enthalten näm-
lich folgende bezügliche Aufzeichnungen:
Band III, S. 673. 1454 am Tage Petri Ketten-
feier [1. August] fiel vor Marienburg ein Wojwode
und unter den Gefangenen befand sich ein polnischer
Ritter «her Kott genant. Er war des aldenn ertz-
bischoffs von Gnyssenn bruder. Er was scre ge-
wundt. Darnach starbe Peter Kott, den sandt
der herre hoemeyster denn feyndenn in das heer
unnd dy Polenn sanndten inn ghen Pollenn ghen
Gnyszenn» (Gnesen).
Band IV, S. 129, heisst der gefangene Pole
«Pan Kath, hernn Vincencius etwan des ertzbyschoffs
von Gnysen bruder. Der was sere gewundt, u. syn
sunn wardt erschlagen.»
Der Erzbischof Vincenz (II) von Gnesen, 1436
bis 1448, führt das herb Doliwa. Niesiecki, herbarz
Polski, Bd. I, S. 24. Den Geschlechtsnamen kennt
Niesiecki nicht. Nach obigen Aufzeichnungen lautet
er Kott oder Kath, richtig Kot oder lvoth. Vgl.
v. Zernicki, der polnische Adel, Bd. I, S. 457. Dort
wird auf das mir unzugänglich gewesene Werk von
Korytowski: Arcybiskupi gniezniensqy (die Erz-
bischöfe von Gnesen) Bezug genommen. Unser
Ritter ist also der vor Marienburg erschlagene Sohn
des Peter Kot. Er war der Umschrift zufolge
Kastellan. Bei Niesiecki finde ich ihn nicht. Ebenso-
wenig vermag ich zur Zeit die hinter «iohannis
•k(ot)> ausgefallenen Buchstaben mit Sicherheit zu
ergänzen; ich vermute «her[edis]. d[e]. (d)omb... » —
Nun zu der Figur des Ritters selbst. Leider
haben sich die Bretter in dep Längsfuge gelöst.
Infolgedessen ist die Kreide hier abgesprungen; doch
ist das Wesentliche erkennbar. Der Ritter trägt
einen ähnlichen Flämisch wie Fierzog Fleinrich der
Reiche von Bayern (f 1450) Flefner-Alteneck, Trach-
ten, alte Ausgabe Bd. II, Bl. 175. Die Brust weist
vorne einen Grat auf und ist nach unten hin, wie
der Schatten ergiebt, ziemlich scharf abgesetzt, so
dass sie einer Tapulbrust ähnelt. Auch die fünf
Bauchreifen haben den Grat, sie verbreitern sich
nach unten hin beträchtlich, der unterste Reifen ist
vorne dreieckig ausgeschnitten. (Vgl. Hefner-Alten-
eck a. a. 0., Bl. 90 u. 168.) Der obere Rand des