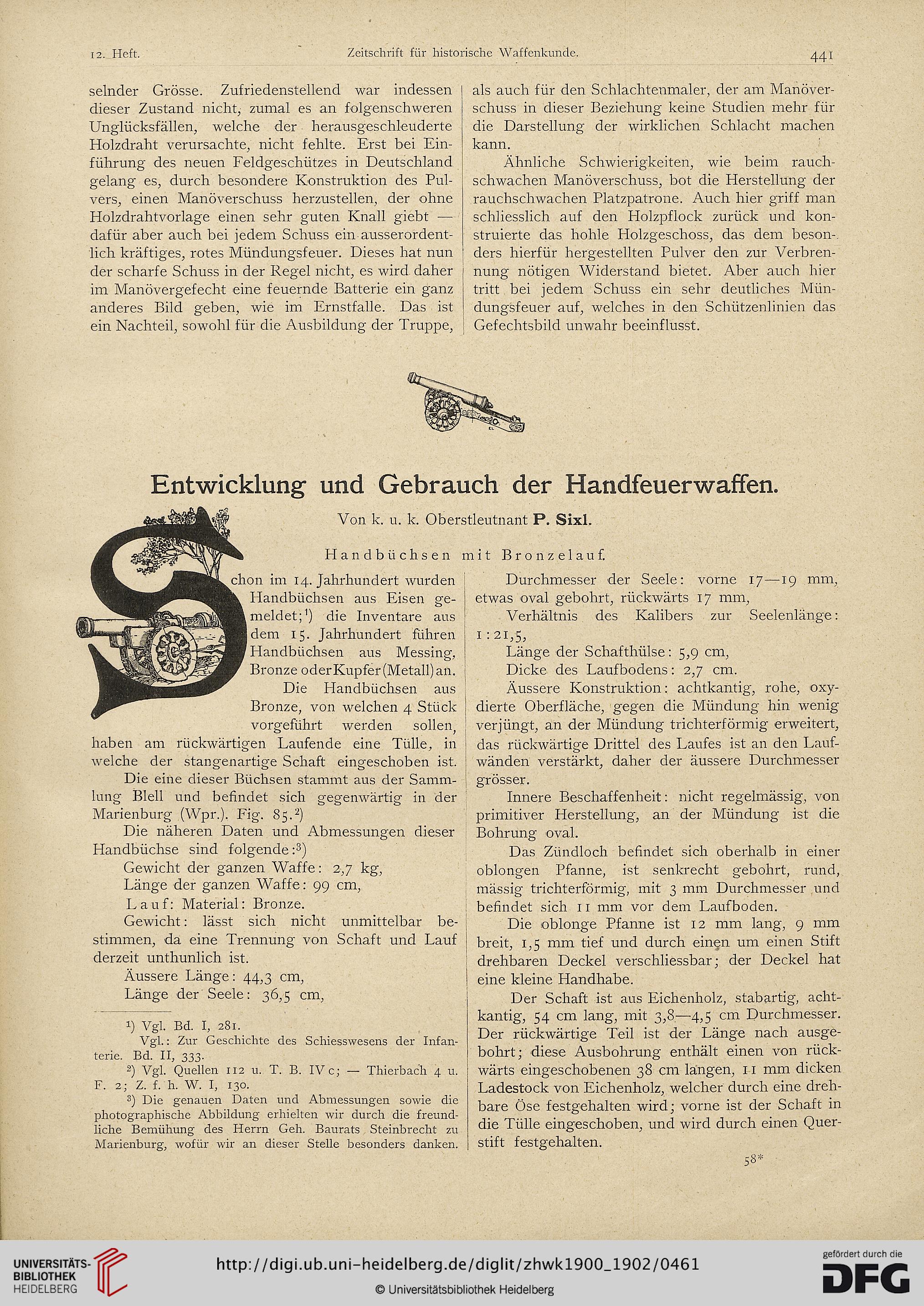12. Heft.
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
44I
selnder Grösse. Zufriedenstellend war indessen
dieser Zustand nicht, zumal es an folgenschweren
Unglücksfällen, welche der herausgeschleuderte
Holzdraht verursachte, nicht fehlte. Erst bei Ein-
führung des neuen Feldgeschützes in Deutschland
gelang es, durch besondere Konstruktion des Pul-
vers, einen Manöverschuss herzustellen, der ohne
Holzdrahtvorlage einen sehr guten Knall giebt —
dafür aber auch bei jedem Schuss ein ausserordent-
lich kräftiges, rotes Mündungsfeuer. Dieses hat nun
der scharfe Schuss in der Regel nicht, es wird daher
im Manövergefecht eine feuernde Batterie ein ganz
anderes Bild geben, wie im Ernstfälle. Das ist
ein Nachteil, sowohl für die Ausbildung der Truppe,
als auch für den Schlachtenmaler, der am Manöver-
schuss in dieser Beziehung keine Studien mehr für
die Darstellung der wirklichen Schlacht machen
kann.
Ähnliche Schwierigkeiten, wie beim rauch-
schwachen Manöverschuss, bot die Herstellung der
rauchschwachen Platzpatrone. Auch hier griff man
schliesslich auf den Holzpflock zurück und kon-
struierte das hohle Holzgeschoss, das dem beson-
ders hierfür hergestellten Pulver den zur Verbren-
nung nötigen Widerstand bietet. Aber auch hier
tritt bei jedem Schuss ein sehr deutliches Mün-
dungsfeuer auf, welches in den Schützenlinien das
Gefechtsbild unwahr beeinflusst.
Entwicklung und Gebrauch der Handfeuerwaffen.
Von k. u. k. Oberstleutnant P. Sixl.
Handbüchsen mit Bronzelauf.
chon im 14. Jahrhundert wurden
Handbüchsen aus Eisen ge-
meldet;1) die Inventare aus
dem 15. Jahrhundert führen
Handbüchsen aus Messing,
Bronze oder Kupfer (Metall) an.
Die Handbüchsen aus
Bronze, von welchen 4 Stück
vorgeführt werden sollen,
haben am rückwärtigen Laufende eine Tülle, in
welche der stangenartige Schaft eingeschoben ist.
Die eine dieser Büchsen stammt aus der Samm-
lung Blell und befindet sich gegenwärtig in der
Marienburg (Wpr.). Fig. 85.2)
Die näheren Daten und Abmessungen dieser
Handbüchse sind folgende :3)
Gewicht der ganzen Waffe: 2,7 kg,
Länge der ganzen Waffe: 99 cm,
Lauf: Material: Bronze.
Gewicht: lässt sich nicht unmittelbar be-
stimmen, da eine Trennung von Schaft und Lauf
derzeit unthunlich ist.
Äussere Länge: 44,3 cm,
Länge der Seele: 36,5 cm,
1) Vgl. Bd. I, 281.
Vgl.: Zur Geschichte des Schiesswesens der Infan-
terie. Bd. II, 333.
2) Vgl. Quellen 112 u. T. B. IV c; — Thierbach 4 u.
F. 2; Z. f. h. W. I, 130.
8) Die genauen Daten und Abmessungen sowie die
photographische Abbildung erhielten wir durch die freund-
liche Bemühung des Herrn Geh. Baurats Steinbrecht zu
Marienburg, wofür wir an dieser Stelle besonders danken.
Durchmesser der Seele: vorne 17—19 mm,
etwas oval gebohrt, rückwärts 17 mm,
Verhältnis des Kalibers zur Seelenlänge:
1:21,5,
Länge der Schafthülse: 5,9 cm,
Dicke des Laufbodens: 2,7 cm.
Äussere Konstruktion: achtkantig, rohe, oxy-
dierte Oberfläche, gegen die Mündung hin wenig
verjüngt, an der Mündung trichterförmig erweitert,
das rückwärtige Drittel des Laufes ist an den Lauf-
wänden verstärkt, daher der äussere Durchmesser
grösser.
Innere Beschaffenheit: nicht regelmässig, von
primitiver Herstellung, an der Mündung ist die
Bohrung oval.
Das Zündloch befindet sich oberhalb in einer
oblongen Pfanne, ist senkrecht gebohrt, rund,
massig trichterförmig, mit 3 mm Durchmesser und
befindet sich 11 mm vor dem Laufboden.
Die oblonge Pfanne ist 12 mm lang, 9 mm
breit, 1,5 mm tief und durch einen um einen Stift
drehbaren Deckel verschliessbar; der Deckel hat
eine kleine Handhabe.
Der Schaft ist aus Eichenholz, stabartig, acht-
kantig, 54 cm lang, mit 3,8.—4,5 cm Durchmesser.
Der rückwärtige Teil ist der Länge nach ausge-
bohrt; diese Ausbohrung enthält einen von rück-
wärts eingeschobenen 38 cm langen, 11 mm dicken
Ladestock von Eichenholz, welcher durch eine dreh-
bare Öse festgehalten wird; vorne ist der Schaft in
die Tülle eingeschoben, und wird durch einen Quer-
stift festgehalten.
58*
Zeitschrift für historische Waffenkunde.
44I
selnder Grösse. Zufriedenstellend war indessen
dieser Zustand nicht, zumal es an folgenschweren
Unglücksfällen, welche der herausgeschleuderte
Holzdraht verursachte, nicht fehlte. Erst bei Ein-
führung des neuen Feldgeschützes in Deutschland
gelang es, durch besondere Konstruktion des Pul-
vers, einen Manöverschuss herzustellen, der ohne
Holzdrahtvorlage einen sehr guten Knall giebt —
dafür aber auch bei jedem Schuss ein ausserordent-
lich kräftiges, rotes Mündungsfeuer. Dieses hat nun
der scharfe Schuss in der Regel nicht, es wird daher
im Manövergefecht eine feuernde Batterie ein ganz
anderes Bild geben, wie im Ernstfälle. Das ist
ein Nachteil, sowohl für die Ausbildung der Truppe,
als auch für den Schlachtenmaler, der am Manöver-
schuss in dieser Beziehung keine Studien mehr für
die Darstellung der wirklichen Schlacht machen
kann.
Ähnliche Schwierigkeiten, wie beim rauch-
schwachen Manöverschuss, bot die Herstellung der
rauchschwachen Platzpatrone. Auch hier griff man
schliesslich auf den Holzpflock zurück und kon-
struierte das hohle Holzgeschoss, das dem beson-
ders hierfür hergestellten Pulver den zur Verbren-
nung nötigen Widerstand bietet. Aber auch hier
tritt bei jedem Schuss ein sehr deutliches Mün-
dungsfeuer auf, welches in den Schützenlinien das
Gefechtsbild unwahr beeinflusst.
Entwicklung und Gebrauch der Handfeuerwaffen.
Von k. u. k. Oberstleutnant P. Sixl.
Handbüchsen mit Bronzelauf.
chon im 14. Jahrhundert wurden
Handbüchsen aus Eisen ge-
meldet;1) die Inventare aus
dem 15. Jahrhundert führen
Handbüchsen aus Messing,
Bronze oder Kupfer (Metall) an.
Die Handbüchsen aus
Bronze, von welchen 4 Stück
vorgeführt werden sollen,
haben am rückwärtigen Laufende eine Tülle, in
welche der stangenartige Schaft eingeschoben ist.
Die eine dieser Büchsen stammt aus der Samm-
lung Blell und befindet sich gegenwärtig in der
Marienburg (Wpr.). Fig. 85.2)
Die näheren Daten und Abmessungen dieser
Handbüchse sind folgende :3)
Gewicht der ganzen Waffe: 2,7 kg,
Länge der ganzen Waffe: 99 cm,
Lauf: Material: Bronze.
Gewicht: lässt sich nicht unmittelbar be-
stimmen, da eine Trennung von Schaft und Lauf
derzeit unthunlich ist.
Äussere Länge: 44,3 cm,
Länge der Seele: 36,5 cm,
1) Vgl. Bd. I, 281.
Vgl.: Zur Geschichte des Schiesswesens der Infan-
terie. Bd. II, 333.
2) Vgl. Quellen 112 u. T. B. IV c; — Thierbach 4 u.
F. 2; Z. f. h. W. I, 130.
8) Die genauen Daten und Abmessungen sowie die
photographische Abbildung erhielten wir durch die freund-
liche Bemühung des Herrn Geh. Baurats Steinbrecht zu
Marienburg, wofür wir an dieser Stelle besonders danken.
Durchmesser der Seele: vorne 17—19 mm,
etwas oval gebohrt, rückwärts 17 mm,
Verhältnis des Kalibers zur Seelenlänge:
1:21,5,
Länge der Schafthülse: 5,9 cm,
Dicke des Laufbodens: 2,7 cm.
Äussere Konstruktion: achtkantig, rohe, oxy-
dierte Oberfläche, gegen die Mündung hin wenig
verjüngt, an der Mündung trichterförmig erweitert,
das rückwärtige Drittel des Laufes ist an den Lauf-
wänden verstärkt, daher der äussere Durchmesser
grösser.
Innere Beschaffenheit: nicht regelmässig, von
primitiver Herstellung, an der Mündung ist die
Bohrung oval.
Das Zündloch befindet sich oberhalb in einer
oblongen Pfanne, ist senkrecht gebohrt, rund,
massig trichterförmig, mit 3 mm Durchmesser und
befindet sich 11 mm vor dem Laufboden.
Die oblonge Pfanne ist 12 mm lang, 9 mm
breit, 1,5 mm tief und durch einen um einen Stift
drehbaren Deckel verschliessbar; der Deckel hat
eine kleine Handhabe.
Der Schaft ist aus Eichenholz, stabartig, acht-
kantig, 54 cm lang, mit 3,8.—4,5 cm Durchmesser.
Der rückwärtige Teil ist der Länge nach ausge-
bohrt; diese Ausbohrung enthält einen von rück-
wärts eingeschobenen 38 cm langen, 11 mm dicken
Ladestock von Eichenholz, welcher durch eine dreh-
bare Öse festgehalten wird; vorne ist der Schaft in
die Tülle eingeschoben, und wird durch einen Quer-
stift festgehalten.
58*