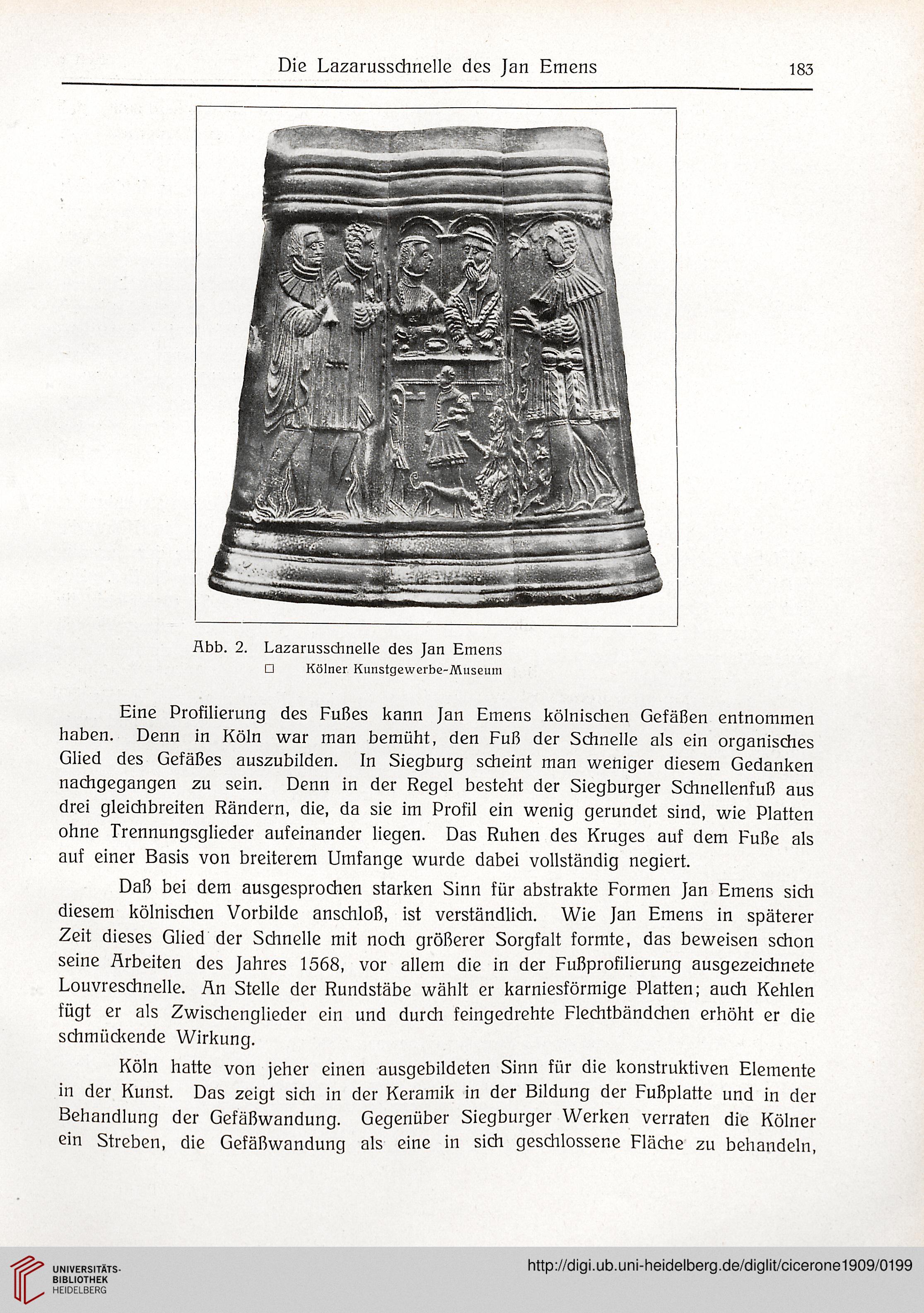Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0199
DOI Heft:
6. Heft
DOI Artikel:Lüthgen, Eugen: Die Lazarusschnelle des Jan Emens
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0199
Die Lazarusschnelle des Jan Emens
183
Äbb. 2. Lazarussdinelle des Jan Emens
□ Kölner Kunstgewerbe-Museum
Eine Profilierung des Fußes kann Jan Emens kölnischen Gefäßen entnommen
haben. Denn in Köln war man bemüht, den Fuß der Schnelle als ein organisches
Glied des Gefäßes auszubilden. In Siegburg scheint man weniger diesem Gedanken
nachgegangen zu sein. Denn in der Regel besteht der Siegburger Schnellenfuß aus
drei gleichbreiten Rändern, die, da sie im Profil ein wenig gerundet sind, wie Platten
ohne Trennungsglieder aufeinander liegen. Das Ruhen des Kruges auf dem Fuße als
auf einer Basis von breiterem Umfange wurde dabei vollständig negiert.
Daß bei dem ausgesprochen starken Sinn für abstrakte Formen Jan Emens sich
diesem kölnischen Vorbilde anschloß, ist verständlich. Wie Jan Emens in späterer
Zeit dieses Glied der Schnelle mit noch größerer Sorgfalt formte, das beweisen schon
seine Arbeiten des Jahres 1568, vor allem die in der Fußprofilierung ausgezeichnete
Louvreschnelle. An Stelle der Rundstäbe wählt er karniesförmige Platten; auch Kehlen
fügt er als Zwischenglieder ein und durch feingedrehte Flechtbändchen erhöht er die
schmückende Wirkung.
Köln hatte von jeher einen ausgebildeten Sinn für die konstruktiven Elemente
in der Kunst. Das zeigt sich in der Keramik in der Bildung der Fußplatte und in der
Behandlung der Gefäßwandung. Gegenüber Siegburger Werken verraten die Kölner
ein Streben, die Gefäßwandung als eine in sich geschlossene Fläche zu behandeln,
183
Äbb. 2. Lazarussdinelle des Jan Emens
□ Kölner Kunstgewerbe-Museum
Eine Profilierung des Fußes kann Jan Emens kölnischen Gefäßen entnommen
haben. Denn in Köln war man bemüht, den Fuß der Schnelle als ein organisches
Glied des Gefäßes auszubilden. In Siegburg scheint man weniger diesem Gedanken
nachgegangen zu sein. Denn in der Regel besteht der Siegburger Schnellenfuß aus
drei gleichbreiten Rändern, die, da sie im Profil ein wenig gerundet sind, wie Platten
ohne Trennungsglieder aufeinander liegen. Das Ruhen des Kruges auf dem Fuße als
auf einer Basis von breiterem Umfange wurde dabei vollständig negiert.
Daß bei dem ausgesprochen starken Sinn für abstrakte Formen Jan Emens sich
diesem kölnischen Vorbilde anschloß, ist verständlich. Wie Jan Emens in späterer
Zeit dieses Glied der Schnelle mit noch größerer Sorgfalt formte, das beweisen schon
seine Arbeiten des Jahres 1568, vor allem die in der Fußprofilierung ausgezeichnete
Louvreschnelle. An Stelle der Rundstäbe wählt er karniesförmige Platten; auch Kehlen
fügt er als Zwischenglieder ein und durch feingedrehte Flechtbändchen erhöht er die
schmückende Wirkung.
Köln hatte von jeher einen ausgebildeten Sinn für die konstruktiven Elemente
in der Kunst. Das zeigt sich in der Keramik in der Bildung der Fußplatte und in der
Behandlung der Gefäßwandung. Gegenüber Siegburger Werken verraten die Kölner
ein Streben, die Gefäßwandung als eine in sich geschlossene Fläche zu behandeln,