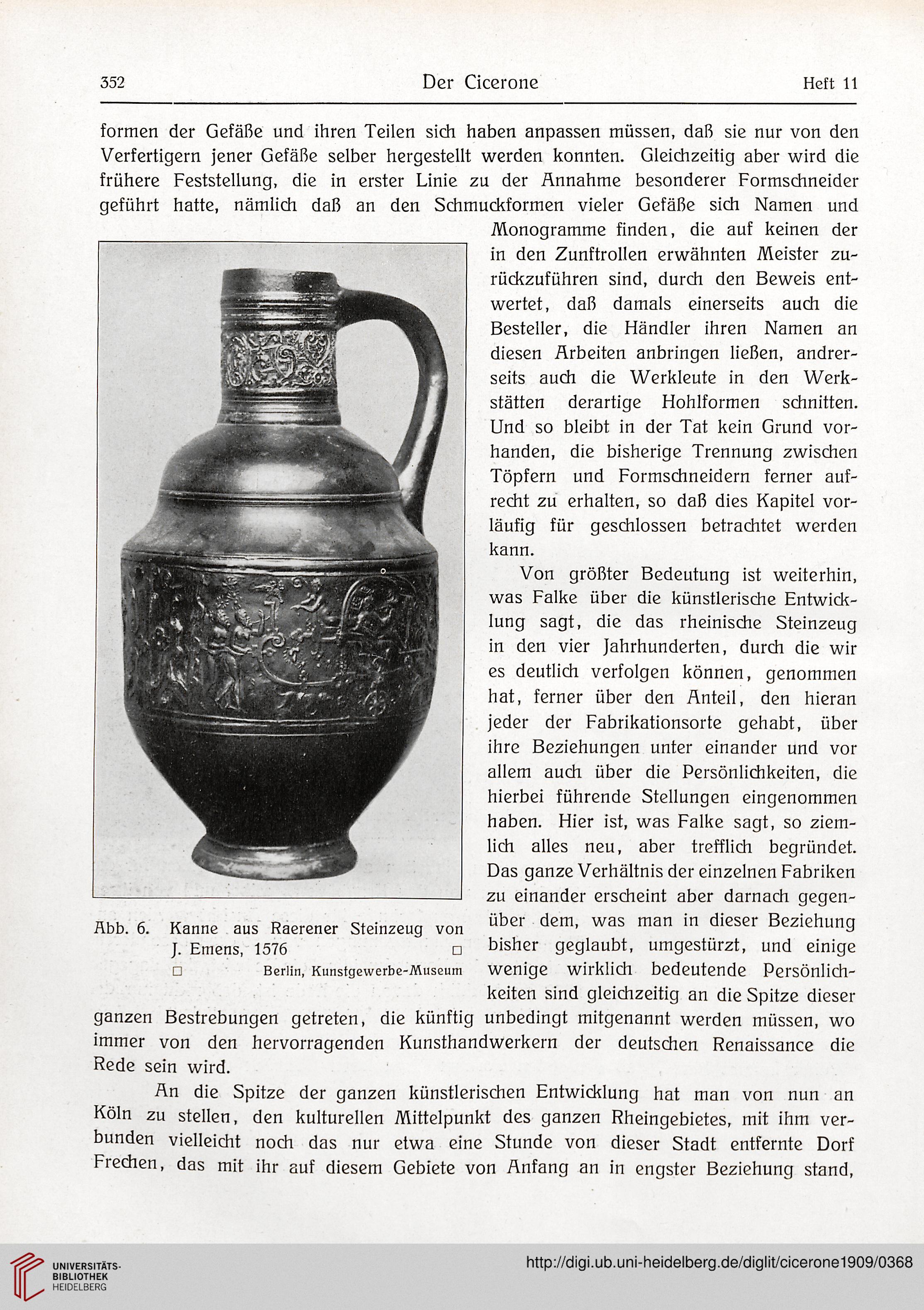Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0368
DOI Heft:
11. Heft
DOI Artikel:Zimmermann, Ernst: Rheinisches Steinzeug
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0368
352
Der Cicerone
Heft 11
formen der Gefäße und ihren Teilen sich haben anpassen müssen, daß sie nur von den
Verfertigern jener Gefäße selber hergestellt werden konnten. Gleichzeitig aber wird die
frühere Feststellung, die in erster Linie zu der Annahme besonderer Formschneider
geführt hatte, nämlich daß an den Schmuckformen vieler Gefäße sich Namen und
Monogramme finden, die auf keinen der
in den Zunftrollen erwähnten Meister zu-
rückzuführen sind, durch den Beweis ent-
wertet, daß damals einerseits auch die
Besteller, die Händler ihren Namen an
diesen Arbeiten anbringen ließen, andrer-
seits auch die Werkleute in den Werk-
stätten derartige Hohlformen schnitten.
Und so bleibt in der Tat kein Grund vor-
handen, die bisherige Trennung zwischen
Töpfern und Formschneidern ferner auf-
recht zu erhalten, so daß dies Kapitel vor-
läufig für geschlossen betrachtet werden
kann.
Von größter Bedeutung ist weiterhin,
was Falke über die künstlerische Entwick-
lung sagt, die das rheinische Steinzeug
in den vier Jahrhunderten, durch die wir
es deutlich verfolgen können, genommen
hat, ferner über den Anteil, den hieran
jeder der Fabrikationsorte gehabt, über
ihre Beziehungen unter einander und vor
allem auch über die Persönlichkeiten, die
hierbei führende Stellungen eingenommen
haben. Hier ist, was Falke sagt, so ziem-
lich alles neu, aber trefflich begründet.
Das ganze Verhältnis der einzelnen Fabriken
zu einander erscheint aber darnach gegen-
über dem, was man in dieser Beziehung
bisher geglaubt, umgestürzt, und einige
wenige wirklich bedeutende Persönlich-
keiten sind gleichzeitig an die Spitze dieser
ganzen Bestrebungen getreten, die künftig unbedingt mitgenannt werden müssen, wo
immer von den hervorragenden Kunsthandwerkern der deutschen Renaissance die
Rede sein wird.
An die Spitze der ganzen künstlerischen Entwicklung hat man von nun an
Köln zu stellen, den kulturellen Mittelpunkt des ganzen Rheingebietes, mit ihm ver-
bunden vielleicht noch das nur etwa eine Stunde von dieser Stadt entfernte Dorf
Frechen, das mit ihr auf diesem Gebiete von Anfang an in engster Beziehung stand,
Abb. 6.
Kanne aus Raerener Steinzeug von
J. Emens, 1576 □
□ Berlin, Kunstgewerbe-Museum
Der Cicerone
Heft 11
formen der Gefäße und ihren Teilen sich haben anpassen müssen, daß sie nur von den
Verfertigern jener Gefäße selber hergestellt werden konnten. Gleichzeitig aber wird die
frühere Feststellung, die in erster Linie zu der Annahme besonderer Formschneider
geführt hatte, nämlich daß an den Schmuckformen vieler Gefäße sich Namen und
Monogramme finden, die auf keinen der
in den Zunftrollen erwähnten Meister zu-
rückzuführen sind, durch den Beweis ent-
wertet, daß damals einerseits auch die
Besteller, die Händler ihren Namen an
diesen Arbeiten anbringen ließen, andrer-
seits auch die Werkleute in den Werk-
stätten derartige Hohlformen schnitten.
Und so bleibt in der Tat kein Grund vor-
handen, die bisherige Trennung zwischen
Töpfern und Formschneidern ferner auf-
recht zu erhalten, so daß dies Kapitel vor-
läufig für geschlossen betrachtet werden
kann.
Von größter Bedeutung ist weiterhin,
was Falke über die künstlerische Entwick-
lung sagt, die das rheinische Steinzeug
in den vier Jahrhunderten, durch die wir
es deutlich verfolgen können, genommen
hat, ferner über den Anteil, den hieran
jeder der Fabrikationsorte gehabt, über
ihre Beziehungen unter einander und vor
allem auch über die Persönlichkeiten, die
hierbei führende Stellungen eingenommen
haben. Hier ist, was Falke sagt, so ziem-
lich alles neu, aber trefflich begründet.
Das ganze Verhältnis der einzelnen Fabriken
zu einander erscheint aber darnach gegen-
über dem, was man in dieser Beziehung
bisher geglaubt, umgestürzt, und einige
wenige wirklich bedeutende Persönlich-
keiten sind gleichzeitig an die Spitze dieser
ganzen Bestrebungen getreten, die künftig unbedingt mitgenannt werden müssen, wo
immer von den hervorragenden Kunsthandwerkern der deutschen Renaissance die
Rede sein wird.
An die Spitze der ganzen künstlerischen Entwicklung hat man von nun an
Köln zu stellen, den kulturellen Mittelpunkt des ganzen Rheingebietes, mit ihm ver-
bunden vielleicht noch das nur etwa eine Stunde von dieser Stadt entfernte Dorf
Frechen, das mit ihr auf diesem Gebiete von Anfang an in engster Beziehung stand,
Abb. 6.
Kanne aus Raerener Steinzeug von
J. Emens, 1576 □
□ Berlin, Kunstgewerbe-Museum