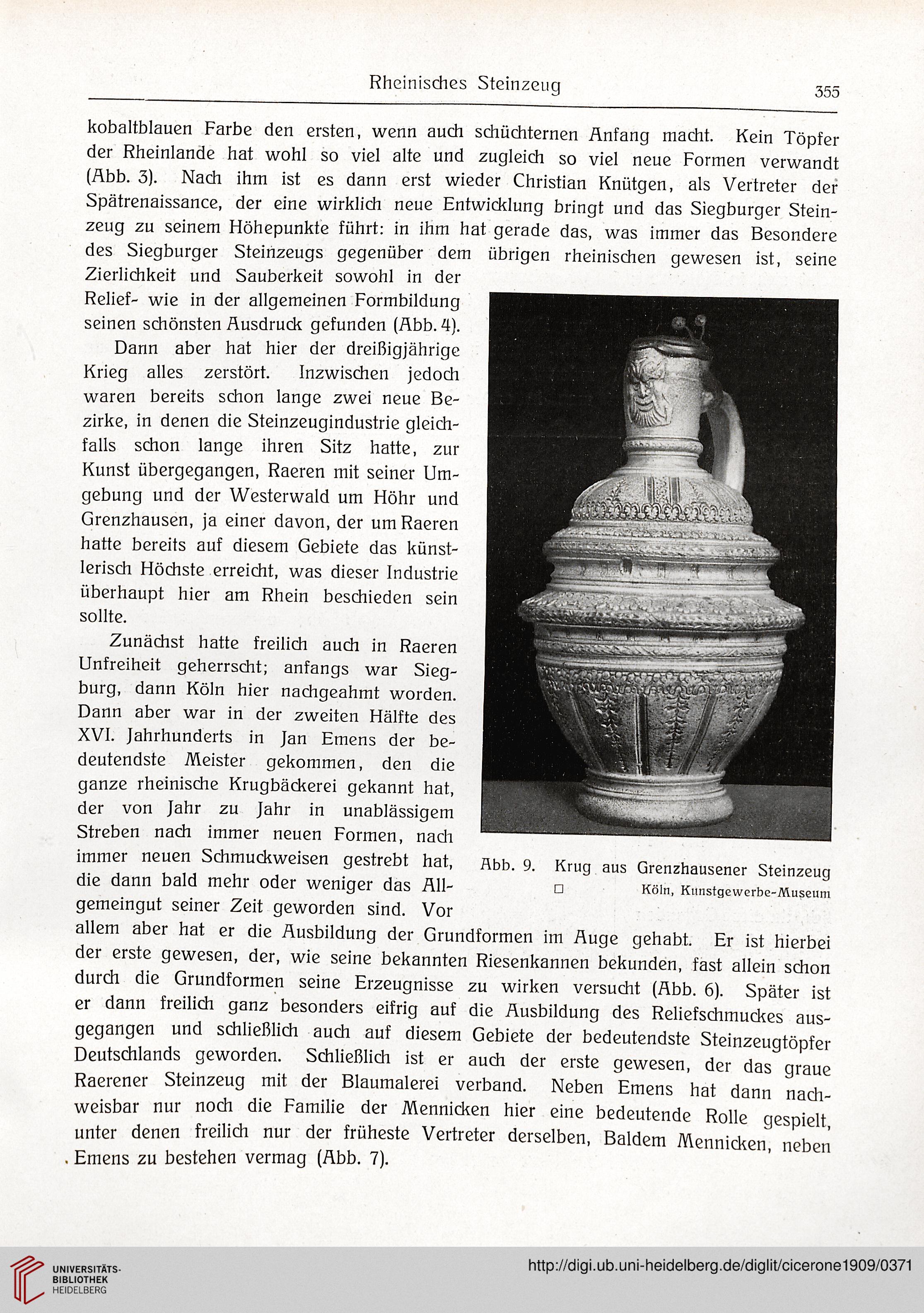Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0371
DOI Heft:
11. Heft
DOI Artikel:Zimmermann, Ernst: Rheinisches Steinzeug
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0371
Rheinisches Steinzeug
355
kobaltblauen Farbe den ersten, wenn auch schüchternen Anfang macht. Kein Töpfer
der Rheinlande hat wohl so viel alte und zugleich so viel neue Formen verwandt
(Abb. 3). Nach ihm ist es dann erst wieder Christian Knütgen, als Vertreter der
Spätrenaissance, der eine wirklich neue Entwicklung bringt und das Siegburger Stein-
zeug zu seinem Höhepunkte führt: in ihm hat gerade das, was immer das Besondere
des Siegburger Steinzeugs gegenüber dem übrigen rheinischen gewesen ist, seine
Zierlichkeit und Sauberkeit sowohl in der
Relief- wie in der allgemeinen Formbildung
seinen schönsten Ausdruck gefunden (Abb. 4).
Dann aber hat hier der dreißigjährige
Krieg alles zerstört. Inzwischen jedoch
waren bereits schon lange zwei neue Be-
zirke, in denen die Steinzeugindustrie gleich-
falls schon lange ihren Sitz hatte, zur
Kunst übergegangen, Raeren mit seiner Um-
gebung und der Westerwald um Höhr und
Grenzhausen, ja einer davon, der um Raeren
hatte bereits auf diesem Gebiete das künst-
lerisch Höchste erreicht, was dieser Industrie
überhaupt hier am Rhein beschieden sein
sollte.
Zunächst hatte freilich auch in Raeren
Unfreiheit geherrscht; anfangs war Sieg-
burg, dann Köln hier nachgeahmt worden.
Dann aber war in der zweiten Hälfte des
XVI. Jahrhunderts in Jan Emens der be-
deutendste Meister gekommen, den die
ganze rheinische Krugbäckerei gekannt hat,
der von Jahr zu Jahr in unablässigem
Streben nach immer neuen Formen, nach
immer neuen Schmuckweisen gestrebt hat,
die dann bald mehr oder weniger das All-
gemeingut seiner Zeit geworden sind. Vor
allem aber hat er die Ausbildung der Grundformen im Auge gehabt. Er ist hierbei
der erste gewesen, der, wie seine bekannten Riesenkannen bekunden, fast allein schon
durch die Grundformen seine Erzeugnisse zu wirken versucht (Abb. 6). Später ist
er dann freilich ganz besonders eifrig auf die Ausbildung des Reliefschmuckes aus-
gegangen und schließlich auch auf diesem Gebiete der bedeutendste Steinzeugtöpfer
Deutschlands geworden. Schließlich ist er auch der erste gewesen, der das graue
Raerener Steinzeug mit der Blaumalerei verband. Neben Emens hat dann nach-
weisbar nur noch die Familie der Mennicken hier eine bedeutende Rolle gespielt,
unter denen freilich nur der früheste Vertreter derselben, Baldem Mennicken, neben
. Emens zu bestehen vermag (Abb. 7).
Äbb. 9. Krug aus Grenzhausener Steinzeug
□ Köln, Kunstgewerbe-Äluseum
355
kobaltblauen Farbe den ersten, wenn auch schüchternen Anfang macht. Kein Töpfer
der Rheinlande hat wohl so viel alte und zugleich so viel neue Formen verwandt
(Abb. 3). Nach ihm ist es dann erst wieder Christian Knütgen, als Vertreter der
Spätrenaissance, der eine wirklich neue Entwicklung bringt und das Siegburger Stein-
zeug zu seinem Höhepunkte führt: in ihm hat gerade das, was immer das Besondere
des Siegburger Steinzeugs gegenüber dem übrigen rheinischen gewesen ist, seine
Zierlichkeit und Sauberkeit sowohl in der
Relief- wie in der allgemeinen Formbildung
seinen schönsten Ausdruck gefunden (Abb. 4).
Dann aber hat hier der dreißigjährige
Krieg alles zerstört. Inzwischen jedoch
waren bereits schon lange zwei neue Be-
zirke, in denen die Steinzeugindustrie gleich-
falls schon lange ihren Sitz hatte, zur
Kunst übergegangen, Raeren mit seiner Um-
gebung und der Westerwald um Höhr und
Grenzhausen, ja einer davon, der um Raeren
hatte bereits auf diesem Gebiete das künst-
lerisch Höchste erreicht, was dieser Industrie
überhaupt hier am Rhein beschieden sein
sollte.
Zunächst hatte freilich auch in Raeren
Unfreiheit geherrscht; anfangs war Sieg-
burg, dann Köln hier nachgeahmt worden.
Dann aber war in der zweiten Hälfte des
XVI. Jahrhunderts in Jan Emens der be-
deutendste Meister gekommen, den die
ganze rheinische Krugbäckerei gekannt hat,
der von Jahr zu Jahr in unablässigem
Streben nach immer neuen Formen, nach
immer neuen Schmuckweisen gestrebt hat,
die dann bald mehr oder weniger das All-
gemeingut seiner Zeit geworden sind. Vor
allem aber hat er die Ausbildung der Grundformen im Auge gehabt. Er ist hierbei
der erste gewesen, der, wie seine bekannten Riesenkannen bekunden, fast allein schon
durch die Grundformen seine Erzeugnisse zu wirken versucht (Abb. 6). Später ist
er dann freilich ganz besonders eifrig auf die Ausbildung des Reliefschmuckes aus-
gegangen und schließlich auch auf diesem Gebiete der bedeutendste Steinzeugtöpfer
Deutschlands geworden. Schließlich ist er auch der erste gewesen, der das graue
Raerener Steinzeug mit der Blaumalerei verband. Neben Emens hat dann nach-
weisbar nur noch die Familie der Mennicken hier eine bedeutende Rolle gespielt,
unter denen freilich nur der früheste Vertreter derselben, Baldem Mennicken, neben
. Emens zu bestehen vermag (Abb. 7).
Äbb. 9. Krug aus Grenzhausener Steinzeug
□ Köln, Kunstgewerbe-Äluseum