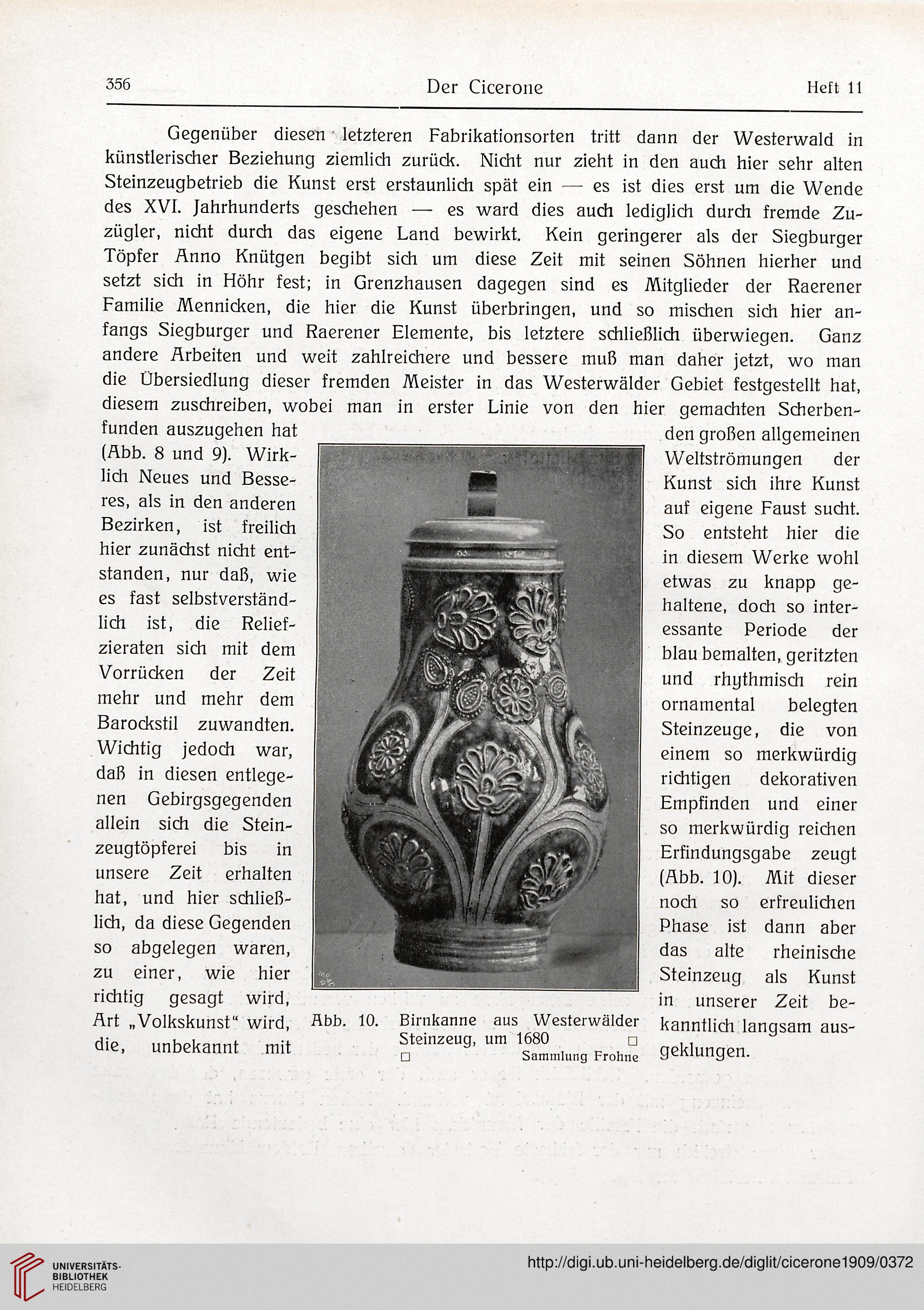Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0372
DOI Heft:
11. Heft
DOI Artikel:Zimmermann, Ernst: Rheinisches Steinzeug
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0372
356
Der Cicerone
lieft 11
Gegenüber diesen letzteren Fabrikationsorten tritt dann der Westerwald in
künstlerischer Beziehung ziemlich zurück. Nicht nur zieht in den auch hier sehr alten
Steinzeugbetrieb die Kunst erst erstaunlich spät ein — es ist dies erst um die Wende
des XVI. Jahrhunderts geschehen — es ward dies auch lediglich durch fremde Zu-
zügler, nicht durch das eigene Land bewirkt. Kein geringerer als der Siegburger
Töpfer Änno Knütgen begibt sich um diese Zeit mit seinen Söhnen hierher und
setzt sich in Höhr fest; in Grenzhausen dagegen sind es Mitglieder der Raerener
Familie Mennicken, die hier die Kunst überbringen, und so mischen sich hier an-
fangs Siegburger und Raerener Elemente, bis letztere schließlich überwiegen. Ganz
andere Arbeiten und weit zahlreichere und bessere muß man daher jetzt, wo man
die Übersiedlung dieser fremden Meister in das Westerwälder Gebiet festgestellt hat,
diesem zuschreiben, wobei man in erster Linie von den hier gemachten Scherben-
funden auszugehen hat
(Abb. 8 und 9). Wirk-
lich Neues und Besse-
res, als in den anderen
Bezirken, ist freilich
hier zunächst nicht ent-
standen, nur daß, wie
es fast selbstverständ-
lich ist, die Relief-
zieraten sich mit dem
Vorrücken der Zeit
mehr und mehr dem
Barockstil zuwandten.
Wichtig jedoch war,
daß in diesen entlege-
nen Gebirgsgegenden
allein sich die Stein-
zeugtöpferei bis in
unsere Zeit erhalten
hat, und hier schließ-
lich, da diese Gegenden
so abgelegen waren,
zu einer, wie hier
richtig gesagt wird,
den großen allgemeinen
Weltströmungen der
Kunst sich ihre Kunst
auf eigene Faust sucht.
So entsteht hier die
in diesem Werke wohl
etwas zu knapp ge-
haltene, doch so inter-
essante Periode der
blau bemalten, geritzten
und rhythmisch rein
ornamental belegten
Steinzeuge, die von
einem so merkwürdig
richtigen dekorativen
Empfinden und einer
so merkwürdig reichen
Erfindungsgabe zeugt
(Abb. 10). Mit dieser
noch so erfreulichen
Phase ist dann aber
das alte rheinische
Steinzeug als Kunst
in unserer Zeit be-
Art „Volkskunst“ wird, Abb. 10. Birnkanne aus Westerwälder kanntlich langsam aus-
Steinzeuq, um 1680 □ _, ,
□ Sammlung Frohne CJCKlungßn.
die, unbekannt mit
Der Cicerone
lieft 11
Gegenüber diesen letzteren Fabrikationsorten tritt dann der Westerwald in
künstlerischer Beziehung ziemlich zurück. Nicht nur zieht in den auch hier sehr alten
Steinzeugbetrieb die Kunst erst erstaunlich spät ein — es ist dies erst um die Wende
des XVI. Jahrhunderts geschehen — es ward dies auch lediglich durch fremde Zu-
zügler, nicht durch das eigene Land bewirkt. Kein geringerer als der Siegburger
Töpfer Änno Knütgen begibt sich um diese Zeit mit seinen Söhnen hierher und
setzt sich in Höhr fest; in Grenzhausen dagegen sind es Mitglieder der Raerener
Familie Mennicken, die hier die Kunst überbringen, und so mischen sich hier an-
fangs Siegburger und Raerener Elemente, bis letztere schließlich überwiegen. Ganz
andere Arbeiten und weit zahlreichere und bessere muß man daher jetzt, wo man
die Übersiedlung dieser fremden Meister in das Westerwälder Gebiet festgestellt hat,
diesem zuschreiben, wobei man in erster Linie von den hier gemachten Scherben-
funden auszugehen hat
(Abb. 8 und 9). Wirk-
lich Neues und Besse-
res, als in den anderen
Bezirken, ist freilich
hier zunächst nicht ent-
standen, nur daß, wie
es fast selbstverständ-
lich ist, die Relief-
zieraten sich mit dem
Vorrücken der Zeit
mehr und mehr dem
Barockstil zuwandten.
Wichtig jedoch war,
daß in diesen entlege-
nen Gebirgsgegenden
allein sich die Stein-
zeugtöpferei bis in
unsere Zeit erhalten
hat, und hier schließ-
lich, da diese Gegenden
so abgelegen waren,
zu einer, wie hier
richtig gesagt wird,
den großen allgemeinen
Weltströmungen der
Kunst sich ihre Kunst
auf eigene Faust sucht.
So entsteht hier die
in diesem Werke wohl
etwas zu knapp ge-
haltene, doch so inter-
essante Periode der
blau bemalten, geritzten
und rhythmisch rein
ornamental belegten
Steinzeuge, die von
einem so merkwürdig
richtigen dekorativen
Empfinden und einer
so merkwürdig reichen
Erfindungsgabe zeugt
(Abb. 10). Mit dieser
noch so erfreulichen
Phase ist dann aber
das alte rheinische
Steinzeug als Kunst
in unserer Zeit be-
Art „Volkskunst“ wird, Abb. 10. Birnkanne aus Westerwälder kanntlich langsam aus-
Steinzeuq, um 1680 □ _, ,
□ Sammlung Frohne CJCKlungßn.
die, unbekannt mit