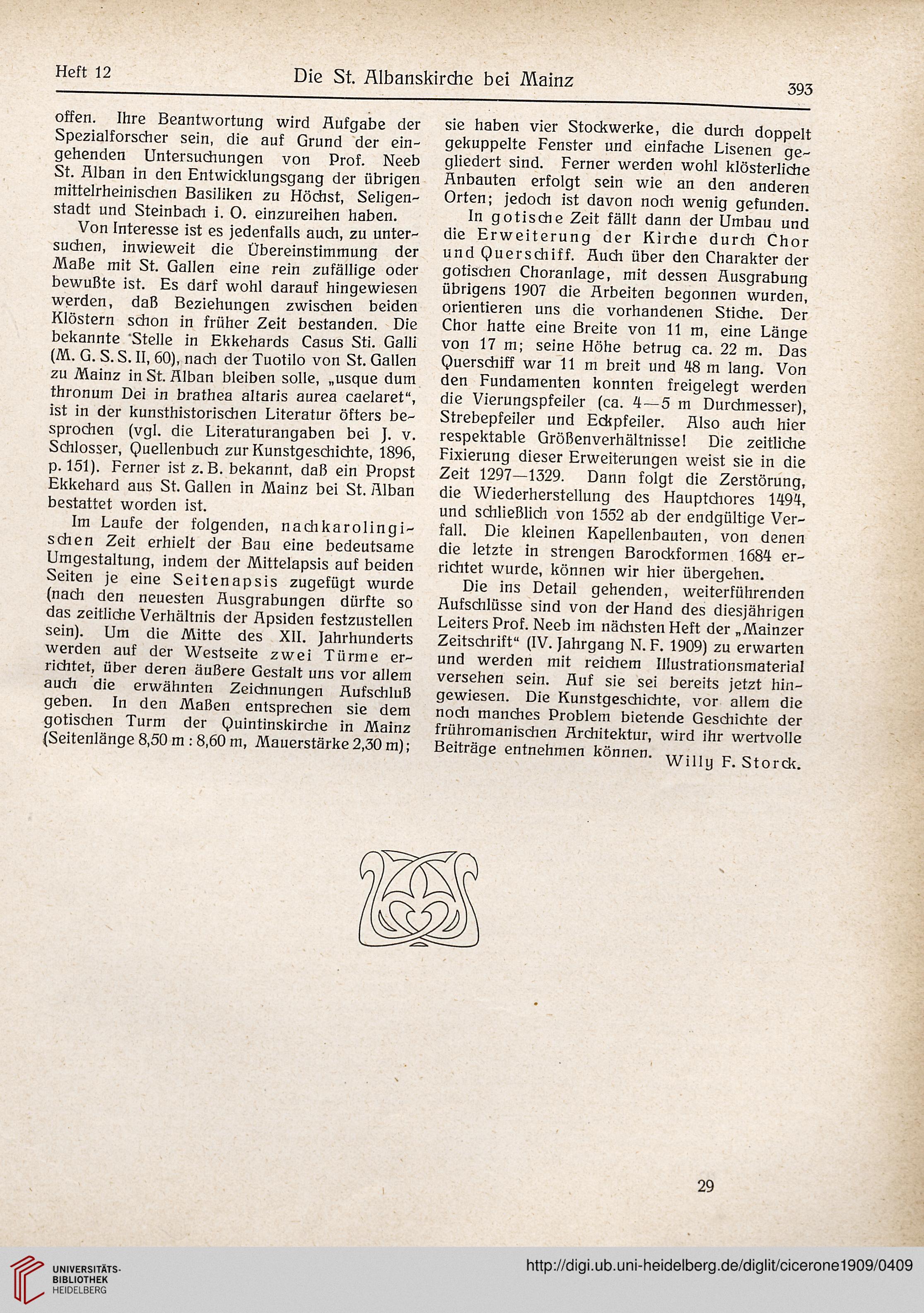Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0409
DOI Heft:
12. Heft
DOI Artikel:Storck, Willy F.: Die St. Albanskirche bei Mainz
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0409
Heft 12
Die St. Älbanskirche bei Mainz
393
offen. Ihre Beantwortung wird Hufgabe der
Spezialforscher sein, die auf Grund der ein-
gehenden Untersuchungen von Prof. Neeb
St. Älban in den Entwicklungsgang der übrigen
mittelrheinischen Basiliken zu Höchst, Seligen-
stadt und Steinbach i. O. einzureihen haben.
Von Interesse ist es jedenfalls auch, zu unter-
suchen, inwieweit die Übereinstimmung der
Maße mit St. Gallen eine rein zufällige oder
bewußte ist. Es darf wohl darauf hingewiesen
werden, daß Beziehungen zwischen beiden
Klöstern schon in früher Zeit bestanden. Die
bekannte 'Stelle in Ekkehards Casus Sti. Galli
(M. G. S. S. II, 60), nach der Tuotilo von St. Gallen
zu Mainz in St. Älban bleiben solle, „usque dum
thronum Dei in brathea altaris aurea caelaret“,
ist in der kunsthistorischen Literatur öfters be-
sprochen (vgl. die Literaturangaben bei J. v.
Schlosser, Quellenbuch zur Kunstgeschichte, 1896,
p. 151). Ferner ist z. B. bekannt, daß ein Propst
Ekkehard aus St. Gallen in Mainz bei St. Älban
bestattet worden ist.
Im Laufe der folgenden, nachkarolingi-
schen Zeit erhielt der Bau eine bedeutsame
Umgestaltung, indem der Mittelapsis auf beiden
Seiten je eine Seitenapsis zugefügt wurde
(nach den neuesten Ausgrabungen dürfte so
das zeitliche Verhältnis der Apsiden festzustellen
sein). Um die Mitte des XII. Jahrhunderts
werden auf der Westseite zwei Türme er-
richtet, über deren äußere Gestalt uns vor allem
auch die erwähnten Zeichnungen Aufschluß
geben. In den Maßen entsprechen sie dem
gotischen Turm der Quintinskirche in Mainz
(Seitenlänge 8,50 m : 8,60 m, Mauerstärke 2,30 m);
sie haben vier Stockwerke, die durch doppelt
gekuppelte Fenster und einfache Lisenen ge-
gliedert sind. Ferner werden wohl klösterliche
Anbauten erfolgt sein wie an den anderen
Orten; jedoch ist davon noch wenig gefunden.
In gotische Zeit fällt dann der Umbau und
die Erweiterung der Kirche durch Chor
und Qu er schiff. Auch über den Charakter der
gotischen Choranlage, mit dessen Ausgrabung
übrigens 1907 die Hrbeiten begonnen wurden,
orientieren uns die vorhandenen Stiche. Der
Chor hatte eine Breite von 11 m, eine Länge
von 17 m; seine Höhe betrug ca. 22 m. Das
Querschiff war 11 m breit und 48 m lang. Von
den Fundamenten konnten freigelegt werden
die Vierungspfeiler (ca. 4—5 m Durchmesser),
Strebepfeiler und Eckpfeiler. Hlso auch hier
respektable Größenverhältnisse! Die zeitliche
Fixierung dieser Erweiterungen weist sie in die
Zeit 1297—1329. Dann folgt die Zerstörung,
die Wiederherstellung des Hauptchores 1494,
und schließlich von 1552 ab der endgültige Ver-
fall. Die kleinen Kapellenbauten, von denen
die letzte in strengen Barockformen 1684 er-
richtet wurde, können wir hier übergehen.
Die ins Detail gehenden, weiterführenden
Aufschlüsse sind von der Hand des diesjährigen
Leiters Prof. Neeb im nächsten Heft der „Mainzer
Zeitschrift“ (IV. Jahrgang N. F. 1909) zu erwarten
und werden mit reichem Illustrationsmaterial
versehen sein. Auf sie sei bereits jetzt hin-
gewiesen. Die Kunstgeschichte, vor allem die
noch manches Problem bietende Geschichte der
frühromanischen Architektur, wird ihr wertvolle
Beiträge entnehmen können. willy Storch.
29
Die St. Älbanskirche bei Mainz
393
offen. Ihre Beantwortung wird Hufgabe der
Spezialforscher sein, die auf Grund der ein-
gehenden Untersuchungen von Prof. Neeb
St. Älban in den Entwicklungsgang der übrigen
mittelrheinischen Basiliken zu Höchst, Seligen-
stadt und Steinbach i. O. einzureihen haben.
Von Interesse ist es jedenfalls auch, zu unter-
suchen, inwieweit die Übereinstimmung der
Maße mit St. Gallen eine rein zufällige oder
bewußte ist. Es darf wohl darauf hingewiesen
werden, daß Beziehungen zwischen beiden
Klöstern schon in früher Zeit bestanden. Die
bekannte 'Stelle in Ekkehards Casus Sti. Galli
(M. G. S. S. II, 60), nach der Tuotilo von St. Gallen
zu Mainz in St. Älban bleiben solle, „usque dum
thronum Dei in brathea altaris aurea caelaret“,
ist in der kunsthistorischen Literatur öfters be-
sprochen (vgl. die Literaturangaben bei J. v.
Schlosser, Quellenbuch zur Kunstgeschichte, 1896,
p. 151). Ferner ist z. B. bekannt, daß ein Propst
Ekkehard aus St. Gallen in Mainz bei St. Älban
bestattet worden ist.
Im Laufe der folgenden, nachkarolingi-
schen Zeit erhielt der Bau eine bedeutsame
Umgestaltung, indem der Mittelapsis auf beiden
Seiten je eine Seitenapsis zugefügt wurde
(nach den neuesten Ausgrabungen dürfte so
das zeitliche Verhältnis der Apsiden festzustellen
sein). Um die Mitte des XII. Jahrhunderts
werden auf der Westseite zwei Türme er-
richtet, über deren äußere Gestalt uns vor allem
auch die erwähnten Zeichnungen Aufschluß
geben. In den Maßen entsprechen sie dem
gotischen Turm der Quintinskirche in Mainz
(Seitenlänge 8,50 m : 8,60 m, Mauerstärke 2,30 m);
sie haben vier Stockwerke, die durch doppelt
gekuppelte Fenster und einfache Lisenen ge-
gliedert sind. Ferner werden wohl klösterliche
Anbauten erfolgt sein wie an den anderen
Orten; jedoch ist davon noch wenig gefunden.
In gotische Zeit fällt dann der Umbau und
die Erweiterung der Kirche durch Chor
und Qu er schiff. Auch über den Charakter der
gotischen Choranlage, mit dessen Ausgrabung
übrigens 1907 die Hrbeiten begonnen wurden,
orientieren uns die vorhandenen Stiche. Der
Chor hatte eine Breite von 11 m, eine Länge
von 17 m; seine Höhe betrug ca. 22 m. Das
Querschiff war 11 m breit und 48 m lang. Von
den Fundamenten konnten freigelegt werden
die Vierungspfeiler (ca. 4—5 m Durchmesser),
Strebepfeiler und Eckpfeiler. Hlso auch hier
respektable Größenverhältnisse! Die zeitliche
Fixierung dieser Erweiterungen weist sie in die
Zeit 1297—1329. Dann folgt die Zerstörung,
die Wiederherstellung des Hauptchores 1494,
und schließlich von 1552 ab der endgültige Ver-
fall. Die kleinen Kapellenbauten, von denen
die letzte in strengen Barockformen 1684 er-
richtet wurde, können wir hier übergehen.
Die ins Detail gehenden, weiterführenden
Aufschlüsse sind von der Hand des diesjährigen
Leiters Prof. Neeb im nächsten Heft der „Mainzer
Zeitschrift“ (IV. Jahrgang N. F. 1909) zu erwarten
und werden mit reichem Illustrationsmaterial
versehen sein. Auf sie sei bereits jetzt hin-
gewiesen. Die Kunstgeschichte, vor allem die
noch manches Problem bietende Geschichte der
frühromanischen Architektur, wird ihr wertvolle
Beiträge entnehmen können. willy Storch.
29