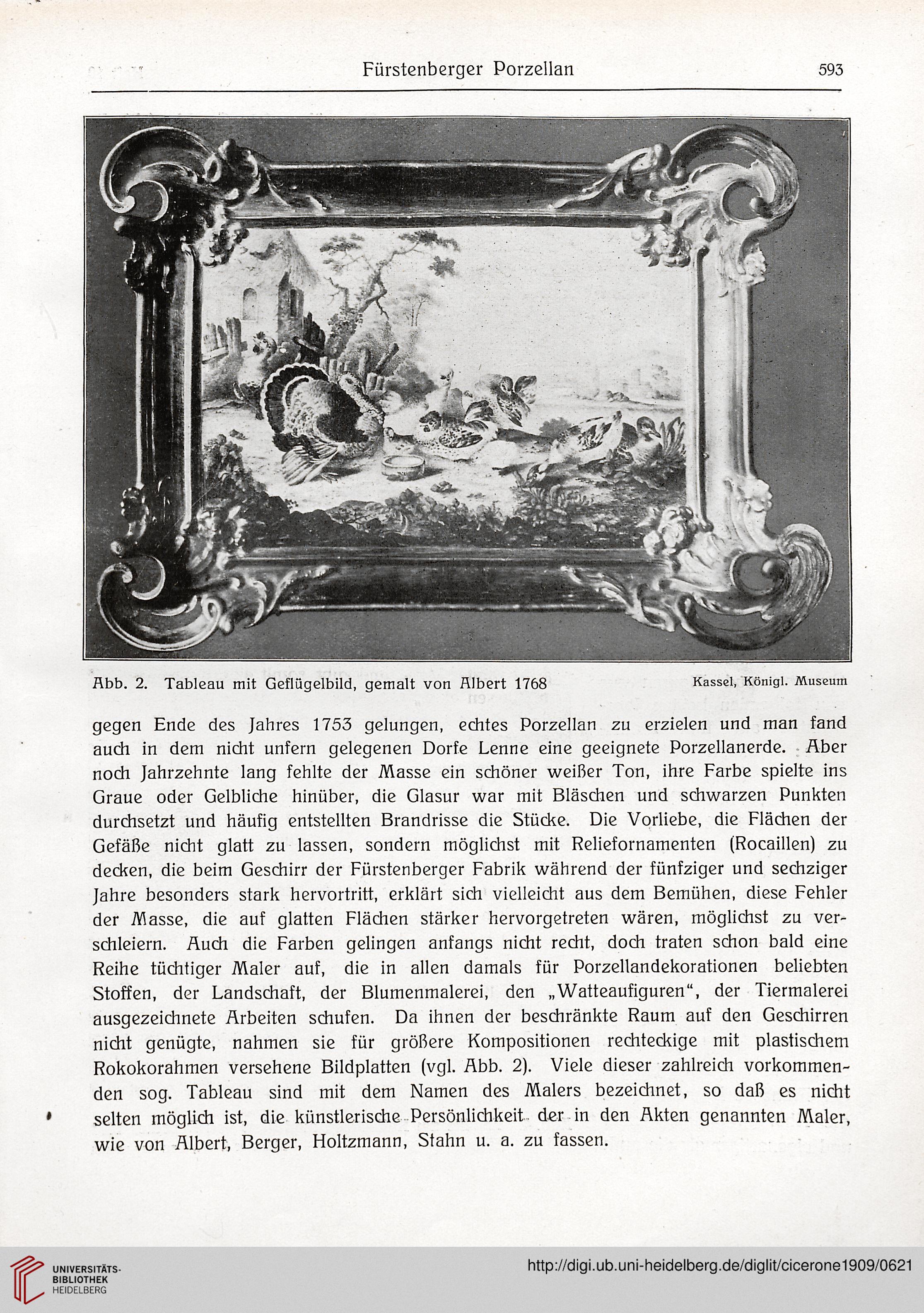Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0621
DOI Heft:
19. Heft
DOI Artikel:Brüning, Adolf: Fürstenberger Porzellan
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0621
Fürstenberger Porzellan
593
Äbb. 2. Tableau mit Geflügelbild, gemalt von Älbert 1768 Kassel, Königi. Museum
gegen Ende des Jahres 1753 gelungen, echtes Porzellan zu erzielen und man fand
auch in dem nicht unfern gelegenen Dorfe Lenne eine geeignete Porzellanerde. Aber
noch Jahrzehnte lang fehlte der Masse ein schöner weißer Ton, ihre Farbe spielte ins
Graue oder Gelbliche hinüber, die Glasur war mit Bläschen und schwarzen Punkten
durchsetzt und häufig entstellten Brandrisse die Stücke. Die Vorliebe, die Flächen der
Gefäße nicht glatt zu lassen, sondern möglichst mit Reliefornamenten (Rocaillen) zu
decken, die beim Geschirr der Fürstenberger Fabrik während der fünfziger und sechziger
Jahre besonders stark hervortritt, erklärt sich vielleicht aus dem Bemühen, diese Fehler
der Masse, die auf glatten Flächen stärker hervorgetreten wären, möglichst zu ver-
schleiern. Auch die Farben gelingen anfangs nicht recht, doch traten schon bald eine
Reihe tüchtiger Maler auf, die in allen damals für Porzellandekorationen beliebten
Stoffen, der Landschaft, der Blumenmalerei, den „Watteaufiguren“, der Tiermalerei
ausgezeichnete Arbeiten schufen. Da ihnen der beschränkte Raum auf den Geschirren
nicht genügte, nahmen sie für größere Kompositionen rechteckige mit plastischem
Rokokorahmen versehene Bildplatten (vgl. Abb. 2). Viele dieser zahlreich vorkommen-
den sog. Tableau sind mit dem Namen des Malers bezeichnet, so daß es nicht
selten möglich ist, die künstlerische Persönlichkeit der in den Akten genannten Maler,
wie von Albert, Berger, Holtzmann, Stahn u. a. zu fassen.
593
Äbb. 2. Tableau mit Geflügelbild, gemalt von Älbert 1768 Kassel, Königi. Museum
gegen Ende des Jahres 1753 gelungen, echtes Porzellan zu erzielen und man fand
auch in dem nicht unfern gelegenen Dorfe Lenne eine geeignete Porzellanerde. Aber
noch Jahrzehnte lang fehlte der Masse ein schöner weißer Ton, ihre Farbe spielte ins
Graue oder Gelbliche hinüber, die Glasur war mit Bläschen und schwarzen Punkten
durchsetzt und häufig entstellten Brandrisse die Stücke. Die Vorliebe, die Flächen der
Gefäße nicht glatt zu lassen, sondern möglichst mit Reliefornamenten (Rocaillen) zu
decken, die beim Geschirr der Fürstenberger Fabrik während der fünfziger und sechziger
Jahre besonders stark hervortritt, erklärt sich vielleicht aus dem Bemühen, diese Fehler
der Masse, die auf glatten Flächen stärker hervorgetreten wären, möglichst zu ver-
schleiern. Auch die Farben gelingen anfangs nicht recht, doch traten schon bald eine
Reihe tüchtiger Maler auf, die in allen damals für Porzellandekorationen beliebten
Stoffen, der Landschaft, der Blumenmalerei, den „Watteaufiguren“, der Tiermalerei
ausgezeichnete Arbeiten schufen. Da ihnen der beschränkte Raum auf den Geschirren
nicht genügte, nahmen sie für größere Kompositionen rechteckige mit plastischem
Rokokorahmen versehene Bildplatten (vgl. Abb. 2). Viele dieser zahlreich vorkommen-
den sog. Tableau sind mit dem Namen des Malers bezeichnet, so daß es nicht
selten möglich ist, die künstlerische Persönlichkeit der in den Akten genannten Maler,
wie von Albert, Berger, Holtzmann, Stahn u. a. zu fassen.