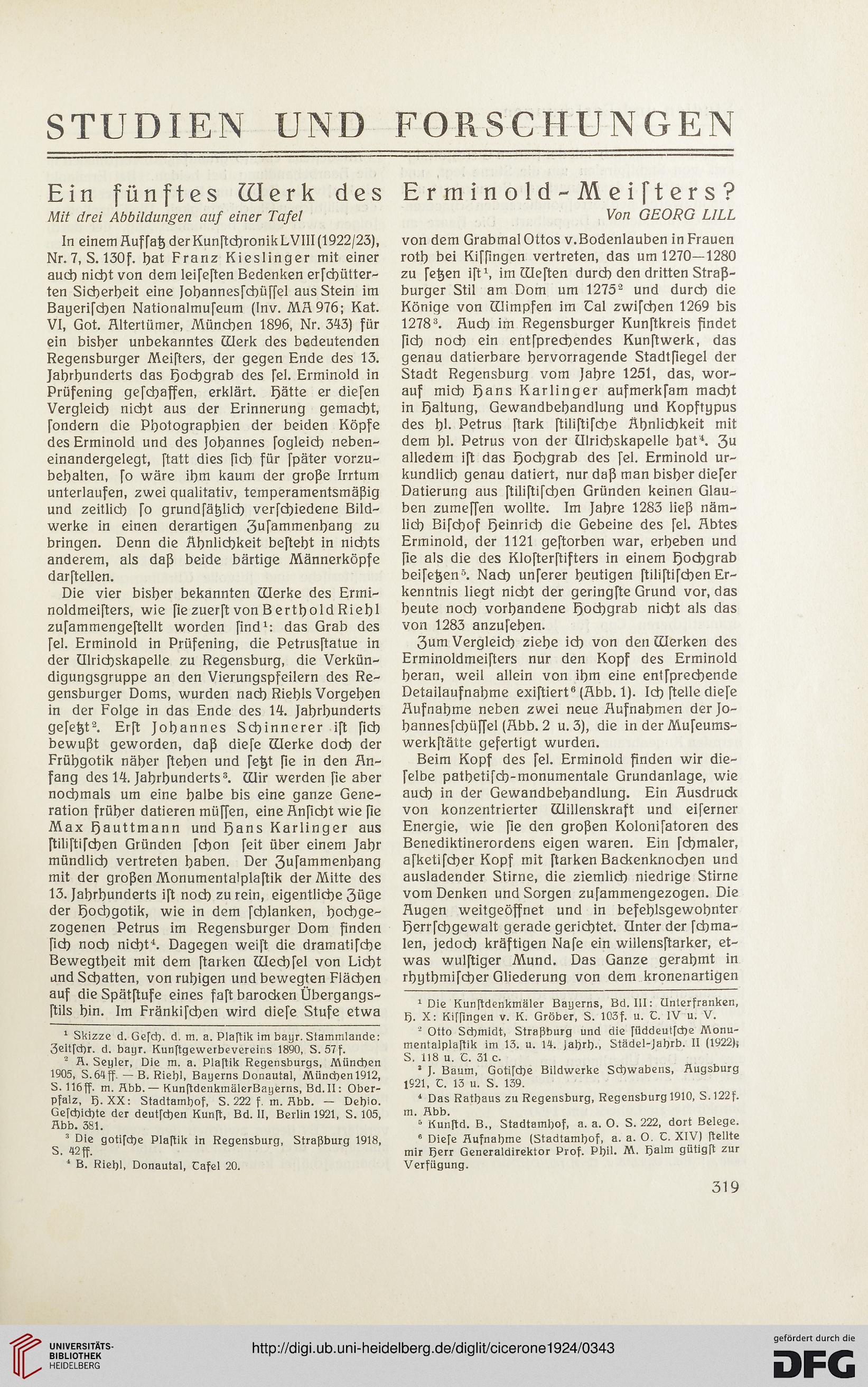STUDIEN UND FORSCHUNGEN
Ein fünftes (üerk des
Mit drei Abbildungen auf einer Tafel
In einem Äuffatj der KunftchronikLVIII (1922/23),
Nr. 7, S. 130f. hat Franz Kieslinger mit einer
auch nicht von dem leifeften Bedenken erfchütter-
ten Sicherheit eine Johannesfchüffel aus Stein im
Bayerifchen Nationalmufeum (Inv. MR976; Kat.
VI, Got. Ältertümer, München 1896, Nr. 343) für
ein bisher unbekanntes Werk des bedeutenden
Regensburger Meifters, der gegen Ende des 13.
Jahrhunderts das Fjochgrab des Tel. Erminold in
Prüfening gefcfjaffen, erklärt. Fjätte er diefen
Vergleich nicht aus der Erinnerung gemacht,
fondern die Photographien der beiden Köpfe
des Erminold und des Johannes fogleich neben-
einandergelegt, ftatt dies [ich für fpäter vorzu-
behalten, fo wäre ihm kaum der große Irrtum
unterlaufen, zwei qualitativ, temperamentsmäßig
und zeitlich To grundfätpich verfd)iedene Bild-
werke in einen derartigen 3ufammenhang zu
bringen. Denn die Ähnlichkeit befteht in nichts
anderem, als daß beide bärtige Männerköpfe
darftellen.
Die vier bisher bekannten Werke des Ermi-
noldmeifters, wie fie zuerft von Berthold Riehl
zufammengeftellt worden find1: das Grab des
fei. Erminold in Prüfening, die Petrusftatue in
der ülrichskapelle zu Regensburg, die Verkün-
digungsgruppe an den Vierungspfeilern des Re-
gensburger Doms, wurden nach Riehls Vorgehen
in der Folge in das Ende des 14. Jahrhunderts
gefegt2. Erft Johannes Schinnerer ift fid)
bewußt geworden, daß diefe Werke doch der
Frühgotik näher ftehen und fetjt pe in den Än-
fang des 14. Jahrhunderts3, Wir werden fie aber
nochmals um eine halbe bis eine ganze Gene-
ration früher datieren müffen, eine Änfid)t wie pe
Max Fjauttmann und pjans Karlinger aus
ftiliftifchen Gründen fchon feit über einem Jahr
mündlich vertreten haben. Der 3ufammenhang
mit der großen Monumentalplaftik der Mitte des
13. Jahrhunderts ift noch zurein, eigentliche 3üge
der Hochgotik, wie in dem fchlanken, hochge-
zogenen Petrus im Regensburger Dom ßnden
fich noch nicht4 *. Dagegen weift die dramatifcbe
Bewegtheit mit dem ftarken Wechfel von Licht
und Schatten, von ruhigen und bewegten Flächen
auf die Spätßufe eines faft barocken Übergangs-
ftils hin. Im Fränkifchen wird diefe Stufe etwa
1 Skizze d. Gefd). d. m. a. Plaftik im bayr. Stammlande:
3eitfd)r. d. bayr. Kunftgewerbevereins 1890, S. 57f.
2 Ä. Segler, Die m. a. Plaftik Regensburgs, München
1905, S.64ff. — B. Riet)!, Bayerns Donautal, Münd)enl912,
S. 116ff. m. Äbb.— KunftdenkmälerBayerns, Bd.II: Ober-
pfalz, F). XX: Stadtamhof, S. 222 f. m. Äbb. — Del)io.
Gefd)id)te der deutfchen Ranft, Bd. II, Berlin 1921, S. 105,
Äbb. 381.
3 Die gotifche Plaftik in Regensburg, Straßburg 1918,
S. 42ff.
4 B. Riehl, Donautal, Cafel 20.
Erminold'-Meifters?
Von GEORG LILL
von dem Grabmal Ottos v.Bodenlauben in Frauen
roth bei Kifpngen vertreten, das um 1270—1280
zu fetjen ift1, im (Heften durch den dritten Straß-
burger Stil am Dom um 12752 und durch die
Könige von Wimpfen im Cal zwifchen 1269 bis
12783. Äuch im Regensburger Kunftkreis pndet
pd) noch ein entfprechendes Kunßwerk, das
genau datierbare hervorragende Stadtpegel der
Stadt Regensburg vom Jahre 1251, das, wor-
auf mich Fjans Karlinger aufmerkfam macht
in Fjaltung, Gewandbehandlung und Kopftypus
des h>- Petrus ftark ftiliftifche Ähnlichkeit mit
dem hl* Petrus von der ülrichskapelle hat4. 3u
alledem ift das FJochgrab des fei. Erminold ur-
kundlich genau datiert, nur daß man bisher diefer
Datierung aus ftiliftifchen Gründen keinen Glau-
ben zumeffen wollte. Im Jahre 1283 ließ näm-
lich Bifd)of Heinrich die Gebeine des fei. Äbtes
Erminold, der 1121 geftorben war, erheben und
pe als die des Klofterpifters in einem Fjodbgrab
beife^en6. Nach unferer heutigen ftiliftifchen Er-
kenntnis liegt nicht der geringfte Grund vor, das
heute noch vorhandene FJochgrab nicht als das
von 1283 anzufehen.
3um Vergleich ziehe ich von den Werken des
Erminoldmeifters nur den Kopf des Erminold
heran, weil allein von ihm eine entfprechende
Detailaufnahme exiftiert6 (Äbb. 1). Ich ftelle diefe
Äufnahme neben zwei neue Äufnahmen derJo-
hannesfchüffel (Äbb. 2 u. 3), die in der Mufeums-
werkftätte gefertigt wurden.
Beim Kopf des fei. Erminold pnden wir die-
felbe pathetifch-monumentale Grundanlage, wie
auch in der Gewandbehandlung. Ein Äusdruck
von konzentrierter Willenskraft und eiferner
Energie, wie pe den großen Kolonifatoren des
Benediktinerordens eigen waren. Ein fchmaler,
afketifcber Kopf mit ftarken Backenknochen und
ausladender Stirne, die ziemlich niedrige Stirne
vom Denken und Sorgen zufammengezogen. Die
Äugen weitgeöffnet und in befehlsgewohnter
FJerrfchgewalt gerade gerichtet, ünter der fchma-
len, jedoch kräftigen Nafe ein willensftarker, et-
was wulftiger Mund. Das Ganze gerahmt in
rhythmifcher Gliederung von dem kronenartigen
1 Die Kunßdenkmäler Bayerns, Bd. III: tlnterfranken,
Fj. X: Kifpngen v. K. Gröber, S. 103f. u. C. IV u. V.
2 Otto Schmidt, Straßburg und die füddeutfche Monu-
mentalplaßik im 13. u. 14. fahrt)., Städel-Jaijrb. II (1922)*
S. 118 u. C. 31 c.
3 J. Baum, Gotifche Bildwerke Schwabens, Äugsburg
1921, C. 13 u. S. 139.
4 Das Rathaus zu Regensburg, Regensburg 1910, S.122f.
m. Äbb.
6 KunPd. B., Stadtamhof, a. a. O. S. 222, dort Belege.
6 Diefe Äufnahme (Stadtamhof, a. a. O. C. XIV) Pellte
mir ßerr Generaldirektor Prof. Pt)il. M. Fjalm EJÜtigß zur
Verfügung.
319
Ein fünftes (üerk des
Mit drei Abbildungen auf einer Tafel
In einem Äuffatj der KunftchronikLVIII (1922/23),
Nr. 7, S. 130f. hat Franz Kieslinger mit einer
auch nicht von dem leifeften Bedenken erfchütter-
ten Sicherheit eine Johannesfchüffel aus Stein im
Bayerifchen Nationalmufeum (Inv. MR976; Kat.
VI, Got. Ältertümer, München 1896, Nr. 343) für
ein bisher unbekanntes Werk des bedeutenden
Regensburger Meifters, der gegen Ende des 13.
Jahrhunderts das Fjochgrab des Tel. Erminold in
Prüfening gefcfjaffen, erklärt. Fjätte er diefen
Vergleich nicht aus der Erinnerung gemacht,
fondern die Photographien der beiden Köpfe
des Erminold und des Johannes fogleich neben-
einandergelegt, ftatt dies [ich für fpäter vorzu-
behalten, fo wäre ihm kaum der große Irrtum
unterlaufen, zwei qualitativ, temperamentsmäßig
und zeitlich To grundfätpich verfd)iedene Bild-
werke in einen derartigen 3ufammenhang zu
bringen. Denn die Ähnlichkeit befteht in nichts
anderem, als daß beide bärtige Männerköpfe
darftellen.
Die vier bisher bekannten Werke des Ermi-
noldmeifters, wie fie zuerft von Berthold Riehl
zufammengeftellt worden find1: das Grab des
fei. Erminold in Prüfening, die Petrusftatue in
der ülrichskapelle zu Regensburg, die Verkün-
digungsgruppe an den Vierungspfeilern des Re-
gensburger Doms, wurden nach Riehls Vorgehen
in der Folge in das Ende des 14. Jahrhunderts
gefegt2. Erft Johannes Schinnerer ift fid)
bewußt geworden, daß diefe Werke doch der
Frühgotik näher ftehen und fetjt pe in den Än-
fang des 14. Jahrhunderts3, Wir werden fie aber
nochmals um eine halbe bis eine ganze Gene-
ration früher datieren müffen, eine Änfid)t wie pe
Max Fjauttmann und pjans Karlinger aus
ftiliftifchen Gründen fchon feit über einem Jahr
mündlich vertreten haben. Der 3ufammenhang
mit der großen Monumentalplaftik der Mitte des
13. Jahrhunderts ift noch zurein, eigentliche 3üge
der Hochgotik, wie in dem fchlanken, hochge-
zogenen Petrus im Regensburger Dom ßnden
fich noch nicht4 *. Dagegen weift die dramatifcbe
Bewegtheit mit dem ftarken Wechfel von Licht
und Schatten, von ruhigen und bewegten Flächen
auf die Spätßufe eines faft barocken Übergangs-
ftils hin. Im Fränkifchen wird diefe Stufe etwa
1 Skizze d. Gefd). d. m. a. Plaftik im bayr. Stammlande:
3eitfd)r. d. bayr. Kunftgewerbevereins 1890, S. 57f.
2 Ä. Segler, Die m. a. Plaftik Regensburgs, München
1905, S.64ff. — B. Riet)!, Bayerns Donautal, Münd)enl912,
S. 116ff. m. Äbb.— KunftdenkmälerBayerns, Bd.II: Ober-
pfalz, F). XX: Stadtamhof, S. 222 f. m. Äbb. — Del)io.
Gefd)id)te der deutfchen Ranft, Bd. II, Berlin 1921, S. 105,
Äbb. 381.
3 Die gotifche Plaftik in Regensburg, Straßburg 1918,
S. 42ff.
4 B. Riehl, Donautal, Cafel 20.
Erminold'-Meifters?
Von GEORG LILL
von dem Grabmal Ottos v.Bodenlauben in Frauen
roth bei Kifpngen vertreten, das um 1270—1280
zu fetjen ift1, im (Heften durch den dritten Straß-
burger Stil am Dom um 12752 und durch die
Könige von Wimpfen im Cal zwifchen 1269 bis
12783. Äuch im Regensburger Kunftkreis pndet
pd) noch ein entfprechendes Kunßwerk, das
genau datierbare hervorragende Stadtpegel der
Stadt Regensburg vom Jahre 1251, das, wor-
auf mich Fjans Karlinger aufmerkfam macht
in Fjaltung, Gewandbehandlung und Kopftypus
des h>- Petrus ftark ftiliftifche Ähnlichkeit mit
dem hl* Petrus von der ülrichskapelle hat4. 3u
alledem ift das FJochgrab des fei. Erminold ur-
kundlich genau datiert, nur daß man bisher diefer
Datierung aus ftiliftifchen Gründen keinen Glau-
ben zumeffen wollte. Im Jahre 1283 ließ näm-
lich Bifd)of Heinrich die Gebeine des fei. Äbtes
Erminold, der 1121 geftorben war, erheben und
pe als die des Klofterpifters in einem Fjodbgrab
beife^en6. Nach unferer heutigen ftiliftifchen Er-
kenntnis liegt nicht der geringfte Grund vor, das
heute noch vorhandene FJochgrab nicht als das
von 1283 anzufehen.
3um Vergleich ziehe ich von den Werken des
Erminoldmeifters nur den Kopf des Erminold
heran, weil allein von ihm eine entfprechende
Detailaufnahme exiftiert6 (Äbb. 1). Ich ftelle diefe
Äufnahme neben zwei neue Äufnahmen derJo-
hannesfchüffel (Äbb. 2 u. 3), die in der Mufeums-
werkftätte gefertigt wurden.
Beim Kopf des fei. Erminold pnden wir die-
felbe pathetifch-monumentale Grundanlage, wie
auch in der Gewandbehandlung. Ein Äusdruck
von konzentrierter Willenskraft und eiferner
Energie, wie pe den großen Kolonifatoren des
Benediktinerordens eigen waren. Ein fchmaler,
afketifcber Kopf mit ftarken Backenknochen und
ausladender Stirne, die ziemlich niedrige Stirne
vom Denken und Sorgen zufammengezogen. Die
Äugen weitgeöffnet und in befehlsgewohnter
FJerrfchgewalt gerade gerichtet, ünter der fchma-
len, jedoch kräftigen Nafe ein willensftarker, et-
was wulftiger Mund. Das Ganze gerahmt in
rhythmifcher Gliederung von dem kronenartigen
1 Die Kunßdenkmäler Bayerns, Bd. III: tlnterfranken,
Fj. X: Kifpngen v. K. Gröber, S. 103f. u. C. IV u. V.
2 Otto Schmidt, Straßburg und die füddeutfche Monu-
mentalplaßik im 13. u. 14. fahrt)., Städel-Jaijrb. II (1922)*
S. 118 u. C. 31 c.
3 J. Baum, Gotifche Bildwerke Schwabens, Äugsburg
1921, C. 13 u. S. 139.
4 Das Rathaus zu Regensburg, Regensburg 1910, S.122f.
m. Äbb.
6 KunPd. B., Stadtamhof, a. a. O. S. 222, dort Belege.
6 Diefe Äufnahme (Stadtamhof, a. a. O. C. XIV) Pellte
mir ßerr Generaldirektor Prof. Pt)il. M. Fjalm EJÜtigß zur
Verfügung.
319