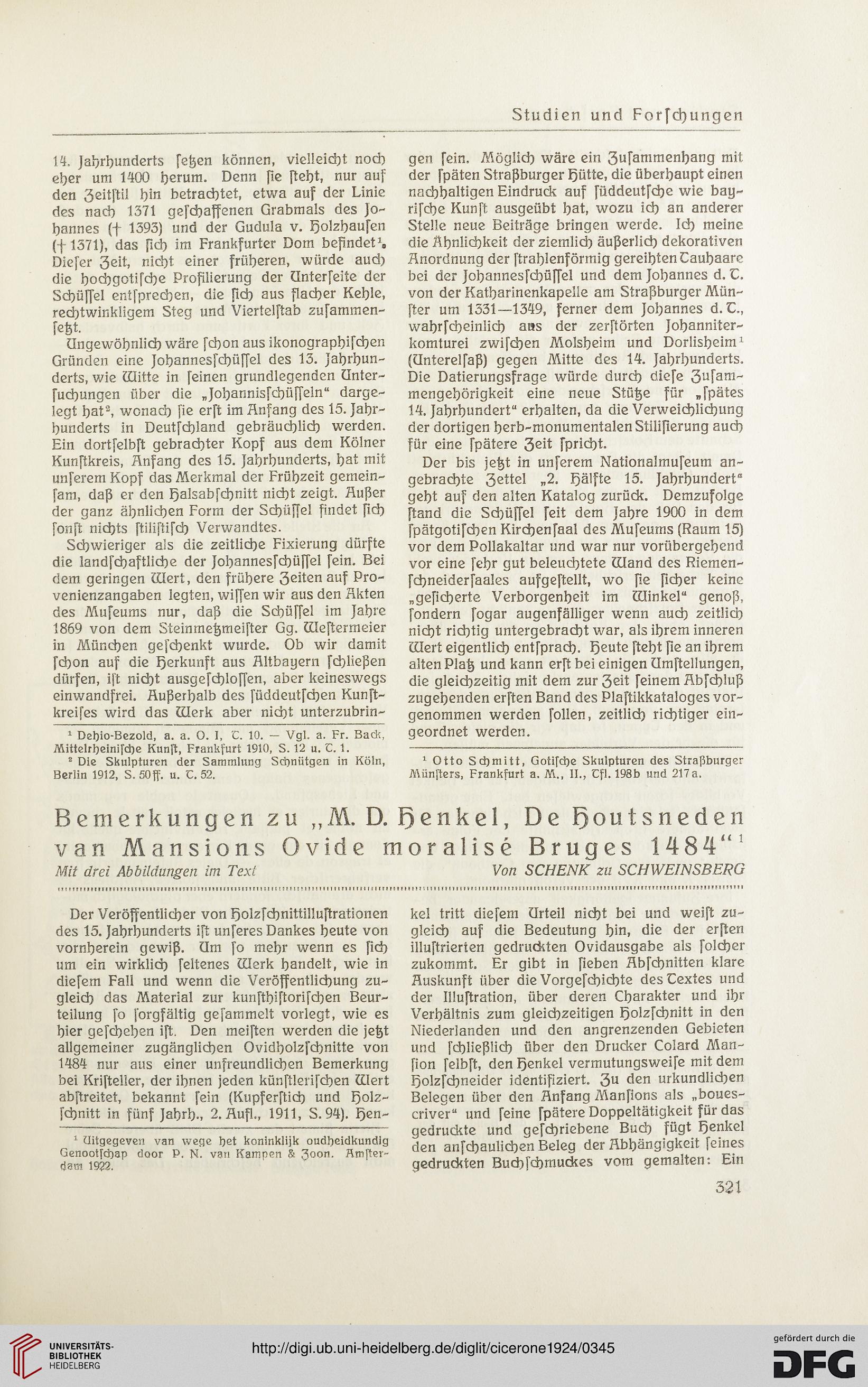Studien und Forfd)ungen
14, Jahrhunderts fetten können, vielleicht noch
eher um 1400 herum. Denn pe Peht, nur auf
den geitpil hin betrachtet, etwa auf der Linie
des nach 1371 gefcbajfenen Grabmals des Jo-
hannes (f 1393) und der Gudula v. ßolzbaufen
(f 1371), das pd) im Frankfurter Dom bepndet1 2.
Diefer 3eit, nicht einer früheren, würde aud)
die hodjgotifche Proplierung der Onterfeite der
Scpüffel entfpred)eri, die pd) aus Pacher Kehle,
rechtwinkligem Steg und Viertelftab zufammen-
fefet.
Qngewöbnlid) wäre fchon aus ikonograpbifcben
Gründen eine Johannesfchüffel des 13. Jahrhun-
derts, wie ÜHitte in feinen grundlegenden ünter-
fuchungen über die „Jol)annisfd)üffeln“ darge-
legt hat3, wonach fie erft im Änfang des 15. Jahr-
hunderts in Deutfdpand gebräuchlich wrerden.
Ein dortfelbft gebrachter Kopf aus dem Kölner
Kunftkreis, Änfang des 15. Jahrhunderts, hat mit
unferem Kopf das Merkmal der Frühzeit gernein-
fam, daß er den 5alsabfd)nitl nicht zeigt. Äußer
der ganz ähnlichen Form der Schüffel findet pd)
fonft nichts ftiliftifd) Verwandtes.
Schwieriger als die zeitliche Fixierung dürfte
die landfdjaftliche der Johannesfchüffel fein. Bei
dem geringen Qlert, den frühere 3eiten auf Pro-
venienzangaben legten, wißen wir aus den Äkten
des Mufeums nur, daß die Schöffel im Jahre
1869 von dem Sieinmetfmeißer Gg. ttleßerrneier
in München gefcßenkt wurde. Ob wir damit
fchon auf die fjcrkunft aus flitbayern fd)ließen
dürfen, ift nicht ausgefd)loffen, aber keineswegs
einwandfrei. Äußerhalb des füddeutfchen Kunft-
kreifes wird das ttlerk aber nicht unterzubrin-
1 Debio-Bczold, a. a. O. I, 'C. 10. — Vgl. a. Fr. Back,
Mittelrpeinifcbe Kunft, Frankfurt 1910, S. 12 u. C. 1.
2 Die Skulpturen der Sammlung Scßnütgen in Köln,
Berlin 1912, S. 50ff. u. €. 52.
gen fein. Möglich wäre ein 3ufammenbang mit
der fpäten Straßburger IJütte, die überhaupt einen
nachhaltigen Eindruck auf füddeutfche wie bay-
rifche Kunft ausgeübt hat, wozu ich an anderer
Stelle neue Beiträge bringen werde. Ich meine
die Ähnlichkeit der ziemlich äußerlich dekorativen
Änordnung der ftraßlenförmig gereihten Cauhaare
bei der Johannesfchüffel und dem Johannes d. Z.
von der Katharinenkapelle am Straßburger Mün-
fter um 1531—1349, ferner dem Johannes d. C.,
wahrfcheinlici) aas der zerftörten Johanniter-
komturei zwifchen Molsheim und Dorlisheim1
(Qnterelfaß) gegen Mitte des 14. Jahrhunderts.
Die Datierungsfrage würde durch diefe 3,Jfani-
mengehörigkeit eine neue Stütje für „fpätes
14. Jahrhundert“ erhalten, da die Verweichlichung
der dortigen herb-monumentalen Stiliperung auch
für eine fpätere 3eit fpricht.
Der bis jeljt in unferem Nationalmufeum an-
gebrachte 3ßttel „2. IJälfte 15. Jahrhundert“
geht auf den alten Katalog zurück. Demzufolge
ftand die Sd)üffel feit dem Jahre 1900 in dem
fpätgotifchen Kirchenfaal des Mufeums (Raum 15)
vor dem Pollakaltar und war nur vorübergehend
vor eine fehr gut beleuchtete Qland des Riemen-
fehneider faales aufgeftellt, wo pe pcher keine
„gefieberte Verborgenheit im GQinkel“ genoß,
fondern fogar augenfälliger wenn auch zeitlich
nicht richtig untergebracht war, als ihrem inneren
CQert eigentlich entfprad). PJeute ftelpt pe an ihrem
alten Platj und kann erß bei einigen Qmftellungen,
die gleichzeitig mit dem zur 3eit feinem Äbfchluß
zugehenden erften Band des Plaftikkataloges vor-
genommen werden füllen, zeitlich richtiger ein-
geordnet werden.
1 Otto Sd)mitt, Gotifdje Skulpturen des Straßburger
Münfters, Frankfurt a. M., II., Cfl. 198b und 217a.
Bemerkungen zu „M. D. ßenkel, De Fjoutsneden
van Man sions Ovide moralise B rüg es 1484“1
Mit drei Abbildungen im Text Von SCHENK zu SCHWEINSBERG
Der Veröffentlicher von Fjolzfcbnittillußrationen
des 15. Jahrhunderts ift unferes Dankes heute von
vornherein gewiß. Qm fo mehr wenn es [ich
um ein wirklich feltenes CQerk handelt, wie in
diefem Fall und wenn die Veröffentlichung zu-
gleich das Material zur kunftbiftorifeben Beur-
teilung fo forgfältig gefammelt vorlegt, wie es
hier gefd)ehen iß. Den meiften werden die jefet
allgemeiner zugänglichen Ovidbolzfdmitte von
1484 nur aus einer unfreundlichen Bemerkung
bei Krifteiler, der ihnen jeden künftlerifcben CQert
abßreitet, bekannt fein (Kupferftid) und IJolz-
febnitt in fünf Jabrl)., 2. Äuß., 1911, S. 94). f>en-
1 üitgegeven van wege Y>et koninklijk oudbeidkundig
Genootfd)ap door P. N. van Kämpen & 3°on- Hmfter-
dam 1922.
kel tritt diefem Qrteil nicht bei und weiß zu-
gleich auf die Bedeutung hin, die der erßen
illuftrierien gedruckten Ovidausgabe als folcber
zukommt. Er gibt in fieben Äbfcbnitten klare
Äuskunft über die Vorgefd)id)te desCextes und
der Illuftration, über deren Charakter und ihr
Verhältnis zum gleichzeitigen Fjolzfcbnitt in den
Niederlanden und den angrenzenden Gebieten
und fcbließlid) über den Drucker Colard Man-
fion feibß, den Fjenkel vermutungsweife mit dem
Bolzfchneider identipziert. 3U den urkundlichen
Belegen über den Änfang Manpons als „boues-
criver“ und feine fpätere Doppeltätigkeit für das
gedruckte und gefebriebene Buch fügt 5eakel
den anfcbaulicben Beleg der Äbl)ängigkeit feines
gedruckten Bucbfcbmudkes vom gemalten: Ein
321
14, Jahrhunderts fetten können, vielleicht noch
eher um 1400 herum. Denn pe Peht, nur auf
den geitpil hin betrachtet, etwa auf der Linie
des nach 1371 gefcbajfenen Grabmals des Jo-
hannes (f 1393) und der Gudula v. ßolzbaufen
(f 1371), das pd) im Frankfurter Dom bepndet1 2.
Diefer 3eit, nicht einer früheren, würde aud)
die hodjgotifche Proplierung der Onterfeite der
Scpüffel entfpred)eri, die pd) aus Pacher Kehle,
rechtwinkligem Steg und Viertelftab zufammen-
fefet.
Qngewöbnlid) wäre fchon aus ikonograpbifcben
Gründen eine Johannesfchüffel des 13. Jahrhun-
derts, wie ÜHitte in feinen grundlegenden ünter-
fuchungen über die „Jol)annisfd)üffeln“ darge-
legt hat3, wonach fie erft im Änfang des 15. Jahr-
hunderts in Deutfdpand gebräuchlich wrerden.
Ein dortfelbft gebrachter Kopf aus dem Kölner
Kunftkreis, Änfang des 15. Jahrhunderts, hat mit
unferem Kopf das Merkmal der Frühzeit gernein-
fam, daß er den 5alsabfd)nitl nicht zeigt. Äußer
der ganz ähnlichen Form der Schüffel findet pd)
fonft nichts ftiliftifd) Verwandtes.
Schwieriger als die zeitliche Fixierung dürfte
die landfdjaftliche der Johannesfchüffel fein. Bei
dem geringen Qlert, den frühere 3eiten auf Pro-
venienzangaben legten, wißen wir aus den Äkten
des Mufeums nur, daß die Schöffel im Jahre
1869 von dem Sieinmetfmeißer Gg. ttleßerrneier
in München gefcßenkt wurde. Ob wir damit
fchon auf die fjcrkunft aus flitbayern fd)ließen
dürfen, ift nicht ausgefd)loffen, aber keineswegs
einwandfrei. Äußerhalb des füddeutfchen Kunft-
kreifes wird das ttlerk aber nicht unterzubrin-
1 Debio-Bczold, a. a. O. I, 'C. 10. — Vgl. a. Fr. Back,
Mittelrpeinifcbe Kunft, Frankfurt 1910, S. 12 u. C. 1.
2 Die Skulpturen der Sammlung Scßnütgen in Köln,
Berlin 1912, S. 50ff. u. €. 52.
gen fein. Möglich wäre ein 3ufammenbang mit
der fpäten Straßburger IJütte, die überhaupt einen
nachhaltigen Eindruck auf füddeutfche wie bay-
rifche Kunft ausgeübt hat, wozu ich an anderer
Stelle neue Beiträge bringen werde. Ich meine
die Ähnlichkeit der ziemlich äußerlich dekorativen
Änordnung der ftraßlenförmig gereihten Cauhaare
bei der Johannesfchüffel und dem Johannes d. Z.
von der Katharinenkapelle am Straßburger Mün-
fter um 1531—1349, ferner dem Johannes d. C.,
wahrfcheinlici) aas der zerftörten Johanniter-
komturei zwifchen Molsheim und Dorlisheim1
(Qnterelfaß) gegen Mitte des 14. Jahrhunderts.
Die Datierungsfrage würde durch diefe 3,Jfani-
mengehörigkeit eine neue Stütje für „fpätes
14. Jahrhundert“ erhalten, da die Verweichlichung
der dortigen herb-monumentalen Stiliperung auch
für eine fpätere 3eit fpricht.
Der bis jeljt in unferem Nationalmufeum an-
gebrachte 3ßttel „2. IJälfte 15. Jahrhundert“
geht auf den alten Katalog zurück. Demzufolge
ftand die Sd)üffel feit dem Jahre 1900 in dem
fpätgotifchen Kirchenfaal des Mufeums (Raum 15)
vor dem Pollakaltar und war nur vorübergehend
vor eine fehr gut beleuchtete Qland des Riemen-
fehneider faales aufgeftellt, wo pe pcher keine
„gefieberte Verborgenheit im GQinkel“ genoß,
fondern fogar augenfälliger wenn auch zeitlich
nicht richtig untergebracht war, als ihrem inneren
CQert eigentlich entfprad). PJeute ftelpt pe an ihrem
alten Platj und kann erß bei einigen Qmftellungen,
die gleichzeitig mit dem zur 3eit feinem Äbfchluß
zugehenden erften Band des Plaftikkataloges vor-
genommen werden füllen, zeitlich richtiger ein-
geordnet werden.
1 Otto Sd)mitt, Gotifdje Skulpturen des Straßburger
Münfters, Frankfurt a. M., II., Cfl. 198b und 217a.
Bemerkungen zu „M. D. ßenkel, De Fjoutsneden
van Man sions Ovide moralise B rüg es 1484“1
Mit drei Abbildungen im Text Von SCHENK zu SCHWEINSBERG
Der Veröffentlicher von Fjolzfcbnittillußrationen
des 15. Jahrhunderts ift unferes Dankes heute von
vornherein gewiß. Qm fo mehr wenn es [ich
um ein wirklich feltenes CQerk handelt, wie in
diefem Fall und wenn die Veröffentlichung zu-
gleich das Material zur kunftbiftorifeben Beur-
teilung fo forgfältig gefammelt vorlegt, wie es
hier gefd)ehen iß. Den meiften werden die jefet
allgemeiner zugänglichen Ovidbolzfdmitte von
1484 nur aus einer unfreundlichen Bemerkung
bei Krifteiler, der ihnen jeden künftlerifcben CQert
abßreitet, bekannt fein (Kupferftid) und IJolz-
febnitt in fünf Jabrl)., 2. Äuß., 1911, S. 94). f>en-
1 üitgegeven van wege Y>et koninklijk oudbeidkundig
Genootfd)ap door P. N. van Kämpen & 3°on- Hmfter-
dam 1922.
kel tritt diefem Qrteil nicht bei und weiß zu-
gleich auf die Bedeutung hin, die der erßen
illuftrierien gedruckten Ovidausgabe als folcber
zukommt. Er gibt in fieben Äbfcbnitten klare
Äuskunft über die Vorgefd)id)te desCextes und
der Illuftration, über deren Charakter und ihr
Verhältnis zum gleichzeitigen Fjolzfcbnitt in den
Niederlanden und den angrenzenden Gebieten
und fcbließlid) über den Drucker Colard Man-
fion feibß, den Fjenkel vermutungsweife mit dem
Bolzfchneider identipziert. 3U den urkundlichen
Belegen über den Änfang Manpons als „boues-
criver“ und feine fpätere Doppeltätigkeit für das
gedruckte und gefebriebene Buch fügt 5eakel
den anfcbaulicben Beleg der Äbl)ängigkeit feines
gedruckten Bucbfcbmudkes vom gemalten: Ein
321