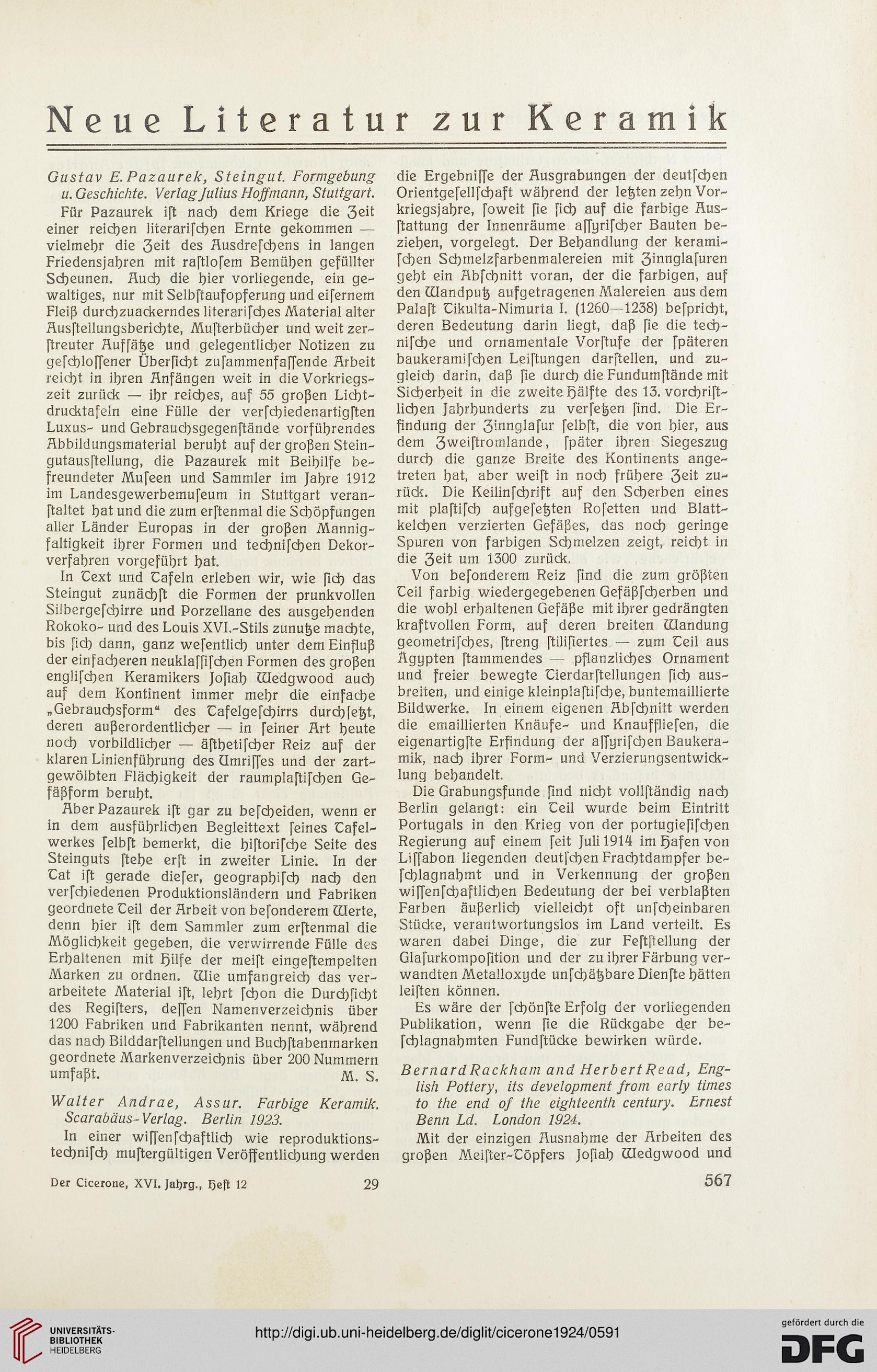Neue Literatur zur Keramik
Gustav E. Pazaurek, Steingut. Formgebung
u. Geschichte. Verlag Julius Hoffmann, Stuttgart.
Für Pazaurek ift nach dem Kriege die 3eit
einer reichen literarifcßen Ernte gekommen —
vielmehr die 3eit des Äusdrefcßens in langen
Friedensjahren mit raftlofem Bemühen gefüllter
Scheunen. Auch die hier vorliegende, ein ge-
waltiges, nur mit Selbftaufopferung und eifernem
Fleiß durchzuackerndes literarifches Material alter
Äusfteilungsberidjte, Mufterbücher und weit zer-
ftreuter Äuffäße und gelegentlicher Notizen zu
gefchloffener Überficht zufammenfaffende Arbeit
reicht in ihren Anfängen weit in die Vorkriegs-
zeit zurück — ihr reiches, auf 55 großen Licht-
drucktafeln eine Fülle der verfchiedenartigften
Luxus- und Gebrauchsgegenftände vorführendes
Äbbildungsmaterial beruht auf der großen Stein-
gutausftellung, die Pazaurek mit Beihilfe be-
freundeter Mufeen und Sammler im Jahre 1912
im Landesgewerbemufeum in Stuttgart veran-
ftaltet hat und die zum erftenmal die Schöpfungen
aller Länder Europas in der großen Mannig-
faltigkeit ihrer Formen und tecßnifchen Dekor-
verfahren vorgeführt hat.
In 'Cext und Cafeln erleben wir, wie pch das
Steingut zunächst die Formen der prunkvollen
Silbergefchirre und Porzellane des ausgehenden
Rokoko- und des Louis XVI.-Stils zunutze machte,
bis fid) dann, ganz wefentlicß unter dem Einfluß
der einfacheren neuklaffifcßen Formen des großen
englifcßen Keramikers Jofiah Kledgwood aud)
auf dem Kontinent immer mehr die einfache
„Gebrauchsform“ des Cafelgefd)irrs durchlebt,
deren außerordentlicher — in feiner Art heute
noch vorbildlicher — äfthetifcher Reiz auf der
klaren Linienführung des Qmrijfes und der zart-
gewölbten Fläcßigkeit der raumplaftifchen Ge-
fäßform beruht.
Aber Pazaurek ift gar zu befcheiden, wenn er
in dem ausführlichen Begleittext feines Cafel-
werkes felbft bemerkt, die hißorifcße Seite des
Steinguts ftehe erft in zweiter Linie. In der
Cat ift gerade diefer, geographifd) nach den
verfcßiedenen Produktionsländern und Fabriken
geordnete Ceil der Ärbeit von befonderem ftüerte,
denn hier ift dem Sammler zum erftenmal die
Möglichkeit gegeben, die verwirrende Fülle des
Erhaltenen mit fjilfe der meift eingeftempelten
Marken zu ordnen, die umfangreich das ver-
arbeitete Material ift, lehrt fcßon die Durchficht
des Regifters, deffen Namenverzeichnis über
1200 Fabriken und Fabrikanten nennt, während
das nad) Bilddarftellungen und Buchftabenrnarken
geordnete Markenverzeichnis über 200 Nummern
umfaßt. M. S.
Walter Andrae, Assur. Farbige Keramik.
Scarabäus- Verlag. Berlin 1923.
In einer wiffenfchaftlich wie reproduktions-
technifd) muftergültigen Veröffentlichung werden
die Ergebniffe der Ausgrabungen der deutfchen
Orientgefellfcßaft während der lebten zehn Vor-
kriegsjahre, foweit fie fid) auf die farbige Äus-
ftattung der Innenräume affyrifcher Bauten be-
ziehen, vorgelegt. Der Behandlung der kerami-
fchen Schmelzfarbenmalereien mit 3Mnglafuren
geht ein Äbfchnitt voran, der die farbigen, auf
den dandpuh aufgetragenen Malereien aus dem
Palaft Cikulta-Nimuria I. (1260—1238) befprid)t,
deren Bedeutung darin liegt, daß fie die tecß-
nifche und ornamentale Vorftufe der fpäteren
baukeramifchen Leitungen darftellen, und zu-
gleich darin, daß fie durch die Fundumftände mit
Sicherheit in die zweite Qälfte des 13. vorcßrift-
lid)en Jahrhunderts zu verfemen find. Die Er-
findung der Sinnglafur felbft, die von hier, aus
dem 3weiftromlande, fpäter ihren Siegeszug
durch die ganze Breite des Kontinents ange-
treten hat, aber weift in nod) frühere 3eit zu-
rück. Die Keilinfcßrift auf den Scherben eines
mit plaftifd) aufgefeßten Rofetten und Blatt-
kelchen verzierten Gefäßes, das noch geringe
Spuren von farbigen Schmelzen zeigt, reicht in
die 3ßit um 1300 zurück.
Von befonderem Reiz find die zum größten
Geil farbig wiedergegebenen Gefäßfeherben und
die wohl erhaltenen Gefäße mit ihrer gedrängten
kraftvollen Form, auf deren breiten üdandung
geometrifches, ftreng ftilijlertes — zum Ceil aus
Ägypten ftammendes — pflanzliches Ornament
und freier bewegte Cierdarftellutigen fid) aus-
breiten, und einige kleinplaftifche, buntemaillierte
Bildwerke. In einem eigenen Äbfchnitt werden
die emaillierten Knäufe- und Knauffliefen, die
eigenartigfte Erfindung der affyrifchen Baukera-
mik, nad) ihrer Form- und Verzierungsentwick-
lung behandelt.
Die Grabungsfunde find nicht vollftändig nach
Berlin gelangt: ein Ceil wurde beim Eintritt
Portugals in den Krieg von der portugiepfeßen
Regierung auf einem feit Juli 1914 im IJafen Von
Liffabon liegenden deutfchen Frachtdampfer be-
fd)lagnahmt und in Verkennung der großen
wiffenfchaftlichen Bedeutung der bei verblaßten
Farben äußerlich vielleicht oft unfeßeinbaren
Stücke, verantwortungslos im Land verteilt. Es
waren dabei Dinge, die zur Feftftellung der
Glafurkompofition und der zu ihrer Färbung ver-
wandten Metalloxyde unfcßäßbare Dienfte hätten
leiften können.
Es wäre der fcßönße Erfolg der vorliegenden
Publikation, wenn pe die Rückgabe der be-
fcßlagnahmten Fundftücke bewirken würde.
Bernard Rackham and Herbert Read, Eng-
lish Pottery, its development from early times
to the end of the eighteenth Century. Ernest
Benn Ld. London 1924.
Mit der einzigen Ausnahme der Arbeiten des
großen Meifter-Cöpfers Jofiah tüedgwood und
567
Der Cicerone, XVI. Jaljrg., Ijeft 12
29
Gustav E. Pazaurek, Steingut. Formgebung
u. Geschichte. Verlag Julius Hoffmann, Stuttgart.
Für Pazaurek ift nach dem Kriege die 3eit
einer reichen literarifcßen Ernte gekommen —
vielmehr die 3eit des Äusdrefcßens in langen
Friedensjahren mit raftlofem Bemühen gefüllter
Scheunen. Auch die hier vorliegende, ein ge-
waltiges, nur mit Selbftaufopferung und eifernem
Fleiß durchzuackerndes literarifches Material alter
Äusfteilungsberidjte, Mufterbücher und weit zer-
ftreuter Äuffäße und gelegentlicher Notizen zu
gefchloffener Überficht zufammenfaffende Arbeit
reicht in ihren Anfängen weit in die Vorkriegs-
zeit zurück — ihr reiches, auf 55 großen Licht-
drucktafeln eine Fülle der verfchiedenartigften
Luxus- und Gebrauchsgegenftände vorführendes
Äbbildungsmaterial beruht auf der großen Stein-
gutausftellung, die Pazaurek mit Beihilfe be-
freundeter Mufeen und Sammler im Jahre 1912
im Landesgewerbemufeum in Stuttgart veran-
ftaltet hat und die zum erftenmal die Schöpfungen
aller Länder Europas in der großen Mannig-
faltigkeit ihrer Formen und tecßnifchen Dekor-
verfahren vorgeführt hat.
In 'Cext und Cafeln erleben wir, wie pch das
Steingut zunächst die Formen der prunkvollen
Silbergefchirre und Porzellane des ausgehenden
Rokoko- und des Louis XVI.-Stils zunutze machte,
bis fid) dann, ganz wefentlicß unter dem Einfluß
der einfacheren neuklaffifcßen Formen des großen
englifcßen Keramikers Jofiah Kledgwood aud)
auf dem Kontinent immer mehr die einfache
„Gebrauchsform“ des Cafelgefd)irrs durchlebt,
deren außerordentlicher — in feiner Art heute
noch vorbildlicher — äfthetifcher Reiz auf der
klaren Linienführung des Qmrijfes und der zart-
gewölbten Fläcßigkeit der raumplaftifchen Ge-
fäßform beruht.
Aber Pazaurek ift gar zu befcheiden, wenn er
in dem ausführlichen Begleittext feines Cafel-
werkes felbft bemerkt, die hißorifcße Seite des
Steinguts ftehe erft in zweiter Linie. In der
Cat ift gerade diefer, geographifd) nach den
verfcßiedenen Produktionsländern und Fabriken
geordnete Ceil der Ärbeit von befonderem ftüerte,
denn hier ift dem Sammler zum erftenmal die
Möglichkeit gegeben, die verwirrende Fülle des
Erhaltenen mit fjilfe der meift eingeftempelten
Marken zu ordnen, die umfangreich das ver-
arbeitete Material ift, lehrt fcßon die Durchficht
des Regifters, deffen Namenverzeichnis über
1200 Fabriken und Fabrikanten nennt, während
das nad) Bilddarftellungen und Buchftabenrnarken
geordnete Markenverzeichnis über 200 Nummern
umfaßt. M. S.
Walter Andrae, Assur. Farbige Keramik.
Scarabäus- Verlag. Berlin 1923.
In einer wiffenfchaftlich wie reproduktions-
technifd) muftergültigen Veröffentlichung werden
die Ergebniffe der Ausgrabungen der deutfchen
Orientgefellfcßaft während der lebten zehn Vor-
kriegsjahre, foweit fie fid) auf die farbige Äus-
ftattung der Innenräume affyrifcher Bauten be-
ziehen, vorgelegt. Der Behandlung der kerami-
fchen Schmelzfarbenmalereien mit 3Mnglafuren
geht ein Äbfchnitt voran, der die farbigen, auf
den dandpuh aufgetragenen Malereien aus dem
Palaft Cikulta-Nimuria I. (1260—1238) befprid)t,
deren Bedeutung darin liegt, daß fie die tecß-
nifche und ornamentale Vorftufe der fpäteren
baukeramifchen Leitungen darftellen, und zu-
gleich darin, daß fie durch die Fundumftände mit
Sicherheit in die zweite Qälfte des 13. vorcßrift-
lid)en Jahrhunderts zu verfemen find. Die Er-
findung der Sinnglafur felbft, die von hier, aus
dem 3weiftromlande, fpäter ihren Siegeszug
durch die ganze Breite des Kontinents ange-
treten hat, aber weift in nod) frühere 3eit zu-
rück. Die Keilinfcßrift auf den Scherben eines
mit plaftifd) aufgefeßten Rofetten und Blatt-
kelchen verzierten Gefäßes, das noch geringe
Spuren von farbigen Schmelzen zeigt, reicht in
die 3ßit um 1300 zurück.
Von befonderem Reiz find die zum größten
Geil farbig wiedergegebenen Gefäßfeherben und
die wohl erhaltenen Gefäße mit ihrer gedrängten
kraftvollen Form, auf deren breiten üdandung
geometrifches, ftreng ftilijlertes — zum Ceil aus
Ägypten ftammendes — pflanzliches Ornament
und freier bewegte Cierdarftellutigen fid) aus-
breiten, und einige kleinplaftifche, buntemaillierte
Bildwerke. In einem eigenen Äbfchnitt werden
die emaillierten Knäufe- und Knauffliefen, die
eigenartigfte Erfindung der affyrifchen Baukera-
mik, nad) ihrer Form- und Verzierungsentwick-
lung behandelt.
Die Grabungsfunde find nicht vollftändig nach
Berlin gelangt: ein Ceil wurde beim Eintritt
Portugals in den Krieg von der portugiepfeßen
Regierung auf einem feit Juli 1914 im IJafen Von
Liffabon liegenden deutfchen Frachtdampfer be-
fd)lagnahmt und in Verkennung der großen
wiffenfchaftlichen Bedeutung der bei verblaßten
Farben äußerlich vielleicht oft unfeßeinbaren
Stücke, verantwortungslos im Land verteilt. Es
waren dabei Dinge, die zur Feftftellung der
Glafurkompofition und der zu ihrer Färbung ver-
wandten Metalloxyde unfcßäßbare Dienfte hätten
leiften können.
Es wäre der fcßönße Erfolg der vorliegenden
Publikation, wenn pe die Rückgabe der be-
fcßlagnahmten Fundftücke bewirken würde.
Bernard Rackham and Herbert Read, Eng-
lish Pottery, its development from early times
to the end of the eighteenth Century. Ernest
Benn Ld. London 1924.
Mit der einzigen Ausnahme der Arbeiten des
großen Meifter-Cöpfers Jofiah tüedgwood und
567
Der Cicerone, XVI. Jaljrg., Ijeft 12
29