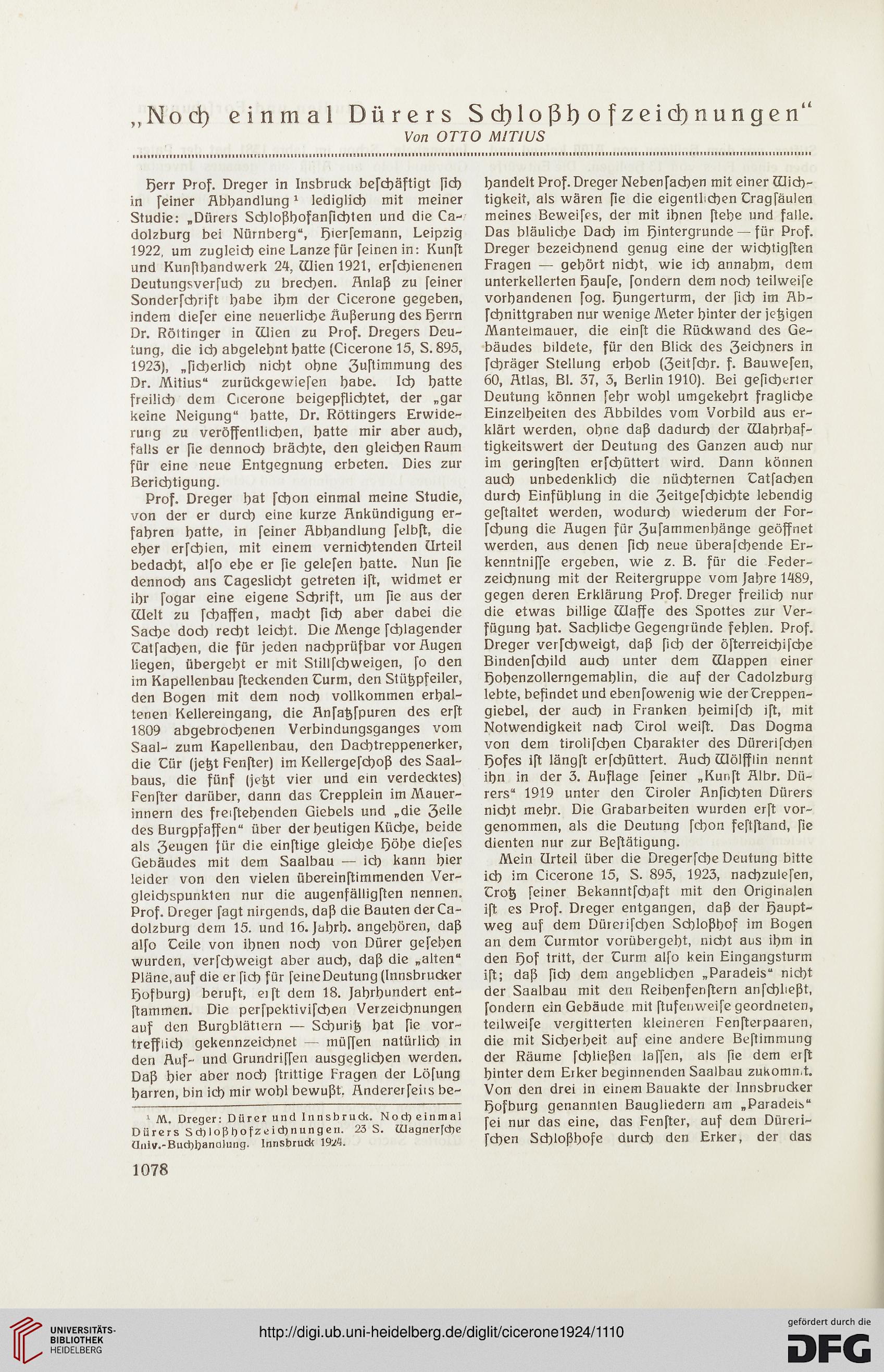„Nod) einmal Dürers Sc^loßßofzeicßnungen“
Von OTTO MJTJUS
Herr Prof. Dreger in Insbruck befd)äftigt pd)
in feiner Abhandlung1 lediglich mit meiner
Studie: „Dürers Scbloßbofanpd)ten und die Ca-
dolzburg bei Nürnberg“, Fjierfemann, Leipzig
1922, um zugleid) eine Lanze für feinen in: Kunft
und Kunftbandwerk 24, Cüien 1921, erfd)ienenen
Deutungsverfud) zu brecben. Anlaß zu feiner
Sonderfcßrift habe ißm der Cicerone gegeben,
indem diefer eine neuerliche Äußerung des Qerrn
Dr. Röttinger in Klien zu Prof. Dregers Deu-
tung, die id) abgelebnt batte (Cicerone 15, S. 895,
1923), „fid)er!icb nicbt obne 3uftimmung des
Dr. Mitius“ zurückgewiefen babe. Id) batte
freilich dem Cicerone beigepflicbtet, der „gar
keine Neigung“ batte, Dr. Röttingers Erwide-
rung zu veröffentlichen, batte mir aber aud),
falls er pe dennoch brächte, den gleichen Raum
für eine neue Entgegnung erbeten. Dies zur
Berichtigung.
Prof. Dreger hat fchon einmal meine Studie,
von der er durch eine kurze Ankündigung er-
fahren hatte, in feiner Abhandlung felbft, die
eher erfd)ien, mit einem vernichtenden ürteil
bedacht, alfo ehe er fie gelefen hatte. Nun pe
dennoch ans Cageslid)t getreten ift, widmet er
ihr fogar eine eigene Schrift, um pe aus der
Kielt zu fcbaffen, macht fid) aber dabei die
Sache doch recht leicht. Die Menge fdglagender
Catfachen, die für jeden nachprüfbar vor Augen
liegen, übergeht er mit Stillfchweigen, fo den
im Kapellenbau fteckenden Curm, den Stützpfeiler,
den Bogen mit dem noch vollkommen erhal-
tenen Kellereingang, die Anfatzfpuren des erft
1809 abgebrochenen Verbindungsganges vom
Saal- zum Kapellenbau, den Dad)treppenerker,
die Cür (jetzt Fenfter) im Kellergefchoß des Saal-
baus, die fünf (jetzt vier und ein verdecktes)
Fenfter darüber, dann das Crepplein im Mauer-
innern des freiftebenden Giebels und „die 3eile
des Burgpfaffen“ über der heutigen Küche, beide
als 3eugen für die einftige gleiche Fjöbe diefes
Gebäudes mit dem Saalbau — ich kann hier
leider von den vielen übereinftimmenden Ver-
gleichspunkten nur die augenfälligften nennen.
Prof. Dreger fagt nirgends, daß die Bauten derCa-
dolzburg dem 15. und 16. Jahrt). angehören, daß
alfo Ceile von ihnen nod) von Dürer gefehen
wurden, verfchweigt aber aud), daß die „alten“
Pläne,auf die er fid) für feineDeutung (Innsbrucker
Hofburg) beruft, eift dern 18. Jahrhundert ent-
flammen. Die perfpektivifcberi Verzeichnungen
auf den Burgblättern — Scburijz hat pe vor-
treffiid) gekennzeichnet — muffen natürlich in
den Auf- und Grundriffen ausgeglichen werden.
Daß hier aber noch ftrittige Fragen der Löfung
harren, bin ich mir wohl bewußt. Ändererfeiis be-
1 M. Dreger: Dürer und Innsbruck. Nodjeinmal
Dürers Sd)loßi)ofzeid)nungen. 23 S. tüagnerfcße
Clniv.-Bud)l)ano)ung. Innsbruck 19‘A.
handelt Prof. Dreger Nebenfachen mit einer Klicb-
tigkeit, als wären fie die eigentlichen Cragfäulen
meines Beweifes, der mit ihnen ftebe und falle.
Das bläuliche Dach im Hintergründe — für Prof.
Dreger bezeichnend genug eine der wid)tigften
Fragen — gehört nicht, wie id) annahm, dem
unterkellerten Haufe, fondern dem noch teilweife
vorhandenen fog. Hungedurm, der fid) im Ab-
fcbnittgraben nur wenige Meter hinter der jetzigen
Mantelmauer, die einft die Rückwand des Ge-
bäudes bildete, für den Bück des 3e|cbners in
fchräger Stellung erhob (3eitfd)r. f. Bauwefen,
60, Atlas, Bl. 37, 3, Berlin 1910). Bei gefieberter
Deutung können febr wohl umgekehrt fragliche
Einzelheiten des Abbildes vom Vorbild aus er-
klärt werden, ohne daß dadurch der Klaprbaf-
tigkeitswert der Deutung des Ganzen aud) nur
im geringften erfchüttert wird. Dann können
aud) unbedenklich die nüchternen Catfachen
durch Einfühlung in die 3eitgefd)id)te lebendig
geftaltet werden, wodurch wiederum der For-
fchung die Augen für 3ufarnmenl)änge geöffnet
werden, aus denen fid) neue überafebende Er-
kenntniffe ergeben, wie z. B. für die Feder-
zeichnung mit der Reitergruppe vom Jahre 1489,
gegen deren Erklärung Prof. Dreger freilich nur
die etwas billige Klaffe des Spottes zur Ver-
fügung hat. Sachliche Gegengründe fehlen. Prof.
Dreger verfchweigt, daß fid) der öfterreid)ifcbe
Bindenfcbild auch unter dem Klappen einer
Hohenzollerngemahlin, die auf der Cadolzburg
lebte, befindet und ebenfowenig wie derCreppen-
giebel, der aud) in Franken beimifd) ift, mit
Notwendigkeit nach Cirol weift. Das Dogma
von dem tirolifchen Charakter des Dürerifcben
Hofes i[t längft erfchüttert. Aud) Klölfflin nennt
ihn in der 3. Auflage feiner „Kunft Albr. Dü-
rers“ 1919 unter den Ciroler Anfichten Dürers
nicht mehr. Die Grabarbeiten wurden erft vor-
genommen, als die Deutung fchon feftftand, fie
dienten nur zur Betätigung.
Mein ürteil über die Dregerfcbe Deutung bitte
id) im Cicerone 15, S. 895, 1923, nachzulefen,
Crofz feiner Bekanntfcbaft mit den Originalen
ift es Prof. Dreger entgangen, daß der Haupt-
weg auf dem Dürerifchen Schloßhof im Bogen
an dem Curmtor vorübergeht, nicht aus ihm in
den Hof tritt, der Curm alfo kein Eingangsturm
ift; daß fid) dem angeblichen „Paradeis“ nicht
der Saalbau mit den Reibenfenftern anfd)ließt,
fondern ein Gebäude mit ftufenweife geordneten,
teilweife vergitterten kleineren Fenfterpaaren,
die mit Sicherheit auf eine andere Beftirnmung
der Räume fchüeßen laffen, als pe dem erft
hinter dem Erker beginnenden Saalbau zukomrr.t.
Von den drei in einem Bauakte der Innsbrucker
Hofburg genannten Baugliedern am „Paradeis“
fei nur das eine, das Fenfter, auf dem Düreri-
feben Sd)loßbofe durch den Erker, der das
1078
Von OTTO MJTJUS
Herr Prof. Dreger in Insbruck befd)äftigt pd)
in feiner Abhandlung1 lediglich mit meiner
Studie: „Dürers Scbloßbofanpd)ten und die Ca-
dolzburg bei Nürnberg“, Fjierfemann, Leipzig
1922, um zugleid) eine Lanze für feinen in: Kunft
und Kunftbandwerk 24, Cüien 1921, erfd)ienenen
Deutungsverfud) zu brecben. Anlaß zu feiner
Sonderfcßrift habe ißm der Cicerone gegeben,
indem diefer eine neuerliche Äußerung des Qerrn
Dr. Röttinger in Klien zu Prof. Dregers Deu-
tung, die id) abgelebnt batte (Cicerone 15, S. 895,
1923), „fid)er!icb nicbt obne 3uftimmung des
Dr. Mitius“ zurückgewiefen babe. Id) batte
freilich dem Cicerone beigepflicbtet, der „gar
keine Neigung“ batte, Dr. Röttingers Erwide-
rung zu veröffentlichen, batte mir aber aud),
falls er pe dennoch brächte, den gleichen Raum
für eine neue Entgegnung erbeten. Dies zur
Berichtigung.
Prof. Dreger hat fchon einmal meine Studie,
von der er durch eine kurze Ankündigung er-
fahren hatte, in feiner Abhandlung felbft, die
eher erfd)ien, mit einem vernichtenden ürteil
bedacht, alfo ehe er fie gelefen hatte. Nun pe
dennoch ans Cageslid)t getreten ift, widmet er
ihr fogar eine eigene Schrift, um pe aus der
Kielt zu fcbaffen, macht fid) aber dabei die
Sache doch recht leicht. Die Menge fdglagender
Catfachen, die für jeden nachprüfbar vor Augen
liegen, übergeht er mit Stillfchweigen, fo den
im Kapellenbau fteckenden Curm, den Stützpfeiler,
den Bogen mit dem noch vollkommen erhal-
tenen Kellereingang, die Anfatzfpuren des erft
1809 abgebrochenen Verbindungsganges vom
Saal- zum Kapellenbau, den Dad)treppenerker,
die Cür (jetzt Fenfter) im Kellergefchoß des Saal-
baus, die fünf (jetzt vier und ein verdecktes)
Fenfter darüber, dann das Crepplein im Mauer-
innern des freiftebenden Giebels und „die 3eile
des Burgpfaffen“ über der heutigen Küche, beide
als 3eugen für die einftige gleiche Fjöbe diefes
Gebäudes mit dem Saalbau — ich kann hier
leider von den vielen übereinftimmenden Ver-
gleichspunkten nur die augenfälligften nennen.
Prof. Dreger fagt nirgends, daß die Bauten derCa-
dolzburg dem 15. und 16. Jahrt). angehören, daß
alfo Ceile von ihnen nod) von Dürer gefehen
wurden, verfchweigt aber aud), daß die „alten“
Pläne,auf die er fid) für feineDeutung (Innsbrucker
Hofburg) beruft, eift dern 18. Jahrhundert ent-
flammen. Die perfpektivifcberi Verzeichnungen
auf den Burgblättern — Scburijz hat pe vor-
treffiid) gekennzeichnet — muffen natürlich in
den Auf- und Grundriffen ausgeglichen werden.
Daß hier aber noch ftrittige Fragen der Löfung
harren, bin ich mir wohl bewußt. Ändererfeiis be-
1 M. Dreger: Dürer und Innsbruck. Nodjeinmal
Dürers Sd)loßi)ofzeid)nungen. 23 S. tüagnerfcße
Clniv.-Bud)l)ano)ung. Innsbruck 19‘A.
handelt Prof. Dreger Nebenfachen mit einer Klicb-
tigkeit, als wären fie die eigentlichen Cragfäulen
meines Beweifes, der mit ihnen ftebe und falle.
Das bläuliche Dach im Hintergründe — für Prof.
Dreger bezeichnend genug eine der wid)tigften
Fragen — gehört nicht, wie id) annahm, dem
unterkellerten Haufe, fondern dem noch teilweife
vorhandenen fog. Hungedurm, der fid) im Ab-
fcbnittgraben nur wenige Meter hinter der jetzigen
Mantelmauer, die einft die Rückwand des Ge-
bäudes bildete, für den Bück des 3e|cbners in
fchräger Stellung erhob (3eitfd)r. f. Bauwefen,
60, Atlas, Bl. 37, 3, Berlin 1910). Bei gefieberter
Deutung können febr wohl umgekehrt fragliche
Einzelheiten des Abbildes vom Vorbild aus er-
klärt werden, ohne daß dadurch der Klaprbaf-
tigkeitswert der Deutung des Ganzen aud) nur
im geringften erfchüttert wird. Dann können
aud) unbedenklich die nüchternen Catfachen
durch Einfühlung in die 3eitgefd)id)te lebendig
geftaltet werden, wodurch wiederum der For-
fchung die Augen für 3ufarnmenl)änge geöffnet
werden, aus denen fid) neue überafebende Er-
kenntniffe ergeben, wie z. B. für die Feder-
zeichnung mit der Reitergruppe vom Jahre 1489,
gegen deren Erklärung Prof. Dreger freilich nur
die etwas billige Klaffe des Spottes zur Ver-
fügung hat. Sachliche Gegengründe fehlen. Prof.
Dreger verfchweigt, daß fid) der öfterreid)ifcbe
Bindenfcbild auch unter dem Klappen einer
Hohenzollerngemahlin, die auf der Cadolzburg
lebte, befindet und ebenfowenig wie derCreppen-
giebel, der aud) in Franken beimifd) ift, mit
Notwendigkeit nach Cirol weift. Das Dogma
von dem tirolifchen Charakter des Dürerifcben
Hofes i[t längft erfchüttert. Aud) Klölfflin nennt
ihn in der 3. Auflage feiner „Kunft Albr. Dü-
rers“ 1919 unter den Ciroler Anfichten Dürers
nicht mehr. Die Grabarbeiten wurden erft vor-
genommen, als die Deutung fchon feftftand, fie
dienten nur zur Betätigung.
Mein ürteil über die Dregerfcbe Deutung bitte
id) im Cicerone 15, S. 895, 1923, nachzulefen,
Crofz feiner Bekanntfcbaft mit den Originalen
ift es Prof. Dreger entgangen, daß der Haupt-
weg auf dem Dürerifchen Schloßhof im Bogen
an dem Curmtor vorübergeht, nicht aus ihm in
den Hof tritt, der Curm alfo kein Eingangsturm
ift; daß fid) dem angeblichen „Paradeis“ nicht
der Saalbau mit den Reibenfenftern anfd)ließt,
fondern ein Gebäude mit ftufenweife geordneten,
teilweife vergitterten kleineren Fenfterpaaren,
die mit Sicherheit auf eine andere Beftirnmung
der Räume fchüeßen laffen, als pe dem erft
hinter dem Erker beginnenden Saalbau zukomrr.t.
Von den drei in einem Bauakte der Innsbrucker
Hofburg genannten Baugliedern am „Paradeis“
fei nur das eine, das Fenfter, auf dem Düreri-
feben Sd)loßbofe durch den Erker, der das
1078