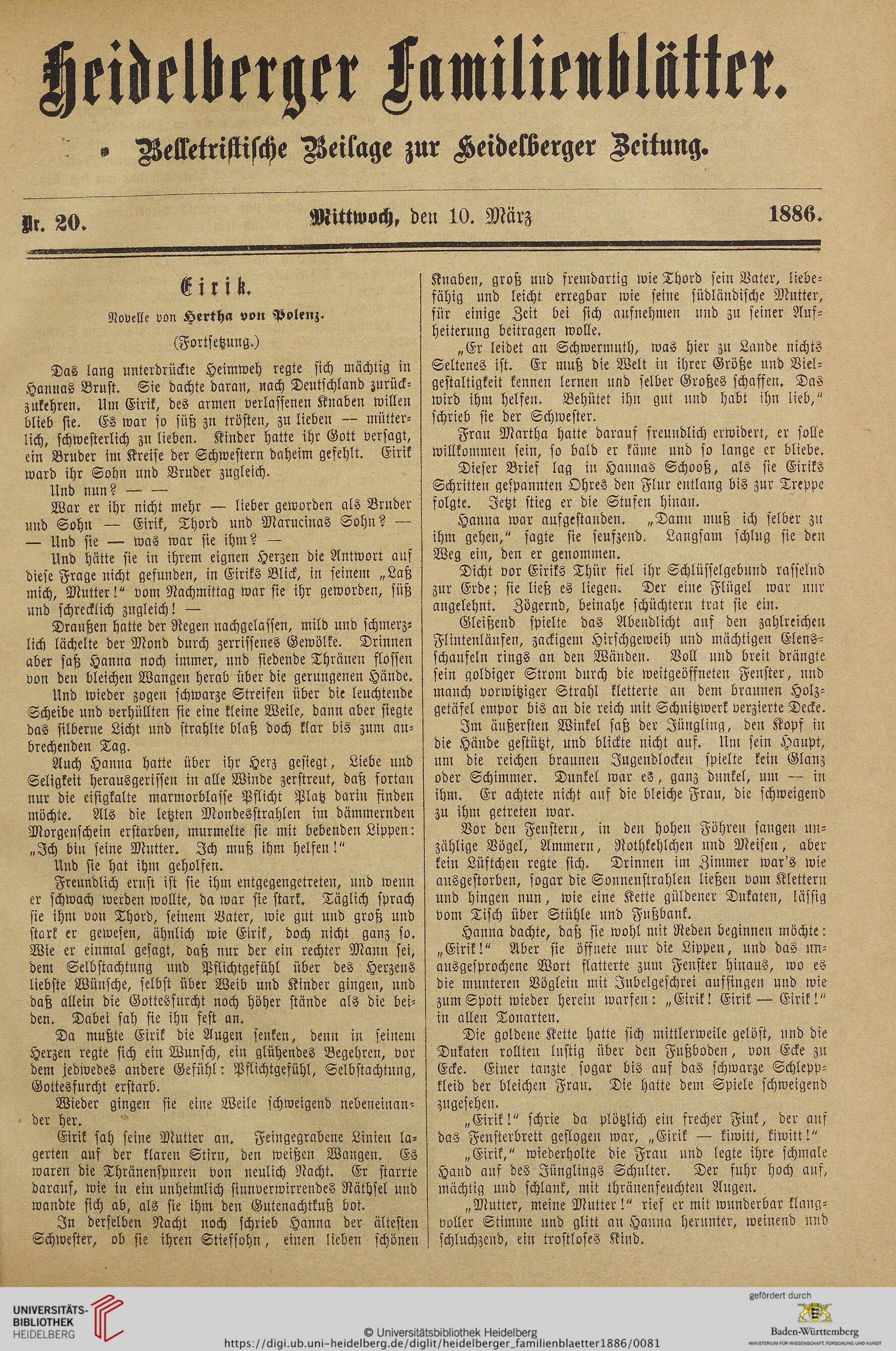Heidelberger ganilienblätter.
Belletriſtiſche Beilage zur Heidelberger Seitung.
Ar. 20.
Mittwoch, den 10. März
1886.
Eitik.
Novelle von Hertha von Polenz.
CGortſetzung.)
Das lang unterdrückte Heimweh regte ſich mächtig in
Hannas Bruſt. Sie dachte daran, nach Deutſchland zurück-
zukehren.
blieb ſie.
lich, ſchweſterlich zu lieben.
ein Bruder im Kreiſe der Schweſtern daheim gefehlt.
ward ihr Sohn und Vruder zugleich.
Und nun? — —
War er ihr nicht mehr — lieber geworden als Bruder
und Sohn — Eirik, Thord und Marucinas Sohn? —
— Und ſie — was war ſie ihm? —
Und hätte ſie in ihrem eignen Herzen die Antwort auf
dieſe Frage nicht gefunden, in Eiriks Blick, in ſeinem „Laß
mich, Mutter!“ vom Nachmittag war ſie ihr geworden, ſüß
und ſchrecklich zugleich! —
Draußen hatte der Regen nachgelaſſen, mild und ſchmerz-
lich lächelte der Mond durch zerriſſenes Gewölke. Drinnen
aber ſaß Hanna noch immer, und ſiedende Thränen floſſen
von den bleichen Wangen herab über die gerungenen Hände.
Und wieder zogen ſchwarze Streifen über die leuchtende
Scheibe und verhüllten ſie eine kleine Weile, dann aber ſiegte
das ſilberne Licht und ſtrahlte blaß doch klar bis zum an-
brechenden Tag.
Auch Hanna hatte über ihr Herz geſiegt, Liebe und
Seligkeit herausgeriſſen in alle Winde zerſtreut, daß fortan
nur die eiſigkalte marmorblaſſe Pflicht Platz darin finden
möchte. Als die letzten Mondesſtrahlen im dämmernden
Morgenſchein erſtarben, murmelte ſie mit bebenden Lippen:
„Ich bin ſeine Mutter. Ich muß ihm helfen!“
Und ſie hat ihm geholfen.
Freundlich ernſt iſt ſie ihm entgegengetreten, und wenn
er ſchwach werden wollte, da war ſie ſtark. Täglich ſprach
ſie ihm von Thord, ſeinem Vater, wie gut und groß und
ſtark er geweſen, ähnlich wie Eirik, doch nicht ganz ſo.
Wie er einmal geſagt, daß nur der ein rechter Mann ſei,
dem Selbſtachtung und Pflichtgefühl über des Herzens
liebſte Wünſche, ſelbſt über Weib und Kinder gingen, und
daß allein die Gottesfurcht noch höher ſtände als die bei-
den. Dabei ſah ſie ihn feſt an.
Es war ſo ſüß zu tröſten, zu lieben — mütter-
Kinder hatte ihr Gott verſagt,
Da mußte Eirik die Augen ſenken, denn in ſeinem
Herzen regte ſich ein Wunſch, ein glühendes Begehren, vor
dem jedwedes andere Gefühl: Pflichtgefühl, Selbſtachtung,
Gottesfurcht erſtarb.
Wieder gingen ſie eine Weile
der her.
Eirik ſah ſeine Mutter an. Feingegrabene Linien la-
gerten auf der klaren Stirn, den weißen Wangen. Es
waren die Thränenſpuren von neulich Nacht.
darauf, wie in ein unheimlich ſinnverwirrendes Räthſel und
wandte ſich ab, als ſie ihm den Gutenachtkuß bot.
In derfelben Nacht noch ſchrieb Hanna der älteſten
Schweſter, ob ſie ihren Stiefſohn, einen lieben ſchönen
ſchweigend nebeneinan-
Um Eirik, des armen verlaſſenen Knaben willen
Cirik
„Eirik!“
zum Spott wieder herein warfen:
Er ſtarrte
Knaben, groß und fremdartig wie Thord ſein Vater, liebe-
fähig und leicht erregbar wie ſeine ſüdländiſche Mutter,
für einige Zeit bei ſich aufnehmen und zu ſeiner Auf-
heiterung beitragen wolle.
„Er leidet an Schwermuth, was hier zu Lande nichts
Seltenes iſt. Er muß die Welt in ihrer Größe und Viel-
geſtaltigkeit kennen lernen und ſelber Großes ſchaffen. Das
wird ihm helfen. Behütet ihn gut und habt ihn lieb,“
ſchrieb ſie der Schweſter.
Frau Martha hatte darauf freundlich erwidert, er ſolle
willkommen ſein, ſo bald er käme und ſo lange er bliebe.
Dieſer Brief lag in Hannas Schooß, als ſie Eiriks
Schritten geſpannten Ohres den Flur entlang bis zur Treppe
folgte. Jetzt ſtieg er die Stufen hinan.
Hanna war aufgeſtanden. „Dann muß ich ſelber zu
ihm gehen,“ ſagte ſie ſeufzend. Langſam ſchlug ſie den
Weg ein, den er genommen. ö
Dicht vor Eiriks Thür fiel ihr Schlüſſelgebund raſſelnd
zur Erde; ſie ließ es liegen. Der eine Flügel war nur
angelehnt. Zögernd, beinahe ſchüchtern trat ſie ein.
Gleißend ſpielte das Abendlicht auf den zahlreichen
Flintenläufen, zackigem Hirſchgeweih und mächtigen Elens-
ſchaufeln rings an den Wänden. Voll und breit drängte
ſein goldiger Strom durch die weitgeöffneten Fenſter, und
manch vorwitziger Strahl kletterte an dem braunen Holz-
getäfel empor bis an die reich mit Schnitzwerk verzierte Decke.
Im äußerſten Winkel ſaß der Jüngling, den Kopf in
die Hände geſtützt, und blickte nicht auf. Um ſein Haupt,
um die reichen braunen Jugendlocken ſpielte kein Glanz
oder Schimmer. Dunkel war es, ganz dunkel, um — in
ihm. Er achtete nicht auf die bleiche Frau, die ſchweigend
zu ihm getreten war.
Vor den Fenſtern, in den hohen Föhren ſangen un-
zählige Vögel, Ammern, Rothkehlchen und Meiſen, aber
kein Lüftchen regte ſich. Drinnen im Zimmer war's wie
ausgeſtorben, ſogar die Sonnenſtrahlen ließen vom Klettern
und hingen nun, wie eine Kette güldener Dukaten, läſſig
vom Tiſch über Stühle und Fußbank.
Hanna dachte, daß ſie wohl mit Reden beginnen möchte:
Aber ſie öffnete nur die Lippen, und das un-
ausgeſprochene Wort flatterte zum Fenſter hinaus, wo es
die munteren Vöglein mit Jubelgeſchrei auffingen und wie
„Eirik! Eirik — Eirik!“
in allen Tonarten.
Die goldene Kette hatte ſich mittlerweile gelöſt, und die
Dukaten rollten luſtig über den Fußboden, von Ecke zu
Ecke. Einer tanzte ſogar bis auf das ſchwarze Schlepp-
kleid der bleichen Frau. Die hatte dem Spiele ſchweigend
zugeſehen.
„Eirik!“ ſchrie da plötzlich ein frecher Fink, der auf
das Fenſterbrett geflogen war, „Eirik — kiwitt, kiwitt!“
„Eirik,“ wiederholte die Frau und legte ihre ſchmale
Hand auf des Jünglings Schulter. Der fuhr hoch auf,
mächtig und ſchlank, mit thränenfeuchten Augen.
„Mutter, meine Mutter!“ rief er mit wunderbar klang-
voller Stimme und glitt an Hanna herunter, weinend und
ſchluchzend, ein troſtloſes Kind.
Belletriſtiſche Beilage zur Heidelberger Seitung.
Ar. 20.
Mittwoch, den 10. März
1886.
Eitik.
Novelle von Hertha von Polenz.
CGortſetzung.)
Das lang unterdrückte Heimweh regte ſich mächtig in
Hannas Bruſt. Sie dachte daran, nach Deutſchland zurück-
zukehren.
blieb ſie.
lich, ſchweſterlich zu lieben.
ein Bruder im Kreiſe der Schweſtern daheim gefehlt.
ward ihr Sohn und Vruder zugleich.
Und nun? — —
War er ihr nicht mehr — lieber geworden als Bruder
und Sohn — Eirik, Thord und Marucinas Sohn? —
— Und ſie — was war ſie ihm? —
Und hätte ſie in ihrem eignen Herzen die Antwort auf
dieſe Frage nicht gefunden, in Eiriks Blick, in ſeinem „Laß
mich, Mutter!“ vom Nachmittag war ſie ihr geworden, ſüß
und ſchrecklich zugleich! —
Draußen hatte der Regen nachgelaſſen, mild und ſchmerz-
lich lächelte der Mond durch zerriſſenes Gewölke. Drinnen
aber ſaß Hanna noch immer, und ſiedende Thränen floſſen
von den bleichen Wangen herab über die gerungenen Hände.
Und wieder zogen ſchwarze Streifen über die leuchtende
Scheibe und verhüllten ſie eine kleine Weile, dann aber ſiegte
das ſilberne Licht und ſtrahlte blaß doch klar bis zum an-
brechenden Tag.
Auch Hanna hatte über ihr Herz geſiegt, Liebe und
Seligkeit herausgeriſſen in alle Winde zerſtreut, daß fortan
nur die eiſigkalte marmorblaſſe Pflicht Platz darin finden
möchte. Als die letzten Mondesſtrahlen im dämmernden
Morgenſchein erſtarben, murmelte ſie mit bebenden Lippen:
„Ich bin ſeine Mutter. Ich muß ihm helfen!“
Und ſie hat ihm geholfen.
Freundlich ernſt iſt ſie ihm entgegengetreten, und wenn
er ſchwach werden wollte, da war ſie ſtark. Täglich ſprach
ſie ihm von Thord, ſeinem Vater, wie gut und groß und
ſtark er geweſen, ähnlich wie Eirik, doch nicht ganz ſo.
Wie er einmal geſagt, daß nur der ein rechter Mann ſei,
dem Selbſtachtung und Pflichtgefühl über des Herzens
liebſte Wünſche, ſelbſt über Weib und Kinder gingen, und
daß allein die Gottesfurcht noch höher ſtände als die bei-
den. Dabei ſah ſie ihn feſt an.
Es war ſo ſüß zu tröſten, zu lieben — mütter-
Kinder hatte ihr Gott verſagt,
Da mußte Eirik die Augen ſenken, denn in ſeinem
Herzen regte ſich ein Wunſch, ein glühendes Begehren, vor
dem jedwedes andere Gefühl: Pflichtgefühl, Selbſtachtung,
Gottesfurcht erſtarb.
Wieder gingen ſie eine Weile
der her.
Eirik ſah ſeine Mutter an. Feingegrabene Linien la-
gerten auf der klaren Stirn, den weißen Wangen. Es
waren die Thränenſpuren von neulich Nacht.
darauf, wie in ein unheimlich ſinnverwirrendes Räthſel und
wandte ſich ab, als ſie ihm den Gutenachtkuß bot.
In derfelben Nacht noch ſchrieb Hanna der älteſten
Schweſter, ob ſie ihren Stiefſohn, einen lieben ſchönen
ſchweigend nebeneinan-
Um Eirik, des armen verlaſſenen Knaben willen
Cirik
„Eirik!“
zum Spott wieder herein warfen:
Er ſtarrte
Knaben, groß und fremdartig wie Thord ſein Vater, liebe-
fähig und leicht erregbar wie ſeine ſüdländiſche Mutter,
für einige Zeit bei ſich aufnehmen und zu ſeiner Auf-
heiterung beitragen wolle.
„Er leidet an Schwermuth, was hier zu Lande nichts
Seltenes iſt. Er muß die Welt in ihrer Größe und Viel-
geſtaltigkeit kennen lernen und ſelber Großes ſchaffen. Das
wird ihm helfen. Behütet ihn gut und habt ihn lieb,“
ſchrieb ſie der Schweſter.
Frau Martha hatte darauf freundlich erwidert, er ſolle
willkommen ſein, ſo bald er käme und ſo lange er bliebe.
Dieſer Brief lag in Hannas Schooß, als ſie Eiriks
Schritten geſpannten Ohres den Flur entlang bis zur Treppe
folgte. Jetzt ſtieg er die Stufen hinan.
Hanna war aufgeſtanden. „Dann muß ich ſelber zu
ihm gehen,“ ſagte ſie ſeufzend. Langſam ſchlug ſie den
Weg ein, den er genommen. ö
Dicht vor Eiriks Thür fiel ihr Schlüſſelgebund raſſelnd
zur Erde; ſie ließ es liegen. Der eine Flügel war nur
angelehnt. Zögernd, beinahe ſchüchtern trat ſie ein.
Gleißend ſpielte das Abendlicht auf den zahlreichen
Flintenläufen, zackigem Hirſchgeweih und mächtigen Elens-
ſchaufeln rings an den Wänden. Voll und breit drängte
ſein goldiger Strom durch die weitgeöffneten Fenſter, und
manch vorwitziger Strahl kletterte an dem braunen Holz-
getäfel empor bis an die reich mit Schnitzwerk verzierte Decke.
Im äußerſten Winkel ſaß der Jüngling, den Kopf in
die Hände geſtützt, und blickte nicht auf. Um ſein Haupt,
um die reichen braunen Jugendlocken ſpielte kein Glanz
oder Schimmer. Dunkel war es, ganz dunkel, um — in
ihm. Er achtete nicht auf die bleiche Frau, die ſchweigend
zu ihm getreten war.
Vor den Fenſtern, in den hohen Föhren ſangen un-
zählige Vögel, Ammern, Rothkehlchen und Meiſen, aber
kein Lüftchen regte ſich. Drinnen im Zimmer war's wie
ausgeſtorben, ſogar die Sonnenſtrahlen ließen vom Klettern
und hingen nun, wie eine Kette güldener Dukaten, läſſig
vom Tiſch über Stühle und Fußbank.
Hanna dachte, daß ſie wohl mit Reden beginnen möchte:
Aber ſie öffnete nur die Lippen, und das un-
ausgeſprochene Wort flatterte zum Fenſter hinaus, wo es
die munteren Vöglein mit Jubelgeſchrei auffingen und wie
„Eirik! Eirik — Eirik!“
in allen Tonarten.
Die goldene Kette hatte ſich mittlerweile gelöſt, und die
Dukaten rollten luſtig über den Fußboden, von Ecke zu
Ecke. Einer tanzte ſogar bis auf das ſchwarze Schlepp-
kleid der bleichen Frau. Die hatte dem Spiele ſchweigend
zugeſehen.
„Eirik!“ ſchrie da plötzlich ein frecher Fink, der auf
das Fenſterbrett geflogen war, „Eirik — kiwitt, kiwitt!“
„Eirik,“ wiederholte die Frau und legte ihre ſchmale
Hand auf des Jünglings Schulter. Der fuhr hoch auf,
mächtig und ſchlank, mit thränenfeuchten Augen.
„Mutter, meine Mutter!“ rief er mit wunderbar klang-
voller Stimme und glitt an Hanna herunter, weinend und
ſchluchzend, ein troſtloſes Kind.