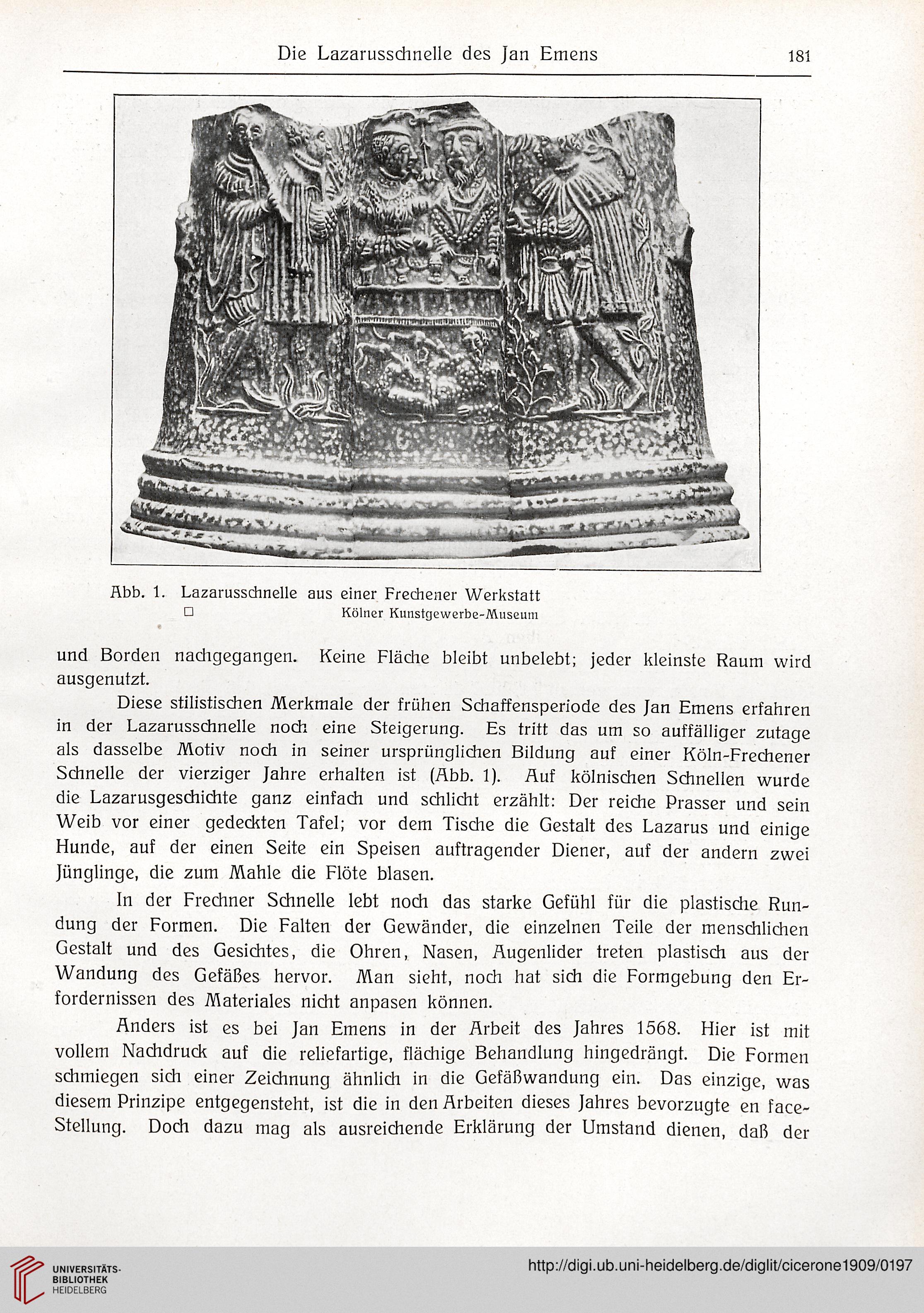Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0197
DOI Heft:
6. Heft
DOI Artikel:Lüthgen, Eugen: Die Lazarusschnelle des Jan Emens
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0197
Die Lazarusschnelle des Jan Emens
181
Äbb. 1. Lazarusschnelle aus einer Frediener Werkstatt
□ Kölner Kunstgewerbe-Museum
und Borden nadrgegangen. Keine Fläche bleibt unbelebt; jeder kleinste Raum wird
ausgenutzt.
Diese stilistischen Merkmale der frühen Schaffensperiode des Jan Emens erfahren
in der Lazarusschnelle noch eine Steigerung. Es tritt das um so auffälliger zutage
als dasselbe Motiv noch in seiner ursprünglichen Bildung auf einer Köln-Frechener
Schnelle der vierziger Jahre erhalten ist (Abb. 1). Auf kölnischen Schnellen wurde
die Lazarusgeschichte ganz einfach und schlicht erzählt; Der reiche Prasser und sein
Weib vor einer gedeckten Tafel; vor dem Tische die Gestalt des Lazarus und einige
Hunde, auf der einen Seite ein Speisen auftragender Diener, auf der andern zwei
Jünglinge, die zum Mahle die Flöte blasen.
In der Frechner Schnelle lebt noch das starke Gefühl für die plastische Run-
dung der Formen. Die Falten der Gewänder, die einzelnen Teile der menschlichen
Gestalt und des Gesichtes, die Ohren, Nasen, Augenlider treten plastisch aus der
Wandung des Gefäßes hervor. Man sieht, nodi hat sich die Formgebung den Er-
fordernissen des Materiales nicht anpasen können.
Anders ist es bei Jan Emens in der Arbeit des Jahres 1568. Hier ist mit
vollem Nachdruck auf die reliefartige, flächige Behandlung hingedrängt. Die Formen
schmiegen sich einer Zeichnung ähnlich in die Gefäßwandung ein. Das einzige, was
diesem Prinzipe entgegensteht, ist die in den Arbeiten dieses Jahres bevorzugte en face-
Stellung. Doch dazu mag als ausreichende Erklärung der Umstand dienen, daß der
181
Äbb. 1. Lazarusschnelle aus einer Frediener Werkstatt
□ Kölner Kunstgewerbe-Museum
und Borden nadrgegangen. Keine Fläche bleibt unbelebt; jeder kleinste Raum wird
ausgenutzt.
Diese stilistischen Merkmale der frühen Schaffensperiode des Jan Emens erfahren
in der Lazarusschnelle noch eine Steigerung. Es tritt das um so auffälliger zutage
als dasselbe Motiv noch in seiner ursprünglichen Bildung auf einer Köln-Frechener
Schnelle der vierziger Jahre erhalten ist (Abb. 1). Auf kölnischen Schnellen wurde
die Lazarusgeschichte ganz einfach und schlicht erzählt; Der reiche Prasser und sein
Weib vor einer gedeckten Tafel; vor dem Tische die Gestalt des Lazarus und einige
Hunde, auf der einen Seite ein Speisen auftragender Diener, auf der andern zwei
Jünglinge, die zum Mahle die Flöte blasen.
In der Frechner Schnelle lebt noch das starke Gefühl für die plastische Run-
dung der Formen. Die Falten der Gewänder, die einzelnen Teile der menschlichen
Gestalt und des Gesichtes, die Ohren, Nasen, Augenlider treten plastisch aus der
Wandung des Gefäßes hervor. Man sieht, nodi hat sich die Formgebung den Er-
fordernissen des Materiales nicht anpasen können.
Anders ist es bei Jan Emens in der Arbeit des Jahres 1568. Hier ist mit
vollem Nachdruck auf die reliefartige, flächige Behandlung hingedrängt. Die Formen
schmiegen sich einer Zeichnung ähnlich in die Gefäßwandung ein. Das einzige, was
diesem Prinzipe entgegensteht, ist die in den Arbeiten dieses Jahres bevorzugte en face-
Stellung. Doch dazu mag als ausreichende Erklärung der Umstand dienen, daß der