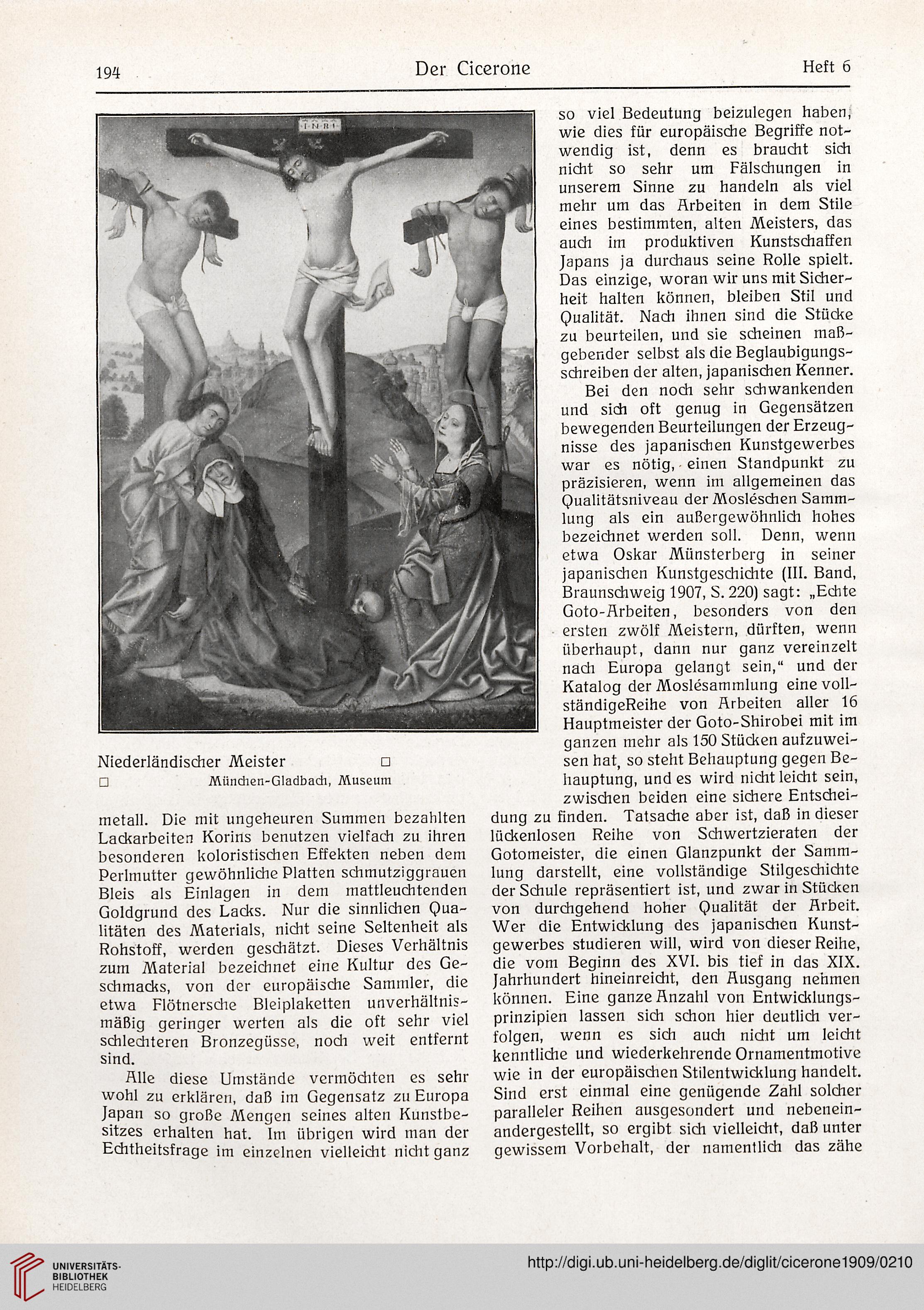Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0210
DOI Heft:
6. Heft
DOI Artikel:Sammlungen
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0210
194
Der Cicerone
Heft 6
Niederländischer Meister □
□ Mündien-Gladbach, Museum
metall. Die mit ungeheuren Summen bezahlten
Lackarbeiten Korins benutzen vielfach zu ihren
besonderen koloristischen Effekten neben dem
Perlmutter gewöhnliche Platten schmutziggrauen
Bleis als Einlagen in dem mattleuchtenden
Goldgrund des Lacks. Nur die sinnlichen Qua-
litäten des Materials, nicht seine Seltenheit als
Rohstoff, werden geschätzt. Dieses Verhältnis
zum Material bezeichnet eine Kultur des Ge-
schmacks, von der europäische Sammler, die
etwa Flötnersche Bleiplaketten unverhältnis-
mäßig geringer werten als die oft sehr viel
schlechteren Bronzegüsse, nodi weit entfernt
sind.
Älle diese Umstände vermöchten es sehr
wohl zu erklären, daß im Gegensatz zu Europa
Japan so große Mengen seines alten Kunstbe-
sitzes erhalten hat. Im übrigen wird man der
Echtheitsfrage im einzelnen vielleicht nicht ganz
so viel Bedeutung beizulegen haben,
wie dies für europäische Begriffe not-
wendig ist, denn es braucht sich
nicht so sehr um Fälschungen in
unserem Sinne zu handeln als viel
mehr um das Ärbeiten in dem Stile
eines bestimmten, alten Meisters, das
auch im produktiven Kunstschaffen
Japans ja durchaus seine Rolle spielt.
Das einzige, woran wir uns mit Sicher-
heit halten können, bleiben Stil und
Qualität. Nach ihnen sind die Stücke
zu beurteilen, und sie scheinen maß-
gebender selbst als die Beglaubigungs-
schreiben der alten, japanischen Kenner.
Bei den noch sehr schwankenden
und sich oft genug in Gegensätzen
bewegenden Beurteilungen der Erzeug-
nisse des japanischen Kunstgewerbes
war es nötig, einen Standpunkt zu
präzisieren, wenn im allgemeinen das
Qualitätsniveau der Mosleschen Samm-
lung als ein außergewöhnlich hohes
bezeichnet werden soll. Denn, wenn
etwa Oskar Münsterberg in seiner
japanischen Kunstgeschichte (III. Band,
Braunschweig 1907, S. 220) sagt: „Echte
Goto-Ärbeiten, besonders von den
ersten zwölf Meistern, dürften, wenn
überhaupt, dann nur ganz vereinzelt
nach Europa gelangt sein,“ und der
Katalog der Moslesammlung eine voll-
ständigeReihe von Ärbeiten aller 16
Hauptmeister der Goto-Shirobei mit im
ganzen mehr als 150 Stücken aufzuwei-
sen hat, so steht Behauptung gegen Be-
hauptung, und es wird nicht leicht sein,
zwischen beiden eine sichere Entschei-
dung zu finden. Tatsache aber ist, daß in dieser
lückenlosen Reihe von Schwertzieraten der
Gotomeister, die einen Glanzpunkt der Samm-
lung darstellt, eine vollständige Stilgeschichte
der Schule repräsentiert ist, und zwar in Stücken
von durchgehend hoher Qualität der Ärbeit.
Wer die Entwicklung des japanischen Kunst-
gewerbes studieren will, wird von dieser Reihe,
die vom Beginn des XVI. bis tief in das XIX.
Jahrhundert hineinreicht, den Äusgang nehmen
können. Eine ganze Änzahl von Entwicklungs-
prinzipien lassen sich schon hier deutlich ver-
folgen, wenn es sich auch nicht um leicht
kenntliche und wiederkehrende Ornamentmotive
wie in der europäischen Stilentwicklung handelt.
Sind erst einmal eine genügende Zahl solcher
paralleler Reihen ausgesondert und nebenein-
andergestellt, so ergibt sich vielleicht, daß unter
gewissem Vorbehalt, der namentlich das zähe
Der Cicerone
Heft 6
Niederländischer Meister □
□ Mündien-Gladbach, Museum
metall. Die mit ungeheuren Summen bezahlten
Lackarbeiten Korins benutzen vielfach zu ihren
besonderen koloristischen Effekten neben dem
Perlmutter gewöhnliche Platten schmutziggrauen
Bleis als Einlagen in dem mattleuchtenden
Goldgrund des Lacks. Nur die sinnlichen Qua-
litäten des Materials, nicht seine Seltenheit als
Rohstoff, werden geschätzt. Dieses Verhältnis
zum Material bezeichnet eine Kultur des Ge-
schmacks, von der europäische Sammler, die
etwa Flötnersche Bleiplaketten unverhältnis-
mäßig geringer werten als die oft sehr viel
schlechteren Bronzegüsse, nodi weit entfernt
sind.
Älle diese Umstände vermöchten es sehr
wohl zu erklären, daß im Gegensatz zu Europa
Japan so große Mengen seines alten Kunstbe-
sitzes erhalten hat. Im übrigen wird man der
Echtheitsfrage im einzelnen vielleicht nicht ganz
so viel Bedeutung beizulegen haben,
wie dies für europäische Begriffe not-
wendig ist, denn es braucht sich
nicht so sehr um Fälschungen in
unserem Sinne zu handeln als viel
mehr um das Ärbeiten in dem Stile
eines bestimmten, alten Meisters, das
auch im produktiven Kunstschaffen
Japans ja durchaus seine Rolle spielt.
Das einzige, woran wir uns mit Sicher-
heit halten können, bleiben Stil und
Qualität. Nach ihnen sind die Stücke
zu beurteilen, und sie scheinen maß-
gebender selbst als die Beglaubigungs-
schreiben der alten, japanischen Kenner.
Bei den noch sehr schwankenden
und sich oft genug in Gegensätzen
bewegenden Beurteilungen der Erzeug-
nisse des japanischen Kunstgewerbes
war es nötig, einen Standpunkt zu
präzisieren, wenn im allgemeinen das
Qualitätsniveau der Mosleschen Samm-
lung als ein außergewöhnlich hohes
bezeichnet werden soll. Denn, wenn
etwa Oskar Münsterberg in seiner
japanischen Kunstgeschichte (III. Band,
Braunschweig 1907, S. 220) sagt: „Echte
Goto-Ärbeiten, besonders von den
ersten zwölf Meistern, dürften, wenn
überhaupt, dann nur ganz vereinzelt
nach Europa gelangt sein,“ und der
Katalog der Moslesammlung eine voll-
ständigeReihe von Ärbeiten aller 16
Hauptmeister der Goto-Shirobei mit im
ganzen mehr als 150 Stücken aufzuwei-
sen hat, so steht Behauptung gegen Be-
hauptung, und es wird nicht leicht sein,
zwischen beiden eine sichere Entschei-
dung zu finden. Tatsache aber ist, daß in dieser
lückenlosen Reihe von Schwertzieraten der
Gotomeister, die einen Glanzpunkt der Samm-
lung darstellt, eine vollständige Stilgeschichte
der Schule repräsentiert ist, und zwar in Stücken
von durchgehend hoher Qualität der Ärbeit.
Wer die Entwicklung des japanischen Kunst-
gewerbes studieren will, wird von dieser Reihe,
die vom Beginn des XVI. bis tief in das XIX.
Jahrhundert hineinreicht, den Äusgang nehmen
können. Eine ganze Änzahl von Entwicklungs-
prinzipien lassen sich schon hier deutlich ver-
folgen, wenn es sich auch nicht um leicht
kenntliche und wiederkehrende Ornamentmotive
wie in der europäischen Stilentwicklung handelt.
Sind erst einmal eine genügende Zahl solcher
paralleler Reihen ausgesondert und nebenein-
andergestellt, so ergibt sich vielleicht, daß unter
gewissem Vorbehalt, der namentlich das zähe