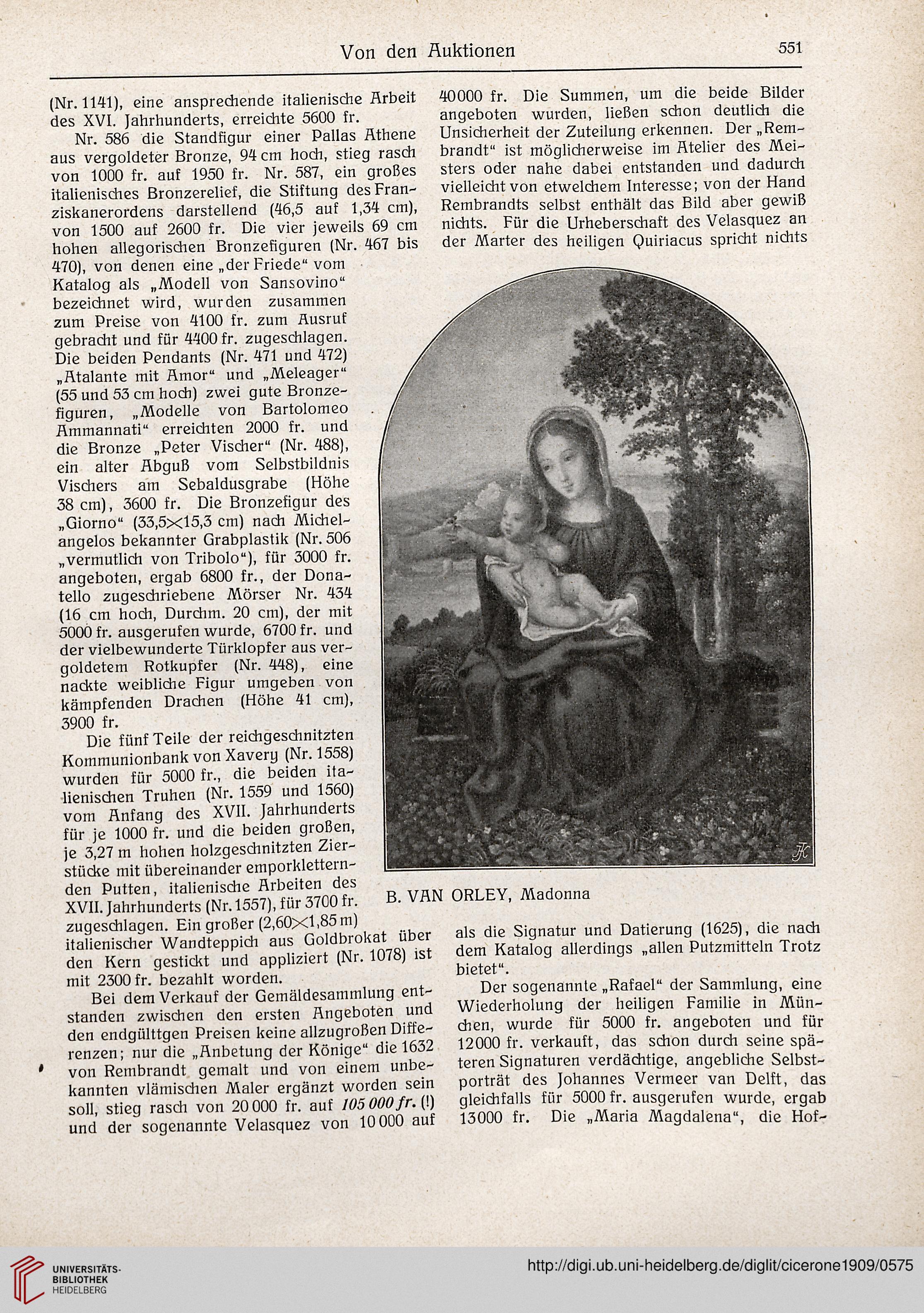Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 1.1909
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0575
DOI Heft:
17. Heft
DOI Artikel:Von den Auktionen
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24117#0575
Von den Äuktionen
551
(Nr. 1141), eine ansprechende italienische Arbeit
des XVI. Jahrhunderts, erreichte 5600 fr.
Nr. 586 die Standfigur einer Pallas Äthene
aus vergoldeter Bronze, 94 cm hoch, stieg rasch
von 1000 fr. auf 1950 fr. Nr. 587, ein großes
italienisches Bronzerelief, die Stiftung des Fran-
ziskanerordens darstellend (46,5 auf 1,34 cm),
von 1500 auf 2600 fr. Die vier jeweils 69 cm
hohen allegorischen Bronzefiguren (Nr. 467 bis
470), von denen eine „der Friede“ vom
Katalog als „Modell von Sansovino“
bezeichnet wird, wurden zusammen
zum Preise von 4100 fr. zum Ausruf
gebracht und für 4400 fr. zugeschlagen.
Die beiden Pendants (Nr. 471 und 472)
„Ätalante mit Amor“ und „Meleager“
(55 und 53 cm hoch) zwei gute Bronze-
figuren, „Modelle von Bartolomeo
Ammannati“ erreichten 2000 fr. und
die Bronze „Peter Vischer“ (Nr. 488),
ein alter Abguß vom Selbstbildnis
Vischers am Sebaidusgrabe (Höhe
38 cm), 3600 fr. Die Bronzefigur des
„Giorno“ (33,5x15,3 cm) nach Michel-
angelos bekannter Grabplastik (Nr. 506
„vermutlich von Tribolo“), für 3000 fr.
angeboten, ergab 6800 fr., der Dona-
tello zugeschriebene Mörser Nr. 434
(16 cm hoch, Durchm. 20 cm), der mit
5000 fr. ausgerufen wurde, 6700 fr. und
der vielbewunderte Türklopfer aus ver-
goldetem Rotkupfer (Nr. 448), eine
nackte weibliche Figur umgeben von
kämpfenden Drachen (Höhe 41 cm),
3900 fr.
Die fünf Teile der reichgeschnitzten
Kommunionbank von Xavery (Nr. 1558)
wurden für 5000 fr., die beiden ita-
lienischen Truhen (Nr. 1559 und 1560)
vom Anfang des XVII. Jahrhunderts
für je 1000 fr. und die beiden großen,
je 3,27 m hohen holzgeschnitzten Zier-
stücke mit übereinander emporklettern-
den Putten, italienische Arbeiten des
XVII. Jahrhunderts (Nr. 1557), für 3700 fr.
zugeschlagen. Ein großer (2,60x1,85 m)
italienischer Wandteppich aus Goldbrokat über
den Kern gestickt und appliziert (Nr. 1078) ist
mit 2300 fr. bezahlt worden.
Bei dem Verkauf der Gemäldesammlung ent-
standen zwischen den ersten Angeboten und
den endgülttgen Preisen keine allzugroßen Diffe-
renzen; nur die „Anbetung der Könige“ die 1632
von Rembrandt gemalt und von einem unbe-
kannten vlämischen Maler ergänzt worden sein
soll, stieg rasch von 20000 fr. auf 105 000fr. (!)
und der sogenannte Velasquez von 10000 auf
40000 fr. Die Summen, um die beide Bilder
angeboten wurden, ließen schon deutlich die
Unsicherheit der Zuteilung erkennen. Der „Rem-
brandt“ ist möglicherweise im Atelier des Mei-
sters oder nahe dabei entstanden und dadurch
vielleicht von etwelchem Interesse; von der Hand
Rembrandts selbst enthält das Bild aber gewiß
nichts. Für die Urheberschaft des Velasquez an
der Marter des heiligen Quiriacus spricht nichts
als die Signatur und Datierung (1625), die nach
dem Katalog allerdings „allen Putzmitteln Trotz
bietet“.
Der sogenannte „Rafael“ der Sammlung, eine
Wiederholung der heiligen Familie in Mün-
chen, wurde für 5000 fr. angeboten und für
12000 fr. verkauft, das schon durch seine spä-
teren Signaturen verdächtige, angebliche Selbst-
porträt des Johannes Vermeer van Delft, das
gleichfalls für 5000 fr. ausgerufen wurde, ergab
13000 fr. Die „Maria Magdalena“, die Hof-
B. VAN ORLEY, Madonna
551
(Nr. 1141), eine ansprechende italienische Arbeit
des XVI. Jahrhunderts, erreichte 5600 fr.
Nr. 586 die Standfigur einer Pallas Äthene
aus vergoldeter Bronze, 94 cm hoch, stieg rasch
von 1000 fr. auf 1950 fr. Nr. 587, ein großes
italienisches Bronzerelief, die Stiftung des Fran-
ziskanerordens darstellend (46,5 auf 1,34 cm),
von 1500 auf 2600 fr. Die vier jeweils 69 cm
hohen allegorischen Bronzefiguren (Nr. 467 bis
470), von denen eine „der Friede“ vom
Katalog als „Modell von Sansovino“
bezeichnet wird, wurden zusammen
zum Preise von 4100 fr. zum Ausruf
gebracht und für 4400 fr. zugeschlagen.
Die beiden Pendants (Nr. 471 und 472)
„Ätalante mit Amor“ und „Meleager“
(55 und 53 cm hoch) zwei gute Bronze-
figuren, „Modelle von Bartolomeo
Ammannati“ erreichten 2000 fr. und
die Bronze „Peter Vischer“ (Nr. 488),
ein alter Abguß vom Selbstbildnis
Vischers am Sebaidusgrabe (Höhe
38 cm), 3600 fr. Die Bronzefigur des
„Giorno“ (33,5x15,3 cm) nach Michel-
angelos bekannter Grabplastik (Nr. 506
„vermutlich von Tribolo“), für 3000 fr.
angeboten, ergab 6800 fr., der Dona-
tello zugeschriebene Mörser Nr. 434
(16 cm hoch, Durchm. 20 cm), der mit
5000 fr. ausgerufen wurde, 6700 fr. und
der vielbewunderte Türklopfer aus ver-
goldetem Rotkupfer (Nr. 448), eine
nackte weibliche Figur umgeben von
kämpfenden Drachen (Höhe 41 cm),
3900 fr.
Die fünf Teile der reichgeschnitzten
Kommunionbank von Xavery (Nr. 1558)
wurden für 5000 fr., die beiden ita-
lienischen Truhen (Nr. 1559 und 1560)
vom Anfang des XVII. Jahrhunderts
für je 1000 fr. und die beiden großen,
je 3,27 m hohen holzgeschnitzten Zier-
stücke mit übereinander emporklettern-
den Putten, italienische Arbeiten des
XVII. Jahrhunderts (Nr. 1557), für 3700 fr.
zugeschlagen. Ein großer (2,60x1,85 m)
italienischer Wandteppich aus Goldbrokat über
den Kern gestickt und appliziert (Nr. 1078) ist
mit 2300 fr. bezahlt worden.
Bei dem Verkauf der Gemäldesammlung ent-
standen zwischen den ersten Angeboten und
den endgülttgen Preisen keine allzugroßen Diffe-
renzen; nur die „Anbetung der Könige“ die 1632
von Rembrandt gemalt und von einem unbe-
kannten vlämischen Maler ergänzt worden sein
soll, stieg rasch von 20000 fr. auf 105 000fr. (!)
und der sogenannte Velasquez von 10000 auf
40000 fr. Die Summen, um die beide Bilder
angeboten wurden, ließen schon deutlich die
Unsicherheit der Zuteilung erkennen. Der „Rem-
brandt“ ist möglicherweise im Atelier des Mei-
sters oder nahe dabei entstanden und dadurch
vielleicht von etwelchem Interesse; von der Hand
Rembrandts selbst enthält das Bild aber gewiß
nichts. Für die Urheberschaft des Velasquez an
der Marter des heiligen Quiriacus spricht nichts
als die Signatur und Datierung (1625), die nach
dem Katalog allerdings „allen Putzmitteln Trotz
bietet“.
Der sogenannte „Rafael“ der Sammlung, eine
Wiederholung der heiligen Familie in Mün-
chen, wurde für 5000 fr. angeboten und für
12000 fr. verkauft, das schon durch seine spä-
teren Signaturen verdächtige, angebliche Selbst-
porträt des Johannes Vermeer van Delft, das
gleichfalls für 5000 fr. ausgerufen wurde, ergab
13000 fr. Die „Maria Magdalena“, die Hof-
B. VAN ORLEY, Madonna