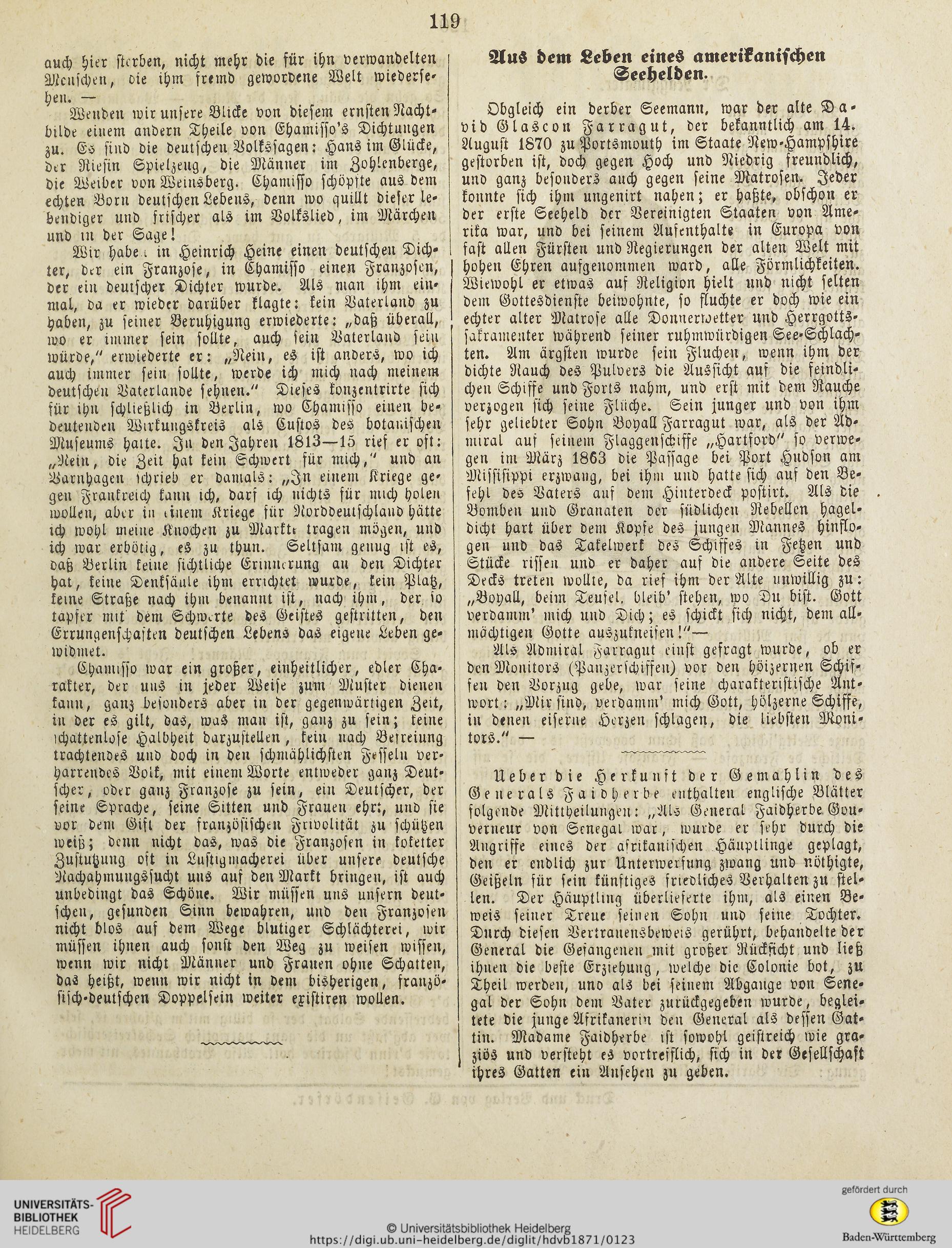119
auch hier ſterben, nicht mehr die für ihn verwandelten
Menſchen, die ihm fremd gewordene Welt wiederſe-
En. — ö —
Wenden wir unſere Blicke von dieſem ernſten Nacht-
bilde einem andern Theile von Ehamiſſo's Dichtungen
zu. Es ſind die deutſchen Volksſagen: Hans im Glücke,
der Rieſin Spielzeug, die Männer im Zohlenberge,
die Weiber von Weinsberg. Chamiſſo ſchöpfte aus dem
echten Born deutſchen Lebens, denn wo quillt dieſer le-
bendiger und friſcher als im Volkslied, im Märchen
und in der Sage! *
Wir habe in Heinrich Heine einen deutſchen Dich-
ter, der ein Franzoſe, in Chamiſſo einen Franzoſen,
der ein deuiſcher Dichter wurde. Als man ihm ein-
mal, da er wieder darüher klagte: kein Vaterland zu
haben, zu ſeiner Beruhigung erwiederte: „daß überall,
wo er immer ſein ſollte, auch ſein Vaterland ſein
würde,“ erwiederte er: „Nein, es iſt anders, wo ich
auch immer ſein ſollte, werde ich mich nach meinem
deutſchen Vaterlande ſehnen.“
deutenden Wirkungskreis als Cuſtos des botaniſchen
Muſeums hatte. In den Jahren 1813—15 rief er oft:
„Nein, die Zeit hat kein Schwert für mich,“ und an
Varnhagen ſchrieb er damals: „In einem Kriege ge-
gen Frankreich kann ich, darf ich nichts für mich holen
wollen, aber in einem Kriege für Norddeutſchland hätte
ich wohl meine Knochen zu Markte tragen mögen, und
ich war erbötig, es zu thun. Seltſam genug iſt es,
daß Berlin keine ſichtliche Erinnerung au den Dichter
hat, keine Denkſäule ihm errichtet wurde, kein Platz,
keine Straße nach ihm benannt iſt, nach ihm, der ſo
tapfer mit dem Schwerte des Geiſtes geſtritten, den
Errungenſchaften deutſchen Lebens das eigene Leben ge-
widmet. — — ö *
Chamiſſo war ein großer, einheitlicher, edler Cha-
rakter, der uns in jeder Weiſe zum Muſter dienen
kann, ganz beſonders aber in der gegenwärtigen Zeit,
in der es gilt, das, was man iſt, ganz zu ſein; keine
ſchattenloſe Halbheit darzuſtellen, kein nach Befreiung.
trachtendes und doch in den ſchmählichſten Feſſeln ver⸗—
harrendes Volk, mit einem Worte entweder ganz Deut-
ſcher, oder ganz Franzoſe zu ſein, ein Deutſcher, der
ſeine Sprache, ſeine Sitten und Frauen ehrt, und ſie
vor dem Gift der franzöſiſchen Friwolität zu ſchützen
weiß; denn nicht das, was die Franzoſen in koketter
Zuſtutzung oft in Luſtig macherei über unſere deutſche
Nachahmungsſucht uns auf den Markt bringen, iſt auch
unbedingt das Schöne. Wir müſſen uns unſern deut-
ſchen, geſunden Sinn bewahren, und den Franzoſen-
nicht blos auf dem Wege blutiger Schlächterei, wir
müſſen ihnen auch ſonſt den Weg zu weiſen wiſſen,
wenn wir nicht Männer und Frauen ohne Schatten,
das heißt, wenn wir nicht in dem bisherigen, franzö-
ſiſch deutſchen Doppelſein weiter exiſtiren wollen.
Dieſes konzentrirte ſich
für ihn ſchließlich in Berlin, wo Chamiſſo einen be-
len.
Aus dem Leben eines amerikaniſchen
Seehelden.
Obgleich ein derber Seemann, war der alte Da-
vid Glascon Farragut, der bekanntlich am 14.
Auguſt 1870 zu Portsmouth im Staate New⸗Hampſhire
geſtorben iſt, doch gegen Hoch und Niedrig freundlich,
und ganz beſonders auch gegen ſeine Matroſen. Jeder
konnte ſich ihm ungenirt nahen; er haßte, obſchon er
der erſte Seeheld der Vereinigten Staaten von Ame-
rika war, und bei ſeinem Aufenthalte in Europa von
faſt allen Fürſten und Regierungen der alten Welt mit
hohen Ehren aufgenommen ward, alle Förmlichkeiten.
Wiewohl er etwas auf Religion hielt und nicht ſelten
dem Gottesdienſte beiwohnte, ſo fluchte er doch wie ein-
echter alter Matroſe alle Donnerwetter und Herrgotts-
ſakramenter während ſeiner ruhmwürdigen See⸗Schlach-
ten. Am ärgſten wurde ſein Fluchen, wenn ihm der-
dichte Rauch des Pulvers die Ausſicht auf die feindli-
chen Schiffe und Forts nahm, und erſt mit dem Rauche
verzogen ſich ſeine Flüche. Sein junger und von ihm
ſehr geliebter Sohn Boyall Farragut war, als der Ad-
miral auf ſeinem Flaggenſchiffe „Hartford“ ſo verwe-
gen im März 1863 die Paſſage bei Port Hudſon am
Miſſiſippi erzwang, bei ihm und hatte ſich auf den Be-
fehl des Vaters auf dem Hinterdeck poſtirt. Als die
Bomben und Granaten der ſüdlichen Rebellen hagel-
dicht hart über dem Kopfe des jungen Mannes hinflo-
gen und das Takelwerk des Schiffes in Fetzen und-
Stücke riſſen und er daher auf die andere Seite des
Decks treten wollie, da rief ihm der Alte unwillig zu:
„Boyall, beim Teufel. bleib' ſtehen, wo Du biſt. Gott
verdamm' mich und Dich; es ſchickt ſich nicht, dem all-
mächtigen Gotte auszukneifen!“ — —
Als Admiral Farragut einſt gefragt wurde, ob er
den Monitors (Panzerſchiffen) vor den höizernen Schif-
fen den Vorzug gebe, war ſeine charakteriſtiſche Ant-
wort „Mir ſind, verdamm' mich Gott, hölzerne Schiffe,
in denen eiſerne Herzen ſchlagen, die liebſten Moni-
tors.“ — ö * ö ö
Ueber die Herkunjt der Gemahlin des
Generals Faidherbe enthalten engliſche Blätter
folgende Mittheilungen: „Als General Faidherbe Gou-
verneur von Senegal war, wurde er ſehr durch die
Angriffe eines der afrikaniſchen Häuptlinge geplagt,
den er endlich zur Unterwerfung zwang und nöthigte,
Geißeln für ſein künftiges friedliches Verhalten zu ſtel-
Der Häuptling überlieferte ihm, als einen Be-
weis ſeiner Treue ſeinen Sohn und ſeine Tochter.
Durch dieſen Vertrauensbeweis gerührt, behandelte der
General die Gefangenen mit großer Rückficht und ließ
ihuen die beſte Erziehung, welche die Colonie bot, zu
Theil werden, und als bei ſeinem Abgauge von Sene-
gal der Sohn dem Vater zurückgegeben wurde, beglei-
tete die junge Afrikanerin den General als deſſen Gat-
tin. Madame Faidherbe iſt ſowohl geiſtreich wie gra-
ziös und verſteht es vortrefflich, ſich in der Geſellſchaft
ihres Gatten ein Anſehen zu geben.
auch hier ſterben, nicht mehr die für ihn verwandelten
Menſchen, die ihm fremd gewordene Welt wiederſe-
En. — ö —
Wenden wir unſere Blicke von dieſem ernſten Nacht-
bilde einem andern Theile von Ehamiſſo's Dichtungen
zu. Es ſind die deutſchen Volksſagen: Hans im Glücke,
der Rieſin Spielzeug, die Männer im Zohlenberge,
die Weiber von Weinsberg. Chamiſſo ſchöpfte aus dem
echten Born deutſchen Lebens, denn wo quillt dieſer le-
bendiger und friſcher als im Volkslied, im Märchen
und in der Sage! *
Wir habe in Heinrich Heine einen deutſchen Dich-
ter, der ein Franzoſe, in Chamiſſo einen Franzoſen,
der ein deuiſcher Dichter wurde. Als man ihm ein-
mal, da er wieder darüher klagte: kein Vaterland zu
haben, zu ſeiner Beruhigung erwiederte: „daß überall,
wo er immer ſein ſollte, auch ſein Vaterland ſein
würde,“ erwiederte er: „Nein, es iſt anders, wo ich
auch immer ſein ſollte, werde ich mich nach meinem
deutſchen Vaterlande ſehnen.“
deutenden Wirkungskreis als Cuſtos des botaniſchen
Muſeums hatte. In den Jahren 1813—15 rief er oft:
„Nein, die Zeit hat kein Schwert für mich,“ und an
Varnhagen ſchrieb er damals: „In einem Kriege ge-
gen Frankreich kann ich, darf ich nichts für mich holen
wollen, aber in einem Kriege für Norddeutſchland hätte
ich wohl meine Knochen zu Markte tragen mögen, und
ich war erbötig, es zu thun. Seltſam genug iſt es,
daß Berlin keine ſichtliche Erinnerung au den Dichter
hat, keine Denkſäule ihm errichtet wurde, kein Platz,
keine Straße nach ihm benannt iſt, nach ihm, der ſo
tapfer mit dem Schwerte des Geiſtes geſtritten, den
Errungenſchaften deutſchen Lebens das eigene Leben ge-
widmet. — — ö *
Chamiſſo war ein großer, einheitlicher, edler Cha-
rakter, der uns in jeder Weiſe zum Muſter dienen
kann, ganz beſonders aber in der gegenwärtigen Zeit,
in der es gilt, das, was man iſt, ganz zu ſein; keine
ſchattenloſe Halbheit darzuſtellen, kein nach Befreiung.
trachtendes und doch in den ſchmählichſten Feſſeln ver⸗—
harrendes Volk, mit einem Worte entweder ganz Deut-
ſcher, oder ganz Franzoſe zu ſein, ein Deutſcher, der
ſeine Sprache, ſeine Sitten und Frauen ehrt, und ſie
vor dem Gift der franzöſiſchen Friwolität zu ſchützen
weiß; denn nicht das, was die Franzoſen in koketter
Zuſtutzung oft in Luſtig macherei über unſere deutſche
Nachahmungsſucht uns auf den Markt bringen, iſt auch
unbedingt das Schöne. Wir müſſen uns unſern deut-
ſchen, geſunden Sinn bewahren, und den Franzoſen-
nicht blos auf dem Wege blutiger Schlächterei, wir
müſſen ihnen auch ſonſt den Weg zu weiſen wiſſen,
wenn wir nicht Männer und Frauen ohne Schatten,
das heißt, wenn wir nicht in dem bisherigen, franzö-
ſiſch deutſchen Doppelſein weiter exiſtiren wollen.
Dieſes konzentrirte ſich
für ihn ſchließlich in Berlin, wo Chamiſſo einen be-
len.
Aus dem Leben eines amerikaniſchen
Seehelden.
Obgleich ein derber Seemann, war der alte Da-
vid Glascon Farragut, der bekanntlich am 14.
Auguſt 1870 zu Portsmouth im Staate New⸗Hampſhire
geſtorben iſt, doch gegen Hoch und Niedrig freundlich,
und ganz beſonders auch gegen ſeine Matroſen. Jeder
konnte ſich ihm ungenirt nahen; er haßte, obſchon er
der erſte Seeheld der Vereinigten Staaten von Ame-
rika war, und bei ſeinem Aufenthalte in Europa von
faſt allen Fürſten und Regierungen der alten Welt mit
hohen Ehren aufgenommen ward, alle Förmlichkeiten.
Wiewohl er etwas auf Religion hielt und nicht ſelten
dem Gottesdienſte beiwohnte, ſo fluchte er doch wie ein-
echter alter Matroſe alle Donnerwetter und Herrgotts-
ſakramenter während ſeiner ruhmwürdigen See⸗Schlach-
ten. Am ärgſten wurde ſein Fluchen, wenn ihm der-
dichte Rauch des Pulvers die Ausſicht auf die feindli-
chen Schiffe und Forts nahm, und erſt mit dem Rauche
verzogen ſich ſeine Flüche. Sein junger und von ihm
ſehr geliebter Sohn Boyall Farragut war, als der Ad-
miral auf ſeinem Flaggenſchiffe „Hartford“ ſo verwe-
gen im März 1863 die Paſſage bei Port Hudſon am
Miſſiſippi erzwang, bei ihm und hatte ſich auf den Be-
fehl des Vaters auf dem Hinterdeck poſtirt. Als die
Bomben und Granaten der ſüdlichen Rebellen hagel-
dicht hart über dem Kopfe des jungen Mannes hinflo-
gen und das Takelwerk des Schiffes in Fetzen und-
Stücke riſſen und er daher auf die andere Seite des
Decks treten wollie, da rief ihm der Alte unwillig zu:
„Boyall, beim Teufel. bleib' ſtehen, wo Du biſt. Gott
verdamm' mich und Dich; es ſchickt ſich nicht, dem all-
mächtigen Gotte auszukneifen!“ — —
Als Admiral Farragut einſt gefragt wurde, ob er
den Monitors (Panzerſchiffen) vor den höizernen Schif-
fen den Vorzug gebe, war ſeine charakteriſtiſche Ant-
wort „Mir ſind, verdamm' mich Gott, hölzerne Schiffe,
in denen eiſerne Herzen ſchlagen, die liebſten Moni-
tors.“ — ö * ö ö
Ueber die Herkunjt der Gemahlin des
Generals Faidherbe enthalten engliſche Blätter
folgende Mittheilungen: „Als General Faidherbe Gou-
verneur von Senegal war, wurde er ſehr durch die
Angriffe eines der afrikaniſchen Häuptlinge geplagt,
den er endlich zur Unterwerfung zwang und nöthigte,
Geißeln für ſein künftiges friedliches Verhalten zu ſtel-
Der Häuptling überlieferte ihm, als einen Be-
weis ſeiner Treue ſeinen Sohn und ſeine Tochter.
Durch dieſen Vertrauensbeweis gerührt, behandelte der
General die Gefangenen mit großer Rückficht und ließ
ihuen die beſte Erziehung, welche die Colonie bot, zu
Theil werden, und als bei ſeinem Abgauge von Sene-
gal der Sohn dem Vater zurückgegeben wurde, beglei-
tete die junge Afrikanerin den General als deſſen Gat-
tin. Madame Faidherbe iſt ſowohl geiſtreich wie gra-
ziös und verſteht es vortrefflich, ſich in der Geſellſchaft
ihres Gatten ein Anſehen zu geben.