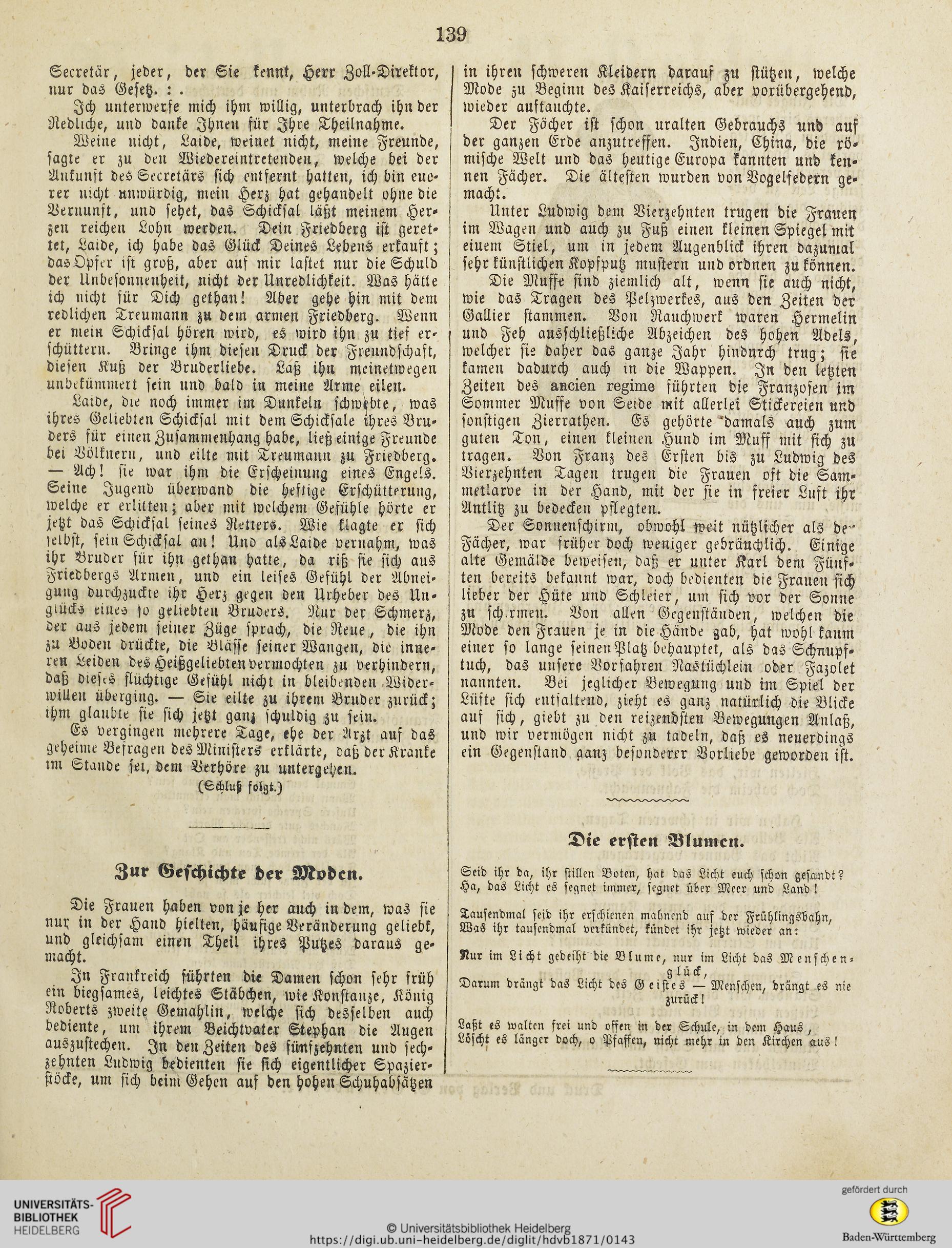139
Secretär, jeder, der Sie kennt, Herr Zoll⸗Direktor,
nur das Geſetz
Ich unterwerfe mich ihm willig, unterbrach ihn der
Redliche, und danke Ihnen für Ihre Theilnahme.
Weine nicht, Laide, weinet nicht, meine Freunde,
ſagte er zu den Wiedereintretenden, welche bei der
Ankunft des Secretärs ſich entfernt hatten, ich bin eue-
rer nicht unwürdig, mein Herz hat gehandelt ohne die
Vernunft, und ſehet, das Schickſal läßt meinem Her-
zen reichen Lohn werden. Dein Friedberg iſt geret-
tet, Laide, ich habe das Glück Deines Lebens erkauft;
das Opfer iſt groß, aber auf mir laſtet nur die Schuld
der Unbeſonnenheit, nicht der Unredlichkeit. Was hätte
ich nicht für Dich gethan! Aber gehe hin mit dem
redlichen Treumann zu dem armen Friedberg. Wenn
er mein Schickſal hören wird, es wird ihn zu tief er-
ſchüttern. Bringe ihm dieſen Druck der Freundſchaft,
dieſen Kuß der Bruderliebe. Laß ihn meinetwegen
undekümmert ſein und bald in meine Arme eilen.
Laide, die noch immer im Dunkeln ſchwebte, was
ihres Geliebten Schickſal mit dem Schickſale ihres Bru-—
ders für einen Zuſammenhang habe, ließ einige Freunde
bei Völknern, und eilte mit Treumann zu Friedberg.
— Ach! ſie war ihm die Erſcheinung eines Engels.
Seine Jugend überwand die heftige Erſchütterung,
welche er erlitten; aber mit welchem Gefühle hörte er
jetzt das Schickſal ſeines Retters. Wie klagte er ſich
ſelbſt, ſein Schickſal an! Und als Laide vernahm, was
ihr Bruder für ihn gethan hatte, da riß ſie ſich aus
Friedbergs Armen, und ein leiſes Gefühl der Abnei-
gung durchzuckte ihr Herz gegen den Urheber des Un-
glücks eines ſo geliebten Bruders. Nur der Schmerz,
der aus jedem ſeiner Züge ſprach, die Reue, die ihn
zu Boden drücktr, die Bläſſe ſeiner Wangen, die inne-
ren Leiden des Heißgeliebten vermochten zu verhindern,
daß dieſes flüchtige Gefühl nicht in bleibenden Wider-
willen überging. — Sir eilte zu ihrem Bruder zurück;
ihm glaubte ſie ſich jetzt ganz ſchuldig zu ſein. ö
Es vergingen mehrere Tage, ehe der Arzt auf das
geheime Befragen des Miniſters erklärte, daß der Kranke
im Stande ſei, dem Verhöre zu untergehen.
ö (Schluß folgt.)
Zur Geſchichte der Moden.
Die Frauen haben von je her auch in dem, was ſie
nur in der Hand hielten, häufige Veränderung geliebk,
mahts n einen Theil ihres Putzes daraus ge-
macht. ö
In Frankreich führten die Damen ſchon ſehr früh
ein biegſames, leichtes Stäbchen, wie Konſtanze, König
Roberts zweite Gemahlin, welche ſich desſelben auch
bediente, um ihrem Beichtvater Stephan die Augen
auszuſtechen. In den Zeiten des fümfzehnten und ſech-
zehnten Ludwig bedienten ſie ſich eigentlicher Spazier-
ſtöcke, um ſich beini Gehen auf den hohen Schuhabſätzen
in ihren ſchweren Kleidern darauf 5.. ſtützen, welche
Mode zu Beginn des Kaiſerreichs, aber voxübergehend,
wieder auftauchte. ö ——
Der Fächer iſt ſchon uralten Gebrauchs und auf
der ganzen Erde anzutreffen. Indien, China, die rö-
miſche Welt und das heutige Europa kannten und ken-
nen Fächer. Die älteſten wurden von Vogelfedern ge-
macht. „ ö
Unter Ludwig dem Vierzehnten trugen die Frauen
im Wagen und aüch zu Fuß einen kleinen Spiegel mit
einem Stiel, um in jedem Augenblick ihren dazumal
ſehr künſtlichen Kopfputz muſtern und ordnen zu können.
Die Muffe ſind ziemlich alt, wenn ſie auch nicht,
wie das Tragen des Pelzwerkes, aus den Zeiten der
Gallier ſtammen. Von Rauchwerk waren Hermelin
und Feh ausſchließliche Abzeichen des hohen Adels,
welcher ſie daher das ganze Jahr hindurch trug; ſie
kamen dadurch auch in die Wappen. In den letzten
Zeiten des ancien regime führten die Franzoſen im
Sommer Muffe von Seide mit allerlei Stickereien und
ſonſtigen Zierrathen. Es gehörte damals auch zum
guten Ton, einen kleinen Hund im Muff mit ſich zu
tragen. Von Franz des Erſten bis zu Ludwig des
Vierzehnten Tagen trugen die Frauen oft die Sam-
metlarve in der Hand, mit der ſie in freier Luft ihr
Antlitz zu bedecken pflegten.
Der Sonnenſchirm, obwohl weit nützlicher als de“
Fächer, war früher doch weniger gebräuchlich. Einige
alte Gemälde beweiſen, daß er unter Karl dem Fünf-
ten bereits bekannt war, doch bedienten die Franen ſich
lieber der Hüte und Schleier, um ſich vor der Sonne
zu ſchermen. Von allen Gegenſtänden, welchen die
Mode den Frauen je in die Hände gab, hat wohl kaum
einer ſo lange ſeinen Platz behauptet, als das Schnupf-
tuch, das unſere Vorfahren Nastüchlein oder Fazolet
nannten. Bei jeglicher Bewegung und im Spiel der
Lüfte ſich entfaltend, zieht es ganz natürlich die Blicke
auf ſich, giebt zu den reizendſten Bewegungen Anlaß,
und wir vermögen nicht zu tadeln, daß es neuerdings
ein Gegenſtand ganz beſonderer Vorliebe geworden iſt.
Die erſten Blumen.
Seid ihr da, ihr ſtillen Boten, hat das Licht euch ſchon geſandt?
Ha, das Licht es ſegnet immer, ſegnet über Meer und Land!
Tauſendmal ſeid ihr erſchienen mahnend auf der Frühlingsbahn,
Was ihr tauſendmal verkündet, kündet ihr jetzt wieder an:
Rur im Licht gedeiht die Blume, nur im Licht das Menſchen-
glück ö
Darum drängt das Licht des Geiſtes —Menſchen, drängt es nie
— zurück! ö
Laßt es walten frei und offen in der Schile, in dem Haus,
Löſcht es länger doch, o Pfaffen, nicht mehr in den Kirchen aus!
Secretär, jeder, der Sie kennt, Herr Zoll⸗Direktor,
nur das Geſetz
Ich unterwerfe mich ihm willig, unterbrach ihn der
Redliche, und danke Ihnen für Ihre Theilnahme.
Weine nicht, Laide, weinet nicht, meine Freunde,
ſagte er zu den Wiedereintretenden, welche bei der
Ankunft des Secretärs ſich entfernt hatten, ich bin eue-
rer nicht unwürdig, mein Herz hat gehandelt ohne die
Vernunft, und ſehet, das Schickſal läßt meinem Her-
zen reichen Lohn werden. Dein Friedberg iſt geret-
tet, Laide, ich habe das Glück Deines Lebens erkauft;
das Opfer iſt groß, aber auf mir laſtet nur die Schuld
der Unbeſonnenheit, nicht der Unredlichkeit. Was hätte
ich nicht für Dich gethan! Aber gehe hin mit dem
redlichen Treumann zu dem armen Friedberg. Wenn
er mein Schickſal hören wird, es wird ihn zu tief er-
ſchüttern. Bringe ihm dieſen Druck der Freundſchaft,
dieſen Kuß der Bruderliebe. Laß ihn meinetwegen
undekümmert ſein und bald in meine Arme eilen.
Laide, die noch immer im Dunkeln ſchwebte, was
ihres Geliebten Schickſal mit dem Schickſale ihres Bru-—
ders für einen Zuſammenhang habe, ließ einige Freunde
bei Völknern, und eilte mit Treumann zu Friedberg.
— Ach! ſie war ihm die Erſcheinung eines Engels.
Seine Jugend überwand die heftige Erſchütterung,
welche er erlitten; aber mit welchem Gefühle hörte er
jetzt das Schickſal ſeines Retters. Wie klagte er ſich
ſelbſt, ſein Schickſal an! Und als Laide vernahm, was
ihr Bruder für ihn gethan hatte, da riß ſie ſich aus
Friedbergs Armen, und ein leiſes Gefühl der Abnei-
gung durchzuckte ihr Herz gegen den Urheber des Un-
glücks eines ſo geliebten Bruders. Nur der Schmerz,
der aus jedem ſeiner Züge ſprach, die Reue, die ihn
zu Boden drücktr, die Bläſſe ſeiner Wangen, die inne-
ren Leiden des Heißgeliebten vermochten zu verhindern,
daß dieſes flüchtige Gefühl nicht in bleibenden Wider-
willen überging. — Sir eilte zu ihrem Bruder zurück;
ihm glaubte ſie ſich jetzt ganz ſchuldig zu ſein. ö
Es vergingen mehrere Tage, ehe der Arzt auf das
geheime Befragen des Miniſters erklärte, daß der Kranke
im Stande ſei, dem Verhöre zu untergehen.
ö (Schluß folgt.)
Zur Geſchichte der Moden.
Die Frauen haben von je her auch in dem, was ſie
nur in der Hand hielten, häufige Veränderung geliebk,
mahts n einen Theil ihres Putzes daraus ge-
macht. ö
In Frankreich führten die Damen ſchon ſehr früh
ein biegſames, leichtes Stäbchen, wie Konſtanze, König
Roberts zweite Gemahlin, welche ſich desſelben auch
bediente, um ihrem Beichtvater Stephan die Augen
auszuſtechen. In den Zeiten des fümfzehnten und ſech-
zehnten Ludwig bedienten ſie ſich eigentlicher Spazier-
ſtöcke, um ſich beini Gehen auf den hohen Schuhabſätzen
in ihren ſchweren Kleidern darauf 5.. ſtützen, welche
Mode zu Beginn des Kaiſerreichs, aber voxübergehend,
wieder auftauchte. ö ——
Der Fächer iſt ſchon uralten Gebrauchs und auf
der ganzen Erde anzutreffen. Indien, China, die rö-
miſche Welt und das heutige Europa kannten und ken-
nen Fächer. Die älteſten wurden von Vogelfedern ge-
macht. „ ö
Unter Ludwig dem Vierzehnten trugen die Frauen
im Wagen und aüch zu Fuß einen kleinen Spiegel mit
einem Stiel, um in jedem Augenblick ihren dazumal
ſehr künſtlichen Kopfputz muſtern und ordnen zu können.
Die Muffe ſind ziemlich alt, wenn ſie auch nicht,
wie das Tragen des Pelzwerkes, aus den Zeiten der
Gallier ſtammen. Von Rauchwerk waren Hermelin
und Feh ausſchließliche Abzeichen des hohen Adels,
welcher ſie daher das ganze Jahr hindurch trug; ſie
kamen dadurch auch in die Wappen. In den letzten
Zeiten des ancien regime führten die Franzoſen im
Sommer Muffe von Seide mit allerlei Stickereien und
ſonſtigen Zierrathen. Es gehörte damals auch zum
guten Ton, einen kleinen Hund im Muff mit ſich zu
tragen. Von Franz des Erſten bis zu Ludwig des
Vierzehnten Tagen trugen die Frauen oft die Sam-
metlarve in der Hand, mit der ſie in freier Luft ihr
Antlitz zu bedecken pflegten.
Der Sonnenſchirm, obwohl weit nützlicher als de“
Fächer, war früher doch weniger gebräuchlich. Einige
alte Gemälde beweiſen, daß er unter Karl dem Fünf-
ten bereits bekannt war, doch bedienten die Franen ſich
lieber der Hüte und Schleier, um ſich vor der Sonne
zu ſchermen. Von allen Gegenſtänden, welchen die
Mode den Frauen je in die Hände gab, hat wohl kaum
einer ſo lange ſeinen Platz behauptet, als das Schnupf-
tuch, das unſere Vorfahren Nastüchlein oder Fazolet
nannten. Bei jeglicher Bewegung und im Spiel der
Lüfte ſich entfaltend, zieht es ganz natürlich die Blicke
auf ſich, giebt zu den reizendſten Bewegungen Anlaß,
und wir vermögen nicht zu tadeln, daß es neuerdings
ein Gegenſtand ganz beſonderer Vorliebe geworden iſt.
Die erſten Blumen.
Seid ihr da, ihr ſtillen Boten, hat das Licht euch ſchon geſandt?
Ha, das Licht es ſegnet immer, ſegnet über Meer und Land!
Tauſendmal ſeid ihr erſchienen mahnend auf der Frühlingsbahn,
Was ihr tauſendmal verkündet, kündet ihr jetzt wieder an:
Rur im Licht gedeiht die Blume, nur im Licht das Menſchen-
glück ö
Darum drängt das Licht des Geiſtes —Menſchen, drängt es nie
— zurück! ö
Laßt es walten frei und offen in der Schile, in dem Haus,
Löſcht es länger doch, o Pfaffen, nicht mehr in den Kirchen aus!