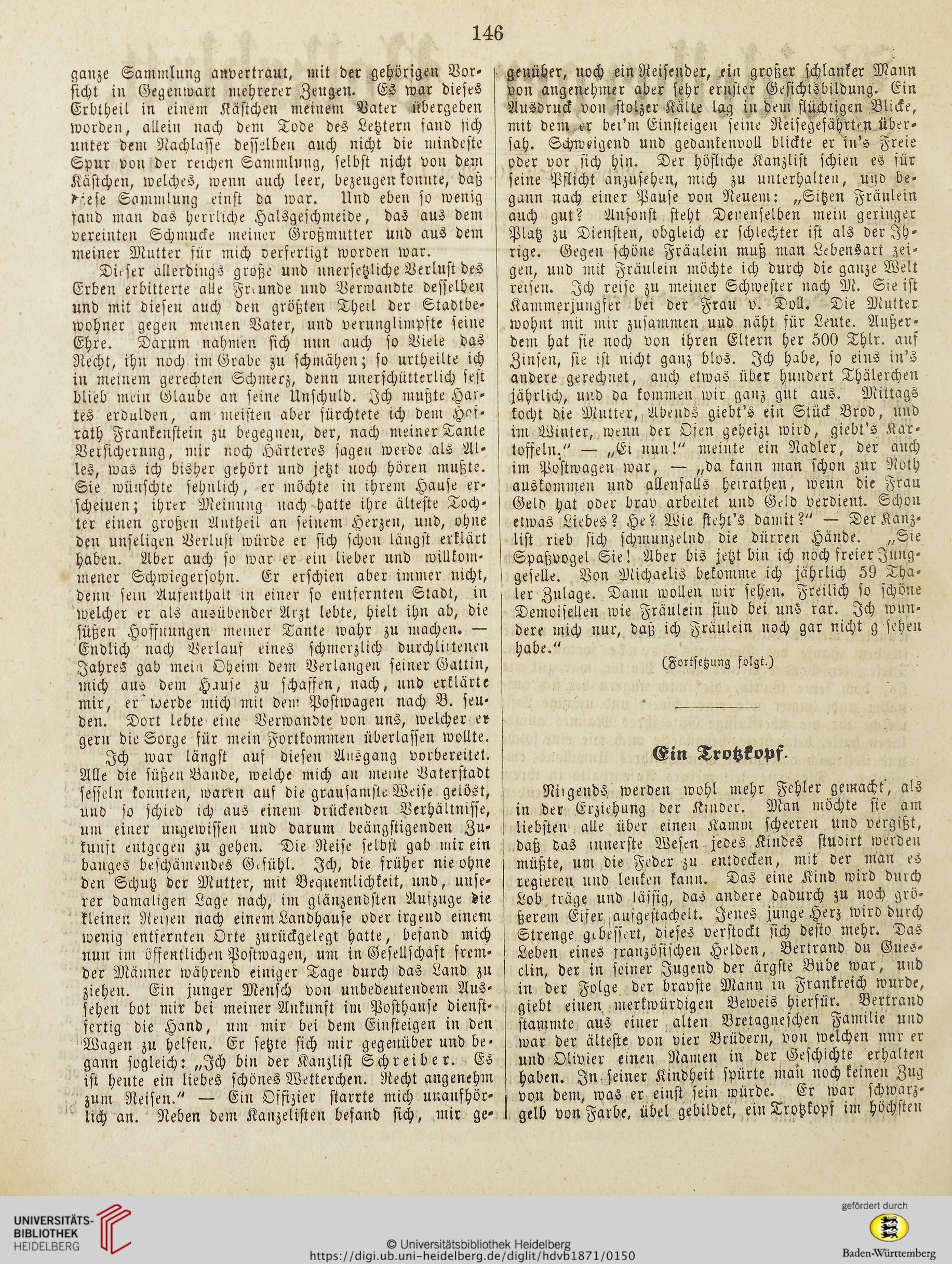146
ganze Sammlung anvertraut, mit der gehörigen Vor-
ſicht in Gegenwart mehrerer Zeugen. Es waͤr dieſes
Erbtheil in einem Käſtchen meinem Bater Abergeben
worden, allein nach dem Tode des Letztern fand ſich
unter dem Nachlaſſe deſſelben auch nicht die mindeſte
Spur von der reichen Sammlung, ſelbſt nicht von dem
Käſtchen, welches, wenn auch leer, bezeugen konnte, daß
eſe Sammlung einſt da war. Und eben ſo wenig
fand man das herrliche Halsgeſchmeide, das aus dem
vereinten Schmucke meiner Großmutter und aus dem
meiner Mutter für mich derfertigt worden war.
Dieſer allerdings große und unerſetzliche Verluſt des
Erben erbitterte alle Freunde und Verwandte deſſelben
und mit dieſen auch den größten Theil der Stadtbe-
Chre. gegen meinen Vater, und verunglimpfte ſeine
Ehre.
Recht, ihn noch im Grabe zu ſchmähen; ſo urtheilte ich
in meinem gerechten Schmerz, denn unerſchütterlich feſt
blieb mein Glaube an ſeine Unſchuld. Ich mußte Har-—
tes erdulden, am meiſten aber fürchtete ich dem Haf-
rath Frankenſtein zu begegnen, der, nach meiner Tante
mener Schwiegerſohn.
Verſicherung, mir noch Härteres ſagen werde als Al-
les, was ich bisher gehört und jetzt uoch hören mußte.
Sie wünſchte ſehnlich, er möchte in ihrem Hauſe er-
ſcheiuen; ihrer Meinung nach hatte ihre älteſte Toch-
ter einen großen Antheil an ſeinem Herzen, und, ohne
den unſeligen Verluſt würde er ſich ſchon läugſt erklärt
haben. Aber auch ſo war er ein lieber und willkom-
Er erſchien aber immer nicht,
denn ſein Aufenthalt in einer ſo entfernten Stadt, in
welcher er als ausübender Arzt lebte, hielt ihn ab, die
ſüßen Hoffnungen meiner Tante wahr zu machen. —
Endlich nach Verlauf eines ſchmerzlich durchliitenen
Jahres gab mein Oheim dem Verlangen ſeiner Gattin,
mich aus dem Hauſe zu ſchaffen, nach, und erklärte
mir, er werde mich mit dem Poſtwagen nach B. ſeu:
den. Dort lebte eine Verwandte von uns, welcher er
gern die Sorge für mein Fortkommen überlaſſen wollte.
Ich war längſt auf dieſen Ausgang vorbereitet.
Alle die ſüßen Bande, welche mich an meine Vaterſtadt
ſeſſeln konnten, waren auf die grauſamſte Weiſe gelöst,
und ſo ſchied ich aus einem drückenden Verhältniſſe,
Num einer ungewiſſen und darum beängſtigenden Zu-
kunft entgegen zu gehen. Die Reiſe ſelbſt gab mir ein
banges beſchämendes Gefühl. Ich, die früher nie ohne
den Schutz der Mutter, mit Bequemlichkeit, und, unſe-
rer damaligen Lage nach, im glänzendſten Aufzuge die
kleinen Rerſen nach einem Landhauſe oder irgend einem
wenig entfernten Orte zurückgelegt hatte, befand mich
nun im öffentlichen Poſtwagen, um in Geſellſchaft frem-
der Männer während einiger Tage durch das Land zu
ziehen. Ein junger Menſch von unbedeutendem Aus-
ſehen bot mir bei meiner Ankunft im Poſthauſe dienſt-
fertig die Hand, um mir bei dem Einſteigen in den
Wagen zu helfen. Er ſetzte ſich mir gegenüber und be-
gann ſogleich: „Ich bin der Kanzliſt Schreiber. Es
iſt heute ein liebes ſchönes Wetterchen. Recht angenehm
zum Reiſen.“ — Ein Offizier ſtarrte mich unaufhör-
Darum nahmen ſich nun auch ſo Viele das
lich an. Neben dem Kanzeliſten befand ſich, mir ge-
Lon angeuehnſer aper ſahr eröster Heſichtsbildung. Ein
Ausdruck von „ſtolzer Kälte lag in dem flüöchtigen Blicke,
mit dem er ber'm Einſteigen ſeine Reiſegefährtenüber-
ſah. Schweigend und gedankenvoll blickte er in's Freie
oder vor ſich hin. Der höfliche Kanzliſt ſchien es für
ſeine Pflicht anzuſehen, mich zu unterhalten, und be-
gann nach einer Pauſe von Neuem: „Sitzen Fräulein
auch gut? Anſonſtéſteht Denenſelben mein geringer
Platz zu Dienſten, obgleich er ſchlechter iſt als der Ih-
rige. Gegen ſchöne Fräulein muß man Lebensart zei-
gen, und mit Fräulein möchte ich durch die ganze Welt
reiſen. Ich reiſe zu meiner Schweſter nach M. Sie iſt
Kammerjungfer bei der Frau v. Doll. Die Mutter
wohnt mit mir zuſammen und näht für Leute. Außer-
dem hat ſie noch von ihren Eltern her 500 Thlr. auf
Zinſen, ſie iſt nicht ganz blos. Ich habe, ſo eins in's
andere gerechnet, auch etwas über hundert Thälerchen
jährlich, und da kommen wir ganz gut aus. Mittags
kocht die Mutter, Abends giebt's ein Stück Brod, und
im Winter, wenn der Ofen geheizt wird, giebt's Kar-
toffeln.“ — „Ei nun!“ meinte ein Nadler, der auch
im Poſtwagen war, — „da kann man ſchon zur Noth
auskommen und allenfalls heirathen, wenn die Frau
Geld hat oder brav arbeitet und Geld verdient. Schon
etwas Liebes? He? Wie ſteht's damit?“ — Der Kanz-
liſt rieb ſich ſchmunzelnd die dürren Hände. „Sie
Spaßvogel Sie! Aber bis jetzt bin ich noch freier Jung-
geſelle. Von Michaelis bekomme ich jährlich 59 Tha-
ler Zulage. Dann wollen wir ſehen. Freilich ſo ſchöne
Demoiſellen wie Fräulein ſind bei uns rar. Ich wun-
dere mich nur, daß ich Fräulein noch gar nicht geſehen
abe.“
ö (Fortſetzung folgt.)
1* N Tin großer alanrer Mann
Ein Trotztopf
Nirgends werden wohl mehr Fehler gemacht, als
in der Erziehung der Kinder. Man möchte ſie am
liebſten alle über einen Kamm ſcheeren und vergißt,
daß das innerſte Weſen jedes Kindes ſtudirt werden
müßte, um die Feder zu entdecken, mit der man es
regieren und lenken kann. Das eine Kind wird durch
Lob träge und läſſig, das andere dadurch zu noch grö-
ßerem Eifer aufgeſtachelt. Jenes junge Herz wird durch
Strenge gebeſſert, dieſes verſtockt ſich deſto mehr. Das
Leben eines franzöſiſchen Helden, Bertrand du Gues-
clin, der in ſeiner Jugend der ärgſte Bude war, und
in der Folge der brapſte Mann in Frankreich wurde,
giebt einen; merkwürdigen Beweis hierfür. Bertrand
ſtammte, aus einer alten Bretagneſchen Familie und
war der älteſte pon vier Brüdern, von welchen nur er
und Olivier einen Namen in der Geſchichte erhalten
haben. In ſeiner Kindheit ſpürte man noch keinen Zug
von dem, was er einſt ſein würde. Er war ſchwarz-
gelb von Farbe, übel gebildet, ein Trobkopf im höchſten
ganze Sammlung anvertraut, mit der gehörigen Vor-
ſicht in Gegenwart mehrerer Zeugen. Es waͤr dieſes
Erbtheil in einem Käſtchen meinem Bater Abergeben
worden, allein nach dem Tode des Letztern fand ſich
unter dem Nachlaſſe deſſelben auch nicht die mindeſte
Spur von der reichen Sammlung, ſelbſt nicht von dem
Käſtchen, welches, wenn auch leer, bezeugen konnte, daß
eſe Sammlung einſt da war. Und eben ſo wenig
fand man das herrliche Halsgeſchmeide, das aus dem
vereinten Schmucke meiner Großmutter und aus dem
meiner Mutter für mich derfertigt worden war.
Dieſer allerdings große und unerſetzliche Verluſt des
Erben erbitterte alle Freunde und Verwandte deſſelben
und mit dieſen auch den größten Theil der Stadtbe-
Chre. gegen meinen Vater, und verunglimpfte ſeine
Ehre.
Recht, ihn noch im Grabe zu ſchmähen; ſo urtheilte ich
in meinem gerechten Schmerz, denn unerſchütterlich feſt
blieb mein Glaube an ſeine Unſchuld. Ich mußte Har-—
tes erdulden, am meiſten aber fürchtete ich dem Haf-
rath Frankenſtein zu begegnen, der, nach meiner Tante
mener Schwiegerſohn.
Verſicherung, mir noch Härteres ſagen werde als Al-
les, was ich bisher gehört und jetzt uoch hören mußte.
Sie wünſchte ſehnlich, er möchte in ihrem Hauſe er-
ſcheiuen; ihrer Meinung nach hatte ihre älteſte Toch-
ter einen großen Antheil an ſeinem Herzen, und, ohne
den unſeligen Verluſt würde er ſich ſchon läugſt erklärt
haben. Aber auch ſo war er ein lieber und willkom-
Er erſchien aber immer nicht,
denn ſein Aufenthalt in einer ſo entfernten Stadt, in
welcher er als ausübender Arzt lebte, hielt ihn ab, die
ſüßen Hoffnungen meiner Tante wahr zu machen. —
Endlich nach Verlauf eines ſchmerzlich durchliitenen
Jahres gab mein Oheim dem Verlangen ſeiner Gattin,
mich aus dem Hauſe zu ſchaffen, nach, und erklärte
mir, er werde mich mit dem Poſtwagen nach B. ſeu:
den. Dort lebte eine Verwandte von uns, welcher er
gern die Sorge für mein Fortkommen überlaſſen wollte.
Ich war längſt auf dieſen Ausgang vorbereitet.
Alle die ſüßen Bande, welche mich an meine Vaterſtadt
ſeſſeln konnten, waren auf die grauſamſte Weiſe gelöst,
und ſo ſchied ich aus einem drückenden Verhältniſſe,
Num einer ungewiſſen und darum beängſtigenden Zu-
kunft entgegen zu gehen. Die Reiſe ſelbſt gab mir ein
banges beſchämendes Gefühl. Ich, die früher nie ohne
den Schutz der Mutter, mit Bequemlichkeit, und, unſe-
rer damaligen Lage nach, im glänzendſten Aufzuge die
kleinen Rerſen nach einem Landhauſe oder irgend einem
wenig entfernten Orte zurückgelegt hatte, befand mich
nun im öffentlichen Poſtwagen, um in Geſellſchaft frem-
der Männer während einiger Tage durch das Land zu
ziehen. Ein junger Menſch von unbedeutendem Aus-
ſehen bot mir bei meiner Ankunft im Poſthauſe dienſt-
fertig die Hand, um mir bei dem Einſteigen in den
Wagen zu helfen. Er ſetzte ſich mir gegenüber und be-
gann ſogleich: „Ich bin der Kanzliſt Schreiber. Es
iſt heute ein liebes ſchönes Wetterchen. Recht angenehm
zum Reiſen.“ — Ein Offizier ſtarrte mich unaufhör-
Darum nahmen ſich nun auch ſo Viele das
lich an. Neben dem Kanzeliſten befand ſich, mir ge-
Lon angeuehnſer aper ſahr eröster Heſichtsbildung. Ein
Ausdruck von „ſtolzer Kälte lag in dem flüöchtigen Blicke,
mit dem er ber'm Einſteigen ſeine Reiſegefährtenüber-
ſah. Schweigend und gedankenvoll blickte er in's Freie
oder vor ſich hin. Der höfliche Kanzliſt ſchien es für
ſeine Pflicht anzuſehen, mich zu unterhalten, und be-
gann nach einer Pauſe von Neuem: „Sitzen Fräulein
auch gut? Anſonſtéſteht Denenſelben mein geringer
Platz zu Dienſten, obgleich er ſchlechter iſt als der Ih-
rige. Gegen ſchöne Fräulein muß man Lebensart zei-
gen, und mit Fräulein möchte ich durch die ganze Welt
reiſen. Ich reiſe zu meiner Schweſter nach M. Sie iſt
Kammerjungfer bei der Frau v. Doll. Die Mutter
wohnt mit mir zuſammen und näht für Leute. Außer-
dem hat ſie noch von ihren Eltern her 500 Thlr. auf
Zinſen, ſie iſt nicht ganz blos. Ich habe, ſo eins in's
andere gerechnet, auch etwas über hundert Thälerchen
jährlich, und da kommen wir ganz gut aus. Mittags
kocht die Mutter, Abends giebt's ein Stück Brod, und
im Winter, wenn der Ofen geheizt wird, giebt's Kar-
toffeln.“ — „Ei nun!“ meinte ein Nadler, der auch
im Poſtwagen war, — „da kann man ſchon zur Noth
auskommen und allenfalls heirathen, wenn die Frau
Geld hat oder brav arbeitet und Geld verdient. Schon
etwas Liebes? He? Wie ſteht's damit?“ — Der Kanz-
liſt rieb ſich ſchmunzelnd die dürren Hände. „Sie
Spaßvogel Sie! Aber bis jetzt bin ich noch freier Jung-
geſelle. Von Michaelis bekomme ich jährlich 59 Tha-
ler Zulage. Dann wollen wir ſehen. Freilich ſo ſchöne
Demoiſellen wie Fräulein ſind bei uns rar. Ich wun-
dere mich nur, daß ich Fräulein noch gar nicht geſehen
abe.“
ö (Fortſetzung folgt.)
1* N Tin großer alanrer Mann
Ein Trotztopf
Nirgends werden wohl mehr Fehler gemacht, als
in der Erziehung der Kinder. Man möchte ſie am
liebſten alle über einen Kamm ſcheeren und vergißt,
daß das innerſte Weſen jedes Kindes ſtudirt werden
müßte, um die Feder zu entdecken, mit der man es
regieren und lenken kann. Das eine Kind wird durch
Lob träge und läſſig, das andere dadurch zu noch grö-
ßerem Eifer aufgeſtachelt. Jenes junge Herz wird durch
Strenge gebeſſert, dieſes verſtockt ſich deſto mehr. Das
Leben eines franzöſiſchen Helden, Bertrand du Gues-
clin, der in ſeiner Jugend der ärgſte Bude war, und
in der Folge der brapſte Mann in Frankreich wurde,
giebt einen; merkwürdigen Beweis hierfür. Bertrand
ſtammte, aus einer alten Bretagneſchen Familie und
war der älteſte pon vier Brüdern, von welchen nur er
und Olivier einen Namen in der Geſchichte erhalten
haben. In ſeiner Kindheit ſpürte man noch keinen Zug
von dem, was er einſt ſein würde. Er war ſchwarz-
gelb von Farbe, übel gebildet, ein Trobkopf im höchſten