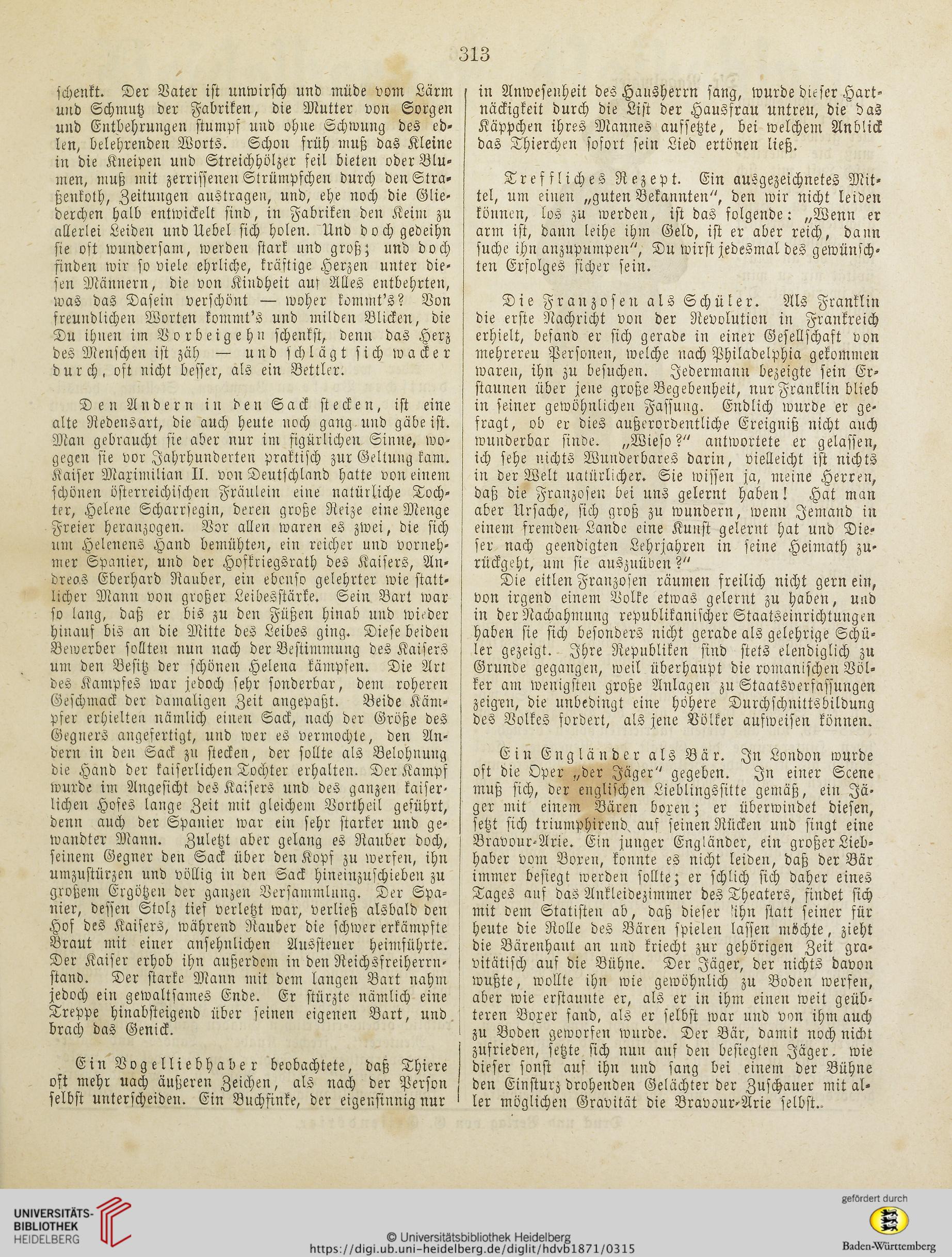chenkt.
und Schmutz der Fabriken, die Mutter von Sorgen
und Entbehrungen ſtumpf und ohne Schwung des ed-
len, belehrenden Worts. Schon früh muß das Kleine
in die Kneipen und Streichhölzer feil bieten oder Blu-
men, muß mit zerriſſenen Strümpfchen durch den Stra-
ßenkoth, Zeitungen austragen, und, ehe noch die Glie-
derchen halb entwickelt ſind, in Fabriken den Keim zu
allerlei Leiden und Uebel ſich holen. Und doch gedeihn
ſie oft wunderſam, werden ſtark und groß; und doch
finden wir ſo viele ehrliche, kräftige Herzen unter die-
ſen Männern, die von Kindheit auf Alles entbehrten,
was das Daſein verſchönt — woher kommt's? Von
freundlichen Worten kommt's und milden Blicken, die
Du ihnen im Vorbeigehn ſchenkſt, denn das Herz
des Menſchen iſt zäih — und ſchlägt ſich wacker
durch, oft nicht beſſer, als ein Bettler.
Den Andern in den Sack ſtecken, iſt eine
alte Redensart, die auch heute noch gang und gäbe iſt.
Man gebraucht ſie aber nur im figürlichen. Sinne, wo-
gegen ſie vor Jahrhunderten praktiſch zur Geltung kam.
Kaiſer Maximilian II. von Deutſchland hatte von einem
ſchönen öſterreichiſchen Fräulein eine natürliche Toch-—
ter, Helene Scharrſegin, deren große Reize eine Menge
Freier heranzogen. Vor allen waren es zwei, die ſich
um Helenens Hand bemühten, ein reicher und vorneh-
mer Spanier, und der Hofkriegsrath des Kaiſers, An-—
dreos Eberhard Rauber, ein ebenſo gelehrter wie ſtatt-
licher Mann von großer Leibesſtärke. Sein Bart war
ſo lang, daß er bis zu den Füßen hinab und wieder
hinauf bis an die Mitte des Leibes ging. Dieſe beiden
Bewerber ſollten nun nach der Beſtimmung des Kaiſers
um den Beſitz der ſchönen Helena kämpfen. Die Art
des Kampfes war jedoch ſehr ſonderbar, dem roheren
Geſchmack der damaligen Zeit angepaßt. Beide Käm-
pfer erhielten nämlich einen Sack, nach der Größe des
Gegners angefertigt, und wer es vermochte, den An-—
dern in den Sack zu ſtecken, der ſollte als Belohnung
die Hand der kaiſerlichen Tochter erhalten. Der Kampf
wurde im Angeſicht des Kaiſers und des ganzen kaiſer-
lichen Hofes lange Zeit mit gleichem Vortheil geführt,
denn auch der Spanier war ein ſehr ſtarker und ge-
wandter Mann. Zuletzt aber gelang es Rauber doch,
ſeinem Gegner den Sack über den Kopf zu werfen, ihn
umzuſtürzen und völlig in den Sack hineinzuſchieben zu
großem Ergötzen der ganzen Verſammlung. Der Spa-
nier, deſſen Stolz tief verletzt war, verließ alsbald den
Hof des Kaiſers, während Rauher die ſchwer erkämpfte
Braut mit einer anſehnlichen Ausſteuer heimführte.
Der Kaiſer erhob ihn außerdem in den Reichsfreiherrn-
ſtand. Der ſtarke Mann mit dem langen Bart nahm
jedoch ein gewaltſames Ende. Er ſtürzte nämlich eine
Treppe hinabſteigend über ſeinen eigenen Bart, und.
brach das Genick.
Ein Vogelliebhaber beobachtete, daß Thiere
oft mehr uach äußeren Zeichen, als nach der Perſon
ſelbſt unterſcheiden. Ein Buchfinke, der eigenſinnig nur
Der Vater iſt unwirſch und müde vom Lärm
313
in Anweſenheit des Hausherrn ſang, wurde dieſer Hart-
näckigkeit durch die Liſt der Hausfrau untreu, die das
Käppchen ihres Mannes aufſetzte, bei welchem Anblick
das Thierchen ſofort ſein Lied ertönen ließ. ö
Treffliches Rezept. Ein ausgezeichnetes Mit-
tel, um einen „guten Bekannten“, den wir nicht leiden
können, los zu werden, iſt das folgende: „Wenn er
arm iſt, dann leihe ihm Geld, iſt er aber reich, dann
ſuche ihn anzupumpen“, Du wirſt jedesmal des gewünſch-
ten Erfolges ſicher ſein.
Die Franzoſen als Schüler. Als Franklin
die erſte Nachricht von der Revolution in Frankreich
erhielt, befand er ſich gerade in einer Geſellſchaft von
mehrereu Perſonen, welche nach Philadelphia gekommen
waren, ihn zu beſuchen. Jedermann bezeigte ſein Er-
ſtaunen über jene große Begebenheit, nur Franklin blieb
in ſeiner gewöhnlichen Faſſung. Endlich wurde er ge-
fragt, ob er dies außerordentliche Ereigniß nicht auch
wunderbar ſinde. „Wieſo?“ antwortete er gelaſſen,
ich ſehe nichts Wunderbares darin, vielleicht iſt nichts
in der Welt uatürlicher. Sie wiſſen ja, meine Herren,
daß die Franzoſen bei uns gelernt haben! Hat man
aber Urſache, ſich groß zu wundern, wenn Jemand in
einem fremden Lande eine Kunſt gelernt hat und Die-
ſer nach geendigten Lehrjahren in ſeine Heimath zu-
rückgeht, um ſie auszuüben?“ ö
Die eitlen Franzoſen räumen freilich nicht gern ein,
von irgend einem Volke etwas gelernt zu haben, und
in der Nachahmung republikaniſcher Staatseinrichtungen
haben ſie ſich beſonders nicht gerade als gelehrige Schü-
ler gezeigt. Ihre Republiken ſind ſtets elendiglich zu
Grunde gegangen, weil überhaupt die romaniſchen Völ-
ker am wenigſten große Anlagen zu Staatsverfaſſungen
zeigen, die unbedingt eine höhere Durchſchnittsbildung
des Volkes fordert, als jene Völker aufweiſen können.
Ein Engländer als Bär. In London wurde
oft die Oper 5der Jäger“ gegeben. In einer Scene
muß ſich, der engliſchen Lieblingsſitte gemäß, ein Jä-
ger mit einem Bären boxen; er überwindet dieſen,
ſetzt ſich triumphitend auf ſeinen Rücken und ſingt eine
Bravour-Arie. Ein junger Engländer, ein großer Lieb-
haber vom Boxen, konnte es nicht leiden, daß der Bär
immer beſiegt werden ſollte; er ſchlich ſich daher eines
Tages auf das Ankleidezimmer des Theaters, findet ſich
mit dem Statiſten ab, daß dieſer ihn ſtatt ſeiner für
heute die Rolle des Bären ſpielen laſſen moͤchte, zieht
die Bärenhaut an und kriecht zur gehörigen Zeit gra-
vitätiſch auf die Bühne. Der Jäger, der nichts davon
wußte, wollte ihn wie gewöhnlich zu Boden werfen,
aber wie erſtaunte er, als er in ihm einen weit geüb-
teren Boxer fand, als er ſelbſt war und von ihm auch
zu Boden geworfen wurde. Der Bär, damit noch nicht
zufrieden, ſetzte ſich nun auf den beſiegten Jäger wie
dieſer ſonſt auf ihn und ſang bei einem der Bühne
den Einſturz drohenden Gelächter der Zuſchauer mit al-
ler möglichen Gravität die Bravour-Arie ſelbſt..
und Schmutz der Fabriken, die Mutter von Sorgen
und Entbehrungen ſtumpf und ohne Schwung des ed-
len, belehrenden Worts. Schon früh muß das Kleine
in die Kneipen und Streichhölzer feil bieten oder Blu-
men, muß mit zerriſſenen Strümpfchen durch den Stra-
ßenkoth, Zeitungen austragen, und, ehe noch die Glie-
derchen halb entwickelt ſind, in Fabriken den Keim zu
allerlei Leiden und Uebel ſich holen. Und doch gedeihn
ſie oft wunderſam, werden ſtark und groß; und doch
finden wir ſo viele ehrliche, kräftige Herzen unter die-
ſen Männern, die von Kindheit auf Alles entbehrten,
was das Daſein verſchönt — woher kommt's? Von
freundlichen Worten kommt's und milden Blicken, die
Du ihnen im Vorbeigehn ſchenkſt, denn das Herz
des Menſchen iſt zäih — und ſchlägt ſich wacker
durch, oft nicht beſſer, als ein Bettler.
Den Andern in den Sack ſtecken, iſt eine
alte Redensart, die auch heute noch gang und gäbe iſt.
Man gebraucht ſie aber nur im figürlichen. Sinne, wo-
gegen ſie vor Jahrhunderten praktiſch zur Geltung kam.
Kaiſer Maximilian II. von Deutſchland hatte von einem
ſchönen öſterreichiſchen Fräulein eine natürliche Toch-—
ter, Helene Scharrſegin, deren große Reize eine Menge
Freier heranzogen. Vor allen waren es zwei, die ſich
um Helenens Hand bemühten, ein reicher und vorneh-
mer Spanier, und der Hofkriegsrath des Kaiſers, An-—
dreos Eberhard Rauber, ein ebenſo gelehrter wie ſtatt-
licher Mann von großer Leibesſtärke. Sein Bart war
ſo lang, daß er bis zu den Füßen hinab und wieder
hinauf bis an die Mitte des Leibes ging. Dieſe beiden
Bewerber ſollten nun nach der Beſtimmung des Kaiſers
um den Beſitz der ſchönen Helena kämpfen. Die Art
des Kampfes war jedoch ſehr ſonderbar, dem roheren
Geſchmack der damaligen Zeit angepaßt. Beide Käm-
pfer erhielten nämlich einen Sack, nach der Größe des
Gegners angefertigt, und wer es vermochte, den An-—
dern in den Sack zu ſtecken, der ſollte als Belohnung
die Hand der kaiſerlichen Tochter erhalten. Der Kampf
wurde im Angeſicht des Kaiſers und des ganzen kaiſer-
lichen Hofes lange Zeit mit gleichem Vortheil geführt,
denn auch der Spanier war ein ſehr ſtarker und ge-
wandter Mann. Zuletzt aber gelang es Rauber doch,
ſeinem Gegner den Sack über den Kopf zu werfen, ihn
umzuſtürzen und völlig in den Sack hineinzuſchieben zu
großem Ergötzen der ganzen Verſammlung. Der Spa-
nier, deſſen Stolz tief verletzt war, verließ alsbald den
Hof des Kaiſers, während Rauher die ſchwer erkämpfte
Braut mit einer anſehnlichen Ausſteuer heimführte.
Der Kaiſer erhob ihn außerdem in den Reichsfreiherrn-
ſtand. Der ſtarke Mann mit dem langen Bart nahm
jedoch ein gewaltſames Ende. Er ſtürzte nämlich eine
Treppe hinabſteigend über ſeinen eigenen Bart, und.
brach das Genick.
Ein Vogelliebhaber beobachtete, daß Thiere
oft mehr uach äußeren Zeichen, als nach der Perſon
ſelbſt unterſcheiden. Ein Buchfinke, der eigenſinnig nur
Der Vater iſt unwirſch und müde vom Lärm
313
in Anweſenheit des Hausherrn ſang, wurde dieſer Hart-
näckigkeit durch die Liſt der Hausfrau untreu, die das
Käppchen ihres Mannes aufſetzte, bei welchem Anblick
das Thierchen ſofort ſein Lied ertönen ließ. ö
Treffliches Rezept. Ein ausgezeichnetes Mit-
tel, um einen „guten Bekannten“, den wir nicht leiden
können, los zu werden, iſt das folgende: „Wenn er
arm iſt, dann leihe ihm Geld, iſt er aber reich, dann
ſuche ihn anzupumpen“, Du wirſt jedesmal des gewünſch-
ten Erfolges ſicher ſein.
Die Franzoſen als Schüler. Als Franklin
die erſte Nachricht von der Revolution in Frankreich
erhielt, befand er ſich gerade in einer Geſellſchaft von
mehrereu Perſonen, welche nach Philadelphia gekommen
waren, ihn zu beſuchen. Jedermann bezeigte ſein Er-
ſtaunen über jene große Begebenheit, nur Franklin blieb
in ſeiner gewöhnlichen Faſſung. Endlich wurde er ge-
fragt, ob er dies außerordentliche Ereigniß nicht auch
wunderbar ſinde. „Wieſo?“ antwortete er gelaſſen,
ich ſehe nichts Wunderbares darin, vielleicht iſt nichts
in der Welt uatürlicher. Sie wiſſen ja, meine Herren,
daß die Franzoſen bei uns gelernt haben! Hat man
aber Urſache, ſich groß zu wundern, wenn Jemand in
einem fremden Lande eine Kunſt gelernt hat und Die-
ſer nach geendigten Lehrjahren in ſeine Heimath zu-
rückgeht, um ſie auszuüben?“ ö
Die eitlen Franzoſen räumen freilich nicht gern ein,
von irgend einem Volke etwas gelernt zu haben, und
in der Nachahmung republikaniſcher Staatseinrichtungen
haben ſie ſich beſonders nicht gerade als gelehrige Schü-
ler gezeigt. Ihre Republiken ſind ſtets elendiglich zu
Grunde gegangen, weil überhaupt die romaniſchen Völ-
ker am wenigſten große Anlagen zu Staatsverfaſſungen
zeigen, die unbedingt eine höhere Durchſchnittsbildung
des Volkes fordert, als jene Völker aufweiſen können.
Ein Engländer als Bär. In London wurde
oft die Oper 5der Jäger“ gegeben. In einer Scene
muß ſich, der engliſchen Lieblingsſitte gemäß, ein Jä-
ger mit einem Bären boxen; er überwindet dieſen,
ſetzt ſich triumphitend auf ſeinen Rücken und ſingt eine
Bravour-Arie. Ein junger Engländer, ein großer Lieb-
haber vom Boxen, konnte es nicht leiden, daß der Bär
immer beſiegt werden ſollte; er ſchlich ſich daher eines
Tages auf das Ankleidezimmer des Theaters, findet ſich
mit dem Statiſten ab, daß dieſer ihn ſtatt ſeiner für
heute die Rolle des Bären ſpielen laſſen moͤchte, zieht
die Bärenhaut an und kriecht zur gehörigen Zeit gra-
vitätiſch auf die Bühne. Der Jäger, der nichts davon
wußte, wollte ihn wie gewöhnlich zu Boden werfen,
aber wie erſtaunte er, als er in ihm einen weit geüb-
teren Boxer fand, als er ſelbſt war und von ihm auch
zu Boden geworfen wurde. Der Bär, damit noch nicht
zufrieden, ſetzte ſich nun auf den beſiegten Jäger wie
dieſer ſonſt auf ihn und ſang bei einem der Bühne
den Einſturz drohenden Gelächter der Zuſchauer mit al-
ler möglichen Gravität die Bravour-Arie ſelbſt..