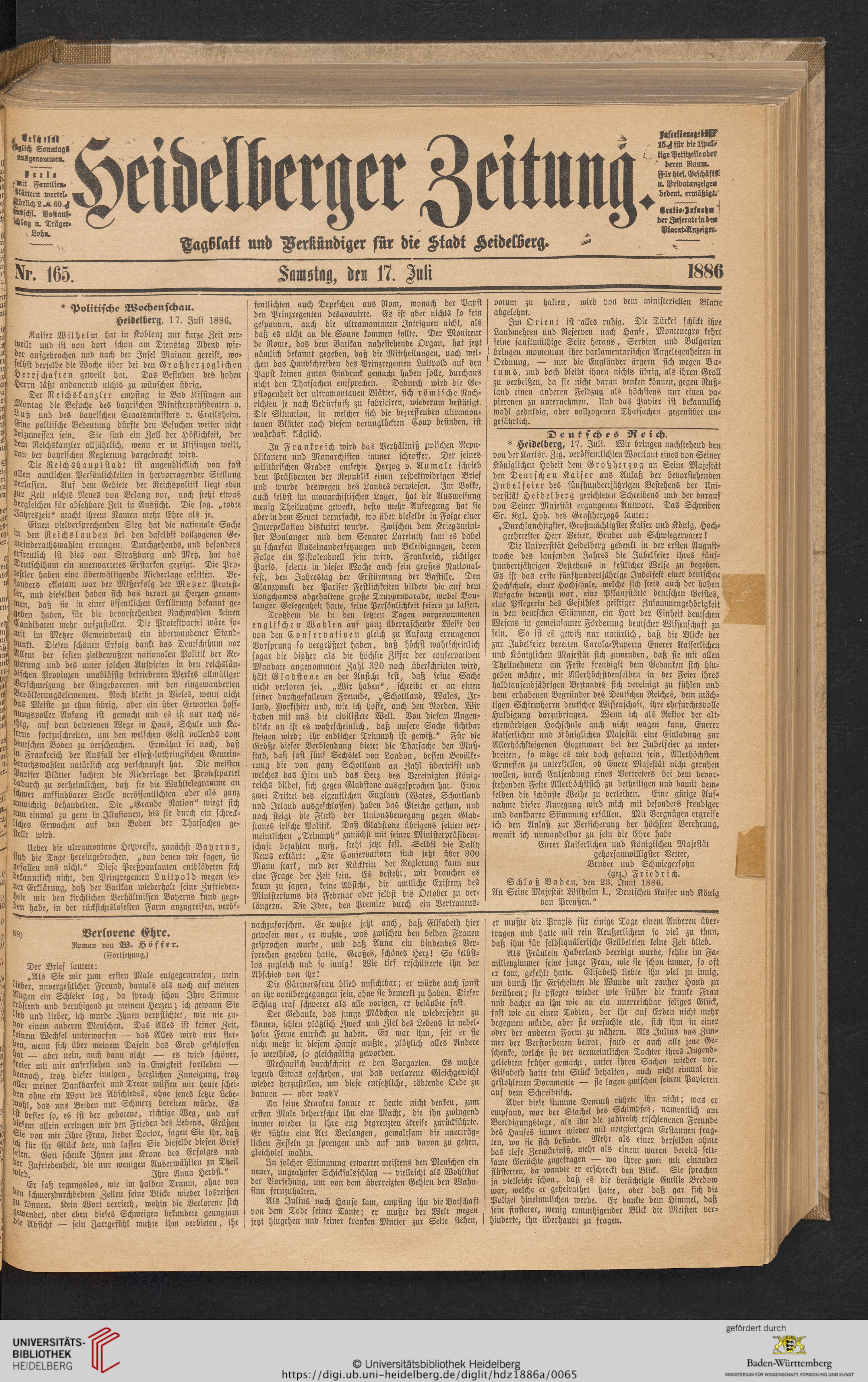Iaſetfisustibiſe
IEunr 5 v ö
Aalich Sonntags ö 9 153 für die Iſpal-
1 ansgenommen. — — 4. — Ruan Ranm.
—— ö en Raum.
A ae Für hiel. Geſchäftn
4 ſrit Familien⸗ n. Privatanzeigen
ö ane vꝛertel- bedeut. ermäßigr;
AUhr A. 60 4
4 deſchl. Poſtauf⸗ * Sratis-Anfusbu
ag u. Träger⸗ der Inſerate in den
9 „Lohn. „— — „* „ Plaeat⸗Anztiger
41S— Dagblalt und Verkündiger für die Stadt Heidelberg.⸗ . ——
H — —
U *
Tr. 165. Samstag, den 17. Zuli 1886
I —
½ 144 x „ fentlichten auch Depeſchen aus Rom, wonach der Papſt] votum zu halten, wird von dem miniſteriellen Blatt
Politiſche Wochenſchau den Pentrehenten desavouitte Es iſt aber nichts ſo fein abgelehnt. arte
Heidelberg, 17. Juli 1886.
10 Kaiſer Wil helm hat in Koblenz nur kurze Zeit ver-
weilt und iſt von dort ſchon am Dienstag Abend wie-
der aufgebrochen und nach der Inſel Mainau gereiſt, wo-
ſelbſt derſelbe die Woche über bei den Großherzoglichen
Herrſchaften geweilt hat. Das Befinden des hohen
Herrn läßt andauernd nichts zu wünſchen übrig.
ö Der Reichskanzler empfing in Bad Kiſſingen am
Montag die Beſuche des bayriſchen Miniſterpräſidenten v.
utz und des bahriſchen Staatsminiſters v. Crailsheim.
Eine politiſche Bedeutung dürfte den Beſuchen weiter nicht
4 veizumeſſen ſein. Sie ſind ein Zoll der Höflichkeit, der
u ſem Reichskanzler alljährlich, wenn er in Kiſſingen weilt,
von der bayriſchen Regierung dargebracht wird.
0 Die Reichshauptſtadt iſt augenblicklich von faſt
ei allen amtlichen Perſönlichkeiten in hervorragender Stellung
uf verlaſſen. Auf dem Gebiete der Reichspolitik liegt eben
in zur Zeit nichts Neues von Belang vor, noch ſteht etwas
de dergleichen für abſehbare Zeit in Ausſicht. Die ſog. „todte
ein Jahreszeit“ macht ihrem Namen mehr Ehre als je.
4„Einen vielberſprechenden Sieg hat die nationale Sache
rohm den Reichslanden bei den daſelbſt vollzogenen Ge-
er meinderathswahlen errungen. Durchgehends, und beſonders
erfreulich iſt dies von Straßburg und Metz, hat das
en Deutſchthum ein unerwartetes Erſtarken gezeigt. Die Pro-
d teſtler haben eine überwältigende Niederlage erlitten. Be-
ſonders eklatant war der Mißerfolg der Metzer Proteſt-
mler, und dieſelben haben ſich das derart zu Herzen genom-
SSESSEE
geben haben, für die bevorſtehenden Nachwahlen keinen
Candidaten mehr aufzuſtellen. Die Proteſtpartei wäre ſo-
t im Metzer Gemeinderath ein überwundener Stand-
dpunkt. Dieſen ſchönen Erfolg dankt das Deutſchthum vor
Allem der feſten zielbewußten nationalen Politik der Re-
gierung und des unter ſolchen Auſpicien in den reichslän-
diſchen Provinzen unabläſſig betriebenen Werkes allmäliger
Verſchmelzung der Eingeborenen mit den eingewanderten
evölkerungselementen. Noch bleibt ja Vieles, wenn nicht
das Meiſte zu thun übrig, aber ein über Erwarten hoff-
nungsvoller Anfang iſt gemacht und es iſt nur noch nö-
thig, auf dem betretenen Wege in Haus, Schule und Ka-
X ſerne fortzuſchreiten, um den welſchen Geiſt vollends vom
22 deutſchen Boden zu verſcheuchen. Erwähnt ſei noch, daß
n Frankreich der Ausfall der elſaß⸗lothringiſchen Gemein-
derathswahlen natürlich arg verſchnupft hat. Die meiſten
er Pariſer Blätter ſuchten die Niederlage der Proteſtpartei
dadurch zu verheimlichen, daß ſie die Wahltelegramme an
chwer auffindbarer Stelle veröffentlichten oder als ganz
unwichtig behandelten. Die „Grande Nation“ wiegt ſich
nun einmal zu gern in Illuſionen, bis ſie durch ein ſchreck-
liches Erwachen auf den Boden der Thatſachen ge-
tellt wird.
Ueber die ultramontane Hetzpreſſe, zunächſt Bayerns,
ſind die Tage hereingebrochen, „von denen wir ſagen, ſie
gefallen uns nicht.“ Dieſe Preßpaukanten entblödeten ſich
bekanntlich nicht, den Prinzregenten Luitpold wegen ſei-
ner Erklärung, daß der Vatikan wiederholt ſeine Zufrieden-
heit mit den kirchlichen Verhältniſſen Bayerns kund gege-
ben habe, in der rückſichtsloſeſten Form anzugreifen, veröf-
V
.
X — XV
—2.‚
enzmen, daß ſie in einer öffentlichen Erklärung bekannt ge-
geſponnen, auch die ultramontanen Intriguen nicht, als
daß es nicht an die Sonne kommen ſollte. Der Moniteur
de Rome, das dem Vatikan naheſtehende Organ, hat jetzt
nämlich bekannt gegeben, daß die Mittheilungen, nach wel-
chen das Handſchreiben des Prinzregenten Luitpold auf den
Papſt keinen guten Eindruck gemacht haben ſolle, durchaus
nicht den Thatſachen entſprechen. Dadurch wird die Ge-
pflogenheit der ultramontanen Blätter, ſich römiſche Nach-
richten je nach Bedürfniß zu fabriciren, wiederum beſtätigt.
Die Situation, in welcher ſich die betreffenden ultramon-
tanen Blätter nach dieſem verunglückten Coup befinden, iſt
wahrhaft kläglich.
In Frankreich wird das Verhältniß zwiſchen Repu-
blikanern und Monarchiſten immer ſchroffer. Der ſeines
militäriſchen Grades entſetzte Herzog v. Aumale ſchrieb
dem Präſidenten der Republik einen reſpektwidrigen Brief
und wurde deswegen des Landes verwieſen. Im Volke,
auch ſelbſt im monarchiſtiſchen Lager, hat die Ausweiſung
wenig Theilnahme geweckt, deſto mehr Aufregung hat ſie
aber in dem Senat verurſacht, wo über dieſelbe in Folge einer
Interpellation diskutirt wurde. Zwiſchen dem Kriegsmini-
ſter Boulanger und dem Senator Lareinty kam es dabei
zu ſcharfen Auseinanderſetzungen und Beleidigungen, deren
Folge ein Piſtolenduell ſein wird. Frankreich, richtiger
Paris, feierte in dieſer Woche auch ſein großes National-
feſt, den Jahrestag der Erſtürmung der Baſtille. Den
Glanzpunkt der Pariſer Feſtlichkeiten bildete die auf dem
Longchamps abgehaltene große Truppenparade, wobei Bou-
langer Gelegenheit hatte, ſeine Perſönlichkeit feiern zu laſſen.
Trotzdem die in den letzten Tagen vorgenommenen
engliſchen Wahlen auf ganz überraſchende Weiſe den
von den Conſervativen gleich zu Anfang errungenen
Vorſprung ſo vergrößert haben, daß höchſt wahrſcheinlich
ſogar die bisher als die höchſte Ziffer der conſervativen
Mandate angenommene Zahl 320 noch überſchritten wird,
hält Gladſtone an der Anſicht feſt, daß ſeine Sache
nicht verloren ſei. „Wir haben“, ſchreibt er an einen
ſeiner durchgefallenen Freunde, „Schottland, Wales, Ir-
land, Vorkſhire und, wie ich hoffe, auch den Norden. Wir
haben mit uns die civiliſirte Welt. Von dieſem Augen-
blicke an iſt es wahrſcheinlich, daß unſere Sache ſichtbar
ſteigen wird; ihr endlicher Triumph iſt gewiß.“ Für die
Größe dieſer Verblendung bietet die Thatſache den Maß-
ſtab, daß faſt fünf Sechstel von London, deſſen Bevölke-
rung die von ganz Schottland an Zahl übertrifft und
welches das Hirn und das Herz des Vereinigten König-
reichs bildet, ſich gegen Gladſtone ausgeſprochen hat. Etwa
zwei Drittel des eigentlichen England (Wales, Schottland
und Irland ausgeſchloſſen) haben das Gleiche gethan, und
noch ſteigt die Fluth der Unionsbewegung gegen Glad-
ſlones iriſche Politik. Daß Gladſtone übrigens ſeinen ver-
meintlichen „Triumph“ zunächſt mit ſeiner Miniſterpräſident-
ſchaft bezahlen muß, ſteht jetzt feſt. Selbſt die Daily
News erklärt: „Die Conſervativen ſind jetzt über 300
Mann ſtark, und der Rücktritt der Regierung kann nur
eine Frage der Zeit ſein. Es beſteht, wir brauchen es
kaum zu ſagen, keine Abſicht, die amtliche Eriſtenz des
Miniſteriums bis Februar oder ſelbſt bis October zu ver-
längern. Die Idee, den Premier durch ein Vertrauens-
Im Orient iſt alles ruhig. Die Türkei ſchickt ihre
Landwehren und Reſerven nach Hauſe, Montenegro kehrt
ſeine ſanftmüthige Seite heraus, Serbien und Bulgarien
bringen momentan ihre parlamentariſchen Angelegenheiten in
Ordnung, — nur die Engländer ärgern ſich wegen Ba-
tums, und doch bleibt ihnen nichts übrig, als ihren Groll
zu berbeißen, da ſie nicht daran denken können, gegen Ruß-
land einen anderen Feldzug als höchſtens nur einen pa-
pierenen zu unternehmen. Und das Papier iſt bekanntlich
wohl geduldig, aber vollzogenen Thatſachen gegenüber un-
gefährlich.
Deutſches Reich.
* Heidelberg, 17. Juli. Wir bringen nachſtehend den
von der Karlsr. Ztg. veröffentlichten Wortlaut eines von Seiner
Königlichen Hoheit dem Großherzog an Seine Majeſtät
den Deutſchen Kaiſer aus Anlaß der bevorſtehenden
Jubelfeier des fünfhundertjährigen Beſtehens der Uni-
verſität Heidelberg gerichteten Schreibens und der darauf
von Seiner Majeſtät ergangenen Antwort. Das Schreiben
Sr. Kgl. Hoh. des Großherzogs lautet:
„Durchlauchtigſter, Großmächtigſter Kaiſer und König, Hoch-
geehrteſter Herr Vetter, Bruder und Schwiegervater!
Die Univerſität Heidelberg gedenkt in der erſten Auguſt-
woche des laufenden Jahres die Jubelfeier ihres fünf-
hundertjährigen Beſtehens in feſtlicher Weiſe zu begehen.
Es iſt das erſte fünfhundertjährige Jubelfeſt einer deutſchen
Hochſchule, einer Hochſchule, welche ſich ſtets auch der hohen?
Aufgabe bewußt war, eine Pflanzſtätte deutſchen Geiſtes,
eine Pflegerin des Gefühles geiſtiger Zuſammengehörigkeit
in den deutſchen Stämmen, ein Hort der Einheit deutſchen
Weſens in gemeinſamer Förderung deutſcher Wiſſenſchaft zu
ſein. So iſt es gewiß nur natürlich, daß die Blicke der
zur Jubelfeier bereiten Carola⸗Ruperta Euerer Kaiſerlichen
und Königlichen Majeſtät ſich zuwenden, daß ſie mit allen
Theilnehmern am Feſte freudigſt dem Gedanken ſich hin-
geben möchte, mit Allerhöchſtdenſelben in der Feier ihres
halbtauſendjährigen Beſtandes ſich vereinigt zu fühlen und
dem erhabenen Begründer des Deutſchen Reiches, dem mäch-
tigen Schirmherrn deutſcher Wiſſenſchaft, ihre ehrfurchtsvolle
Huldigung darzubringen. Wenn ich als Rektor der alt-
ehrwürdigen Hochſchule auch nicht wagen kann, Euerer
Kaiſerlichen und Königlichen Majeſtät eine Einladung zur
Allerhöchſteigenen Gegenwart bei der Jubelfeier zu unter-
breiten, ſo möge es mir doch geſtattet ſein, Allerhöchſtem
Ermeſſen zu unterſtellen, ob Euere Majeſtät nicht geruhen
wollen, durch Entſendung eines Vertreters bei dem bevor-
ſtehenden Feſte Allerhöchſtſich zu betheiligen und damit dem-
ſelben die ſchönſte Weihe zu verleihen. Eine gütige Auf-
nahme dieſer Anregung wird mich mit beſonders freudiger
und dankbarer Stimmung erfüllen. Mit Vergnügen ergreife
ich den Anlaß zur Verſicherung der höchſten Verehrung,
womit ich unwandelbar zu ſein die Ehre habe
Eurer Kaiſerlichen und Königlichen Majeſtät
gehorſamwilligſter Vetter,
Bruder und Schwiegerſohn
ez.) Friedrich.
Schlonß Baden, den 23. Jun 1886. 0
An Seine Majeſtät Wilhelm I., Deutſchen Kaiſer und König
von Preußen.“
—
Verlorene Ehre.
Roman von W. Höffer.
(Fortſetzung.)
88)
———
Der Brief lautete:
„. „Als Sie mir zum erſten Male entgegentraten, mein
+lieber, unvergeßlicher Freund, damals als noch auf meinen
lugen ein Schleier lag, da ſprach ſchon Ihre Stimme
rröſtend und beruhigend zu meinem Herzen; ich gewann Sie
lieb und lieber, ich wurde Ihnen verpflichtet, wie nie zu-
vor einem anderen Menſchen. Das Alles iſt keiner Zeit,
teinem Wechſel unterworfen — das Alles wird nur ſter-
en, wenn ſich über meinem Daſein das Grab geſchloſſen
bat — aber nein, auch dann nicht — es wird ſchöner,
keier mit mir auferſtehen und in Ewigkeit fortleben —
Dennoch, trotz dieſer innigen, herzlichen Zuneigung, trotz
aller meiner Dankbarkeit und Treue müſſen wir heute ſchei-
den ohne ein Wort des Abſchiedes, ohne jenes letzte Lebe-
wohl, das uns Beiden nur Schmerz bereiten würde. Es
4 iſt beſſer ſo, es iſt der gebotene, richtige Weg, und auf
eſem allein erringen wir den Frieden des Lebens. Grüßen
Sie von mir Ihre Frau, lieber Doctor, ſagen Sie ihr, daß
ö ich für ihr Glück bete, und laſſen Sie dieſelbe dieſen Brief
leſen. Gott ſchenke Ihnen jene Krone des Erfolges und
1 der Zufriedenheit, die nur wenigen Auserwählten zu Theil
wird. Ihre Anna Herbſt.“
Er ſaß regungslos, wie im halben Traum, ohne von
den ſchmerzdurchbebten Zeilen ſeine Blicke wieder losreißen
zu können. Kein Wort verrieth, wohin die Verlorene ſich
ewendet, aber eben dieſes Schweigen bekundete genugſam
ie Abſicht — ſein Zartgefühl mußte ihm verbieten, ihr
nachzuforſchen. Er wußte jetzt auch, daß Eliſabeth hier
geweſen war, er wußte, was zwiſchen den beiden Frauen
geſprochen wurde, und daß Anna ein bindendes Ver-
ſprechen gegeben hatte. Großes, ſchönes Herz! So ſelbſt-
los zugleich und ſo innig! Wie tief erſchütterte ihn der
Abſchied von ihr!
Die Gärtnersfrau blieb unſichtbar; er würde auch ſonſt
an ihr vorübergegangen ſein, ohne ſie bemerkt zu haben. Dieſer
Schlag traf ſchwerer als alle vorigen, er betäubte faſt.
Der Gedanke, das junge Mädchen nie wiederſehen zu
können, ſchien plötzlich Zweck und Ziel des Lebens in nebel-
hafte Ferne entrückt zu haben. Es war ihm, ſeit er ſie
nicht mehr in dieſem Hauſe wußte, plötzlich alles Andere
ſo werthlos, ſo gleichgültig geworden.
Mechaniſch durchſchritt er den Vorgarten. Es mußte
irgend Etwas geſchehen, um das verlorene Gleichgewicht
wieder herzuſtellen, um dieſe entſetzliche, tödtende Oede zu
bannen — aber was?
An ſeine Kranken konnte er heute nicht denken, zum
erſten Male beherrſchte ihn eine Macht, die ihn zwingend
immer wieder in ihre eng begrenzten Kreiſe zurückführte.
Er fühlte eine Art Verlangen, gewaltſam die unerträg-
lichen Feſſeln zu ſprengen und auf und davon zu gehen,
gleichviel wohin.
In ſolcher Stimmung erwartet meiſtens den Menſchen ein
neuer, ungeahnter Schickſalsſchlag — vielleicht als Wohlthat
der Vorſehung, um von dem überreizten Gehirn den Wahn-
ſinn fernzuhalten.
Als Julius nach Hauſe kam, empfing ihn die Botſchaft
von dem Tode ſeiner Tante; er mußte der Welt wegen
jetzt hingehen und ſeiner kranken Mutter zur Seite ſtehen,
er mußte die Praxis für einige Tage einem Anderen über-
tragen und hatte mit rein Aeußerlichem ſo viel zu thun,
daß ihm für ſelbſtquäleriſche Grübeleien keine Zeit blieb.
Als Fräulein Haberland beerdigt wurde, fehlte im Fa-
milienzimmer ſeine junge Frau, wie ſie ſchon immer, ſo oft
er kam, gefehlt hatte. Eliſabeth liebte ihn viel zu innig,
um durch ihr Erſcheinen die Wunde mit rauher Hand zu
berühren; ſie pflegte wieder wie früher die kranke Frau
und dachte an ihn wie an ein unerreichbar ſeliges Glück,
faſt wie an einen Todten, der ihr auf Erden nicht mehr
begegnen würde, aber ſie verſuchte nie, ſich ihm in einer
oder der anderen Form zu nähern. Als Julius das Zim-
mer der Verſtorbenen betrat, fand er auch alle jene Ge-
ſchenke, welche ſie der vermeintlichen Tochter ihres Jugend-
geliebten früher gemacht, unter ihren Sachen wieder vor.
Eliſabeth hatte kein Stück behalten, auch nicht einmal die
geſtohlenen Documente — ſie lagen zwiſchen ſeinen Papieren
auf dem Schreibtiſch.
Aber dieſe ſtumme Demuth rührte ihn nicht; was er
empfand, war der Stachel des Schimpfes, namentlich am
Beerdigungstage, als ihn die zahlreich erſchienenen Freunde
des Hauſes immer wieder mit neugierigem Erſtaunen frag-
ten, wo ſie ſich befinde. Mehr als einer derſelben ahnte
das tiefe Zerwürfniß, mehr als einem waren bereits ſelt-
ſame Gerüchte zugetragen — wo ihrer zwei mit einander
flüſterten, da wandte er erſchreckt den Blick. Sie ſprachen
ja vielleicht ſchon, daß es die berüchtigte Emilie Bredow
war, welche er geheirathet hatte, oder daß gar ſich die
Polizei hineinmiſchen werde. Er dankte dem Himmel, daß
ſein finſterer, wenig ermuthigender Blick die Meiſten ver-
hinderte, ihn überhaupt zu fragen. ö
IEunr 5 v ö
Aalich Sonntags ö 9 153 für die Iſpal-
1 ansgenommen. — — 4. — Ruan Ranm.
—— ö en Raum.
A ae Für hiel. Geſchäftn
4 ſrit Familien⸗ n. Privatanzeigen
ö ane vꝛertel- bedeut. ermäßigr;
AUhr A. 60 4
4 deſchl. Poſtauf⸗ * Sratis-Anfusbu
ag u. Träger⸗ der Inſerate in den
9 „Lohn. „— — „* „ Plaeat⸗Anztiger
41S— Dagblalt und Verkündiger für die Stadt Heidelberg.⸗ . ——
H — —
U *
Tr. 165. Samstag, den 17. Zuli 1886
I —
½ 144 x „ fentlichten auch Depeſchen aus Rom, wonach der Papſt] votum zu halten, wird von dem miniſteriellen Blatt
Politiſche Wochenſchau den Pentrehenten desavouitte Es iſt aber nichts ſo fein abgelehnt. arte
Heidelberg, 17. Juli 1886.
10 Kaiſer Wil helm hat in Koblenz nur kurze Zeit ver-
weilt und iſt von dort ſchon am Dienstag Abend wie-
der aufgebrochen und nach der Inſel Mainau gereiſt, wo-
ſelbſt derſelbe die Woche über bei den Großherzoglichen
Herrſchaften geweilt hat. Das Befinden des hohen
Herrn läßt andauernd nichts zu wünſchen übrig.
ö Der Reichskanzler empfing in Bad Kiſſingen am
Montag die Beſuche des bayriſchen Miniſterpräſidenten v.
utz und des bahriſchen Staatsminiſters v. Crailsheim.
Eine politiſche Bedeutung dürfte den Beſuchen weiter nicht
4 veizumeſſen ſein. Sie ſind ein Zoll der Höflichkeit, der
u ſem Reichskanzler alljährlich, wenn er in Kiſſingen weilt,
von der bayriſchen Regierung dargebracht wird.
0 Die Reichshauptſtadt iſt augenblicklich von faſt
ei allen amtlichen Perſönlichkeiten in hervorragender Stellung
uf verlaſſen. Auf dem Gebiete der Reichspolitik liegt eben
in zur Zeit nichts Neues von Belang vor, noch ſteht etwas
de dergleichen für abſehbare Zeit in Ausſicht. Die ſog. „todte
ein Jahreszeit“ macht ihrem Namen mehr Ehre als je.
4„Einen vielberſprechenden Sieg hat die nationale Sache
rohm den Reichslanden bei den daſelbſt vollzogenen Ge-
er meinderathswahlen errungen. Durchgehends, und beſonders
erfreulich iſt dies von Straßburg und Metz, hat das
en Deutſchthum ein unerwartetes Erſtarken gezeigt. Die Pro-
d teſtler haben eine überwältigende Niederlage erlitten. Be-
ſonders eklatant war der Mißerfolg der Metzer Proteſt-
mler, und dieſelben haben ſich das derart zu Herzen genom-
SSESSEE
geben haben, für die bevorſtehenden Nachwahlen keinen
Candidaten mehr aufzuſtellen. Die Proteſtpartei wäre ſo-
t im Metzer Gemeinderath ein überwundener Stand-
dpunkt. Dieſen ſchönen Erfolg dankt das Deutſchthum vor
Allem der feſten zielbewußten nationalen Politik der Re-
gierung und des unter ſolchen Auſpicien in den reichslän-
diſchen Provinzen unabläſſig betriebenen Werkes allmäliger
Verſchmelzung der Eingeborenen mit den eingewanderten
evölkerungselementen. Noch bleibt ja Vieles, wenn nicht
das Meiſte zu thun übrig, aber ein über Erwarten hoff-
nungsvoller Anfang iſt gemacht und es iſt nur noch nö-
thig, auf dem betretenen Wege in Haus, Schule und Ka-
X ſerne fortzuſchreiten, um den welſchen Geiſt vollends vom
22 deutſchen Boden zu verſcheuchen. Erwähnt ſei noch, daß
n Frankreich der Ausfall der elſaß⸗lothringiſchen Gemein-
derathswahlen natürlich arg verſchnupft hat. Die meiſten
er Pariſer Blätter ſuchten die Niederlage der Proteſtpartei
dadurch zu verheimlichen, daß ſie die Wahltelegramme an
chwer auffindbarer Stelle veröffentlichten oder als ganz
unwichtig behandelten. Die „Grande Nation“ wiegt ſich
nun einmal zu gern in Illuſionen, bis ſie durch ein ſchreck-
liches Erwachen auf den Boden der Thatſachen ge-
tellt wird.
Ueber die ultramontane Hetzpreſſe, zunächſt Bayerns,
ſind die Tage hereingebrochen, „von denen wir ſagen, ſie
gefallen uns nicht.“ Dieſe Preßpaukanten entblödeten ſich
bekanntlich nicht, den Prinzregenten Luitpold wegen ſei-
ner Erklärung, daß der Vatikan wiederholt ſeine Zufrieden-
heit mit den kirchlichen Verhältniſſen Bayerns kund gege-
ben habe, in der rückſichtsloſeſten Form anzugreifen, veröf-
V
.
X — XV
—2.‚
enzmen, daß ſie in einer öffentlichen Erklärung bekannt ge-
geſponnen, auch die ultramontanen Intriguen nicht, als
daß es nicht an die Sonne kommen ſollte. Der Moniteur
de Rome, das dem Vatikan naheſtehende Organ, hat jetzt
nämlich bekannt gegeben, daß die Mittheilungen, nach wel-
chen das Handſchreiben des Prinzregenten Luitpold auf den
Papſt keinen guten Eindruck gemacht haben ſolle, durchaus
nicht den Thatſachen entſprechen. Dadurch wird die Ge-
pflogenheit der ultramontanen Blätter, ſich römiſche Nach-
richten je nach Bedürfniß zu fabriciren, wiederum beſtätigt.
Die Situation, in welcher ſich die betreffenden ultramon-
tanen Blätter nach dieſem verunglückten Coup befinden, iſt
wahrhaft kläglich.
In Frankreich wird das Verhältniß zwiſchen Repu-
blikanern und Monarchiſten immer ſchroffer. Der ſeines
militäriſchen Grades entſetzte Herzog v. Aumale ſchrieb
dem Präſidenten der Republik einen reſpektwidrigen Brief
und wurde deswegen des Landes verwieſen. Im Volke,
auch ſelbſt im monarchiſtiſchen Lager, hat die Ausweiſung
wenig Theilnahme geweckt, deſto mehr Aufregung hat ſie
aber in dem Senat verurſacht, wo über dieſelbe in Folge einer
Interpellation diskutirt wurde. Zwiſchen dem Kriegsmini-
ſter Boulanger und dem Senator Lareinty kam es dabei
zu ſcharfen Auseinanderſetzungen und Beleidigungen, deren
Folge ein Piſtolenduell ſein wird. Frankreich, richtiger
Paris, feierte in dieſer Woche auch ſein großes National-
feſt, den Jahrestag der Erſtürmung der Baſtille. Den
Glanzpunkt der Pariſer Feſtlichkeiten bildete die auf dem
Longchamps abgehaltene große Truppenparade, wobei Bou-
langer Gelegenheit hatte, ſeine Perſönlichkeit feiern zu laſſen.
Trotzdem die in den letzten Tagen vorgenommenen
engliſchen Wahlen auf ganz überraſchende Weiſe den
von den Conſervativen gleich zu Anfang errungenen
Vorſprung ſo vergrößert haben, daß höchſt wahrſcheinlich
ſogar die bisher als die höchſte Ziffer der conſervativen
Mandate angenommene Zahl 320 noch überſchritten wird,
hält Gladſtone an der Anſicht feſt, daß ſeine Sache
nicht verloren ſei. „Wir haben“, ſchreibt er an einen
ſeiner durchgefallenen Freunde, „Schottland, Wales, Ir-
land, Vorkſhire und, wie ich hoffe, auch den Norden. Wir
haben mit uns die civiliſirte Welt. Von dieſem Augen-
blicke an iſt es wahrſcheinlich, daß unſere Sache ſichtbar
ſteigen wird; ihr endlicher Triumph iſt gewiß.“ Für die
Größe dieſer Verblendung bietet die Thatſache den Maß-
ſtab, daß faſt fünf Sechstel von London, deſſen Bevölke-
rung die von ganz Schottland an Zahl übertrifft und
welches das Hirn und das Herz des Vereinigten König-
reichs bildet, ſich gegen Gladſtone ausgeſprochen hat. Etwa
zwei Drittel des eigentlichen England (Wales, Schottland
und Irland ausgeſchloſſen) haben das Gleiche gethan, und
noch ſteigt die Fluth der Unionsbewegung gegen Glad-
ſlones iriſche Politik. Daß Gladſtone übrigens ſeinen ver-
meintlichen „Triumph“ zunächſt mit ſeiner Miniſterpräſident-
ſchaft bezahlen muß, ſteht jetzt feſt. Selbſt die Daily
News erklärt: „Die Conſervativen ſind jetzt über 300
Mann ſtark, und der Rücktritt der Regierung kann nur
eine Frage der Zeit ſein. Es beſteht, wir brauchen es
kaum zu ſagen, keine Abſicht, die amtliche Eriſtenz des
Miniſteriums bis Februar oder ſelbſt bis October zu ver-
längern. Die Idee, den Premier durch ein Vertrauens-
Im Orient iſt alles ruhig. Die Türkei ſchickt ihre
Landwehren und Reſerven nach Hauſe, Montenegro kehrt
ſeine ſanftmüthige Seite heraus, Serbien und Bulgarien
bringen momentan ihre parlamentariſchen Angelegenheiten in
Ordnung, — nur die Engländer ärgern ſich wegen Ba-
tums, und doch bleibt ihnen nichts übrig, als ihren Groll
zu berbeißen, da ſie nicht daran denken können, gegen Ruß-
land einen anderen Feldzug als höchſtens nur einen pa-
pierenen zu unternehmen. Und das Papier iſt bekanntlich
wohl geduldig, aber vollzogenen Thatſachen gegenüber un-
gefährlich.
Deutſches Reich.
* Heidelberg, 17. Juli. Wir bringen nachſtehend den
von der Karlsr. Ztg. veröffentlichten Wortlaut eines von Seiner
Königlichen Hoheit dem Großherzog an Seine Majeſtät
den Deutſchen Kaiſer aus Anlaß der bevorſtehenden
Jubelfeier des fünfhundertjährigen Beſtehens der Uni-
verſität Heidelberg gerichteten Schreibens und der darauf
von Seiner Majeſtät ergangenen Antwort. Das Schreiben
Sr. Kgl. Hoh. des Großherzogs lautet:
„Durchlauchtigſter, Großmächtigſter Kaiſer und König, Hoch-
geehrteſter Herr Vetter, Bruder und Schwiegervater!
Die Univerſität Heidelberg gedenkt in der erſten Auguſt-
woche des laufenden Jahres die Jubelfeier ihres fünf-
hundertjährigen Beſtehens in feſtlicher Weiſe zu begehen.
Es iſt das erſte fünfhundertjährige Jubelfeſt einer deutſchen
Hochſchule, einer Hochſchule, welche ſich ſtets auch der hohen?
Aufgabe bewußt war, eine Pflanzſtätte deutſchen Geiſtes,
eine Pflegerin des Gefühles geiſtiger Zuſammengehörigkeit
in den deutſchen Stämmen, ein Hort der Einheit deutſchen
Weſens in gemeinſamer Förderung deutſcher Wiſſenſchaft zu
ſein. So iſt es gewiß nur natürlich, daß die Blicke der
zur Jubelfeier bereiten Carola⸗Ruperta Euerer Kaiſerlichen
und Königlichen Majeſtät ſich zuwenden, daß ſie mit allen
Theilnehmern am Feſte freudigſt dem Gedanken ſich hin-
geben möchte, mit Allerhöchſtdenſelben in der Feier ihres
halbtauſendjährigen Beſtandes ſich vereinigt zu fühlen und
dem erhabenen Begründer des Deutſchen Reiches, dem mäch-
tigen Schirmherrn deutſcher Wiſſenſchaft, ihre ehrfurchtsvolle
Huldigung darzubringen. Wenn ich als Rektor der alt-
ehrwürdigen Hochſchule auch nicht wagen kann, Euerer
Kaiſerlichen und Königlichen Majeſtät eine Einladung zur
Allerhöchſteigenen Gegenwart bei der Jubelfeier zu unter-
breiten, ſo möge es mir doch geſtattet ſein, Allerhöchſtem
Ermeſſen zu unterſtellen, ob Euere Majeſtät nicht geruhen
wollen, durch Entſendung eines Vertreters bei dem bevor-
ſtehenden Feſte Allerhöchſtſich zu betheiligen und damit dem-
ſelben die ſchönſte Weihe zu verleihen. Eine gütige Auf-
nahme dieſer Anregung wird mich mit beſonders freudiger
und dankbarer Stimmung erfüllen. Mit Vergnügen ergreife
ich den Anlaß zur Verſicherung der höchſten Verehrung,
womit ich unwandelbar zu ſein die Ehre habe
Eurer Kaiſerlichen und Königlichen Majeſtät
gehorſamwilligſter Vetter,
Bruder und Schwiegerſohn
ez.) Friedrich.
Schlonß Baden, den 23. Jun 1886. 0
An Seine Majeſtät Wilhelm I., Deutſchen Kaiſer und König
von Preußen.“
—
Verlorene Ehre.
Roman von W. Höffer.
(Fortſetzung.)
88)
———
Der Brief lautete:
„. „Als Sie mir zum erſten Male entgegentraten, mein
+lieber, unvergeßlicher Freund, damals als noch auf meinen
lugen ein Schleier lag, da ſprach ſchon Ihre Stimme
rröſtend und beruhigend zu meinem Herzen; ich gewann Sie
lieb und lieber, ich wurde Ihnen verpflichtet, wie nie zu-
vor einem anderen Menſchen. Das Alles iſt keiner Zeit,
teinem Wechſel unterworfen — das Alles wird nur ſter-
en, wenn ſich über meinem Daſein das Grab geſchloſſen
bat — aber nein, auch dann nicht — es wird ſchöner,
keier mit mir auferſtehen und in Ewigkeit fortleben —
Dennoch, trotz dieſer innigen, herzlichen Zuneigung, trotz
aller meiner Dankbarkeit und Treue müſſen wir heute ſchei-
den ohne ein Wort des Abſchiedes, ohne jenes letzte Lebe-
wohl, das uns Beiden nur Schmerz bereiten würde. Es
4 iſt beſſer ſo, es iſt der gebotene, richtige Weg, und auf
eſem allein erringen wir den Frieden des Lebens. Grüßen
Sie von mir Ihre Frau, lieber Doctor, ſagen Sie ihr, daß
ö ich für ihr Glück bete, und laſſen Sie dieſelbe dieſen Brief
leſen. Gott ſchenke Ihnen jene Krone des Erfolges und
1 der Zufriedenheit, die nur wenigen Auserwählten zu Theil
wird. Ihre Anna Herbſt.“
Er ſaß regungslos, wie im halben Traum, ohne von
den ſchmerzdurchbebten Zeilen ſeine Blicke wieder losreißen
zu können. Kein Wort verrieth, wohin die Verlorene ſich
ewendet, aber eben dieſes Schweigen bekundete genugſam
ie Abſicht — ſein Zartgefühl mußte ihm verbieten, ihr
nachzuforſchen. Er wußte jetzt auch, daß Eliſabeth hier
geweſen war, er wußte, was zwiſchen den beiden Frauen
geſprochen wurde, und daß Anna ein bindendes Ver-
ſprechen gegeben hatte. Großes, ſchönes Herz! So ſelbſt-
los zugleich und ſo innig! Wie tief erſchütterte ihn der
Abſchied von ihr!
Die Gärtnersfrau blieb unſichtbar; er würde auch ſonſt
an ihr vorübergegangen ſein, ohne ſie bemerkt zu haben. Dieſer
Schlag traf ſchwerer als alle vorigen, er betäubte faſt.
Der Gedanke, das junge Mädchen nie wiederſehen zu
können, ſchien plötzlich Zweck und Ziel des Lebens in nebel-
hafte Ferne entrückt zu haben. Es war ihm, ſeit er ſie
nicht mehr in dieſem Hauſe wußte, plötzlich alles Andere
ſo werthlos, ſo gleichgültig geworden.
Mechaniſch durchſchritt er den Vorgarten. Es mußte
irgend Etwas geſchehen, um das verlorene Gleichgewicht
wieder herzuſtellen, um dieſe entſetzliche, tödtende Oede zu
bannen — aber was?
An ſeine Kranken konnte er heute nicht denken, zum
erſten Male beherrſchte ihn eine Macht, die ihn zwingend
immer wieder in ihre eng begrenzten Kreiſe zurückführte.
Er fühlte eine Art Verlangen, gewaltſam die unerträg-
lichen Feſſeln zu ſprengen und auf und davon zu gehen,
gleichviel wohin.
In ſolcher Stimmung erwartet meiſtens den Menſchen ein
neuer, ungeahnter Schickſalsſchlag — vielleicht als Wohlthat
der Vorſehung, um von dem überreizten Gehirn den Wahn-
ſinn fernzuhalten.
Als Julius nach Hauſe kam, empfing ihn die Botſchaft
von dem Tode ſeiner Tante; er mußte der Welt wegen
jetzt hingehen und ſeiner kranken Mutter zur Seite ſtehen,
er mußte die Praxis für einige Tage einem Anderen über-
tragen und hatte mit rein Aeußerlichem ſo viel zu thun,
daß ihm für ſelbſtquäleriſche Grübeleien keine Zeit blieb.
Als Fräulein Haberland beerdigt wurde, fehlte im Fa-
milienzimmer ſeine junge Frau, wie ſie ſchon immer, ſo oft
er kam, gefehlt hatte. Eliſabeth liebte ihn viel zu innig,
um durch ihr Erſcheinen die Wunde mit rauher Hand zu
berühren; ſie pflegte wieder wie früher die kranke Frau
und dachte an ihn wie an ein unerreichbar ſeliges Glück,
faſt wie an einen Todten, der ihr auf Erden nicht mehr
begegnen würde, aber ſie verſuchte nie, ſich ihm in einer
oder der anderen Form zu nähern. Als Julius das Zim-
mer der Verſtorbenen betrat, fand er auch alle jene Ge-
ſchenke, welche ſie der vermeintlichen Tochter ihres Jugend-
geliebten früher gemacht, unter ihren Sachen wieder vor.
Eliſabeth hatte kein Stück behalten, auch nicht einmal die
geſtohlenen Documente — ſie lagen zwiſchen ſeinen Papieren
auf dem Schreibtiſch.
Aber dieſe ſtumme Demuth rührte ihn nicht; was er
empfand, war der Stachel des Schimpfes, namentlich am
Beerdigungstage, als ihn die zahlreich erſchienenen Freunde
des Hauſes immer wieder mit neugierigem Erſtaunen frag-
ten, wo ſie ſich befinde. Mehr als einer derſelben ahnte
das tiefe Zerwürfniß, mehr als einem waren bereits ſelt-
ſame Gerüchte zugetragen — wo ihrer zwei mit einander
flüſterten, da wandte er erſchreckt den Blick. Sie ſprachen
ja vielleicht ſchon, daß es die berüchtigte Emilie Bredow
war, welche er geheirathet hatte, oder daß gar ſich die
Polizei hineinmiſchen werde. Er dankte dem Himmel, daß
ſein finſterer, wenig ermuthigender Blick die Meiſten ver-
hinderte, ihn überhaupt zu fragen. ö