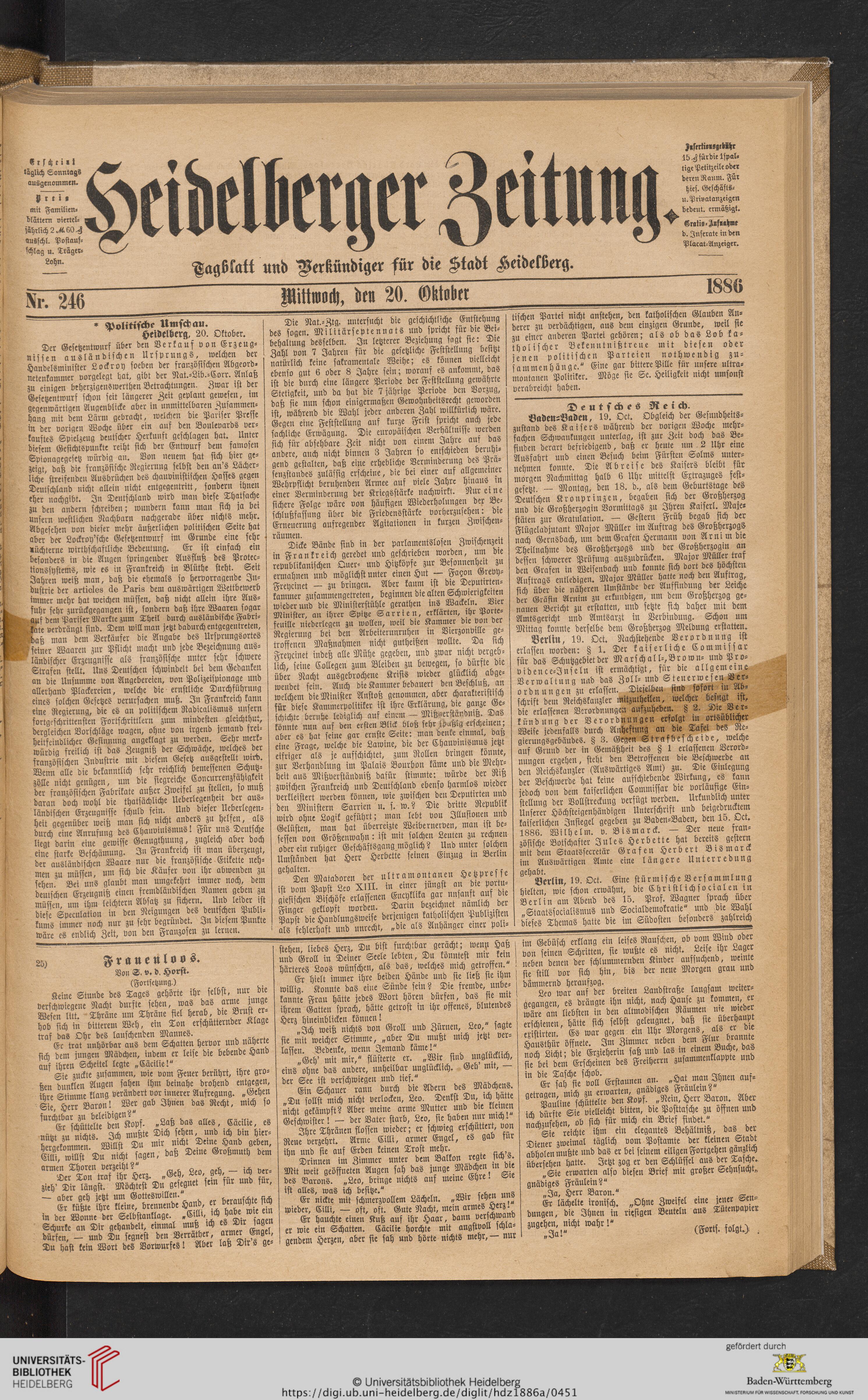zu einigen beherzigenswerthen Betrachtungen.
Arlceint
Aäglich Sonntags
ausgenommen.
Prri
mit Familien-
blättern viertel-
Fhrlich 24.60.4
Ausſchl. Poſtauf-
ſchlag u. Träger-
Lohn.
Heidelberger
Dagblatt und Verkündiger für die Stadt Heidelberg.
citung
Inſertieusgebihr
15.6fürdie 1ſpal-
tige Petitzeile oder
deren Ranm. Für
hieſ. Geſchäfts-
u. Privatanzeigen
bedeut. ermäßigt.
Gralis⸗Aufnahme
d. Inſerate in den
Placat⸗Anzeiger.
Tr. 246
Mittwoch, den 20. Oktober
1886
——
Politiſche Umſchau.
Heidelberg, 20. Oktober.
Der Geſetzentwurf über den Verkauf von Erzeug-
niſſen ausländiſchen Urſprungs, welchen der
Handelsminiſter Lockroy ſoeben der franzöſiſchen Abgeord-
netenkammer vorgelegt hat, gibt der Nat.⸗Lib.⸗Corr. Anlaß
Zwar iſt der
Geſetzentwurf ſchon ſeit längerer Zeit geplant geweſen, im
gegenwärtigen Augenblicke aber in unmittelbaren Zuſammen-
hang mit dem Lärm gebracht, welchen die Pariſer Preſſe
der vorigen Woche über ein auf den Boulevards ver-
kauftes Spielzeug deutſcher Herkunft geſchlagen hat. Unter
dieſem Geſichtspunkte reiht ſich der Entwurf dem famoſen
„Sbpionagegeſetz würdig an. Von neuem hat ſich hier ge-
zeigt, daß die franzöſiſche Regierung ſelbſt den an's Lächer-
liche ſtreifenden Ausbrüchen des chauviniſtiſchen Haſſes gegen
Deutſchland nicht allein nicht entgegentritt, ſondern ihnen
eher nachgibt. In Deutſchland wird man dieſe Thatſache
zu den andern ſchreiben; wundern kann man ſich ja bei
unſern weſtlichen Nachbarn nachgerade über nichts mehr.
Abgeſehen von dieſer mehr äußerlichen politiſchen Seite hat
aber der Lockroy'ſche Geſetzentwurf im Grunde eine ſehr
nüchterne wirthſchaftliche Bedeutung. Er iſt einfach ein
beſonders in die Augen ſpringender Ausfluß des Protec-
tionsſyſtems, wie es in Frankreich in Blüthe ſteht. Seit
Jahren weiß man, daß die ehemals ſo hervorragende In-
duſtrie der articles de Paris dem auswärtigen Wettbewerb
immer mehr hat weichen müſſen, daß nicht allein ihre Aus-
fuhr ſehr zurückgegangen iſt, ſondern daß ihre Waaren ſogar
f dem Pariſer Markte zum Theil durch ausländiſche Fahri-
te verdrängt ſind. Dem will man jetzt dadurch entgegentreten,
aß man dem Verkäufer die Angabe des Urſprungsortes
ſeiner Waaren zur Pflicht macht und jede Bezeichnung aus-
ländiſcher Erzeugniſſe als franzöſiſche unter ſehr ſchwere
Strafen ſtellt. Uns Deutſchen ſchwindelt bei dem Gedanken
an die Unſumme von Angebereien, von Polizeiſpionage und
aͤllerhand Plackereien, welche die ernſtliche Durchführung
eines ſolchen Geſetzes verurſachen muß. In Frankreich kann
eine Regierung, die es an politiſchem Radicalismus unſern
fortgeſchrittenſten Fortſchrittlern zum mindeſten gleichthut,
dergleichen Vorſchläge wagen, ohne von irgend jemand frei-
heitfeindlicher Geſinnung angeklagt zu werden. Sehr merk-
würdig freilich iſt das Zeugniß der Schwäche, welches der
franzöſiſchen Induſtrie mit dieſem Geſetz ausgeſtellt wird.
Wenm alle die bekanntlich ſehr reichlich bemeſſenen Schutz-
zölle nicht genügen, um die ſiegreiche Concurrenzfähigkeit
der franzöſiſchen Fabrikate außer Zweifel zu ſtellen, ſo muß
daran doch wohl die thatſächliche Ueberlegenheit der aus-
ländiſchen Erzeugniſſe ſchuld ſein. Und dieſer Ueberlegen-
heit gegenüber weiß man ſich nicht anders zu helfen, als
durch eine Anrufung des Chauvinismus! Für uns Deutſche
liegt darin eine gewiſſe Genugthuung, zugleich aber doch
eine ſtarke Beſchämung. In Frankreich iſt man überzeugt,
der ausländiſchen Waare nur die franzöſiſche Etikette neh-
men zu müſſen, um ſich die Käufer von ihr abwenden zu
ſehen. Bei uns glaubt man umgekehrt immer noch, dem
deutſchen Erzeugniß einen fremdländiſchen Namen geben zu
müſſen, um ihm leichtern Abſatz zu ſichern. Und leider iſt
dieſe Speculation in den Neigungen des deutſchen Publi-
kums immer noch nur zu ſehr begründet. In dieſem Punkte
wäre es endlich Zeit, von den Franzoſen zu lernen.
Die Nat.⸗Zig. unterſucht die geſchichtliche Entſtehung
des ſogen. Militärſeptennats und ſpricht für die Bei-
behaltung desſelben. In letzterer Beziehung ſagt ſie: Die
Zahl von 7 Jahren für die geſetzliche Feſtſtellung beſitzt
natürlich keine ſakramentale Weihe; es können vielleicht
ebenſo gut 6 oder 8 Jahre ſein; worauf es ankommt, das
iſt die durch eine längere Periode der Feſtſtellung gewährte
Stetigkeit, und da hat die 7 jährige Periode den Vorzug,
daß ſie nun ſchon einigermaßen Gewohnheitsrecht geworden
iſt, während die Wahl jeder anderen Zahl willkürlich wäre.
Gegen eine Feſtſtellung auf kurze Friſt ſpricht auch jede
ſachliche Erwägung. Die europäiſchen Verhältniſſe werden
ſich für abſehbare Zeit nicht von einem Jahre auf das
andere, auch nicht binnen 3 Jahren ſo entſchieden beruhi-
gend geſtalten, daß eine erhebliche Verminderung des Prä-
ſenzſtandes zuläſſig erſcheine, die bei einer auf allgemeiner
Wehrpflicht beruhenden Armee auf viele Jahre hinaus in
einer Verminderung der Kriegsſtärke nachwirkt. Nur ei ne
ſichere Folge wäre von häufigen Wiederholungen der Be-
ſchlußfaſſung über die Friedensſtärke vorherzuſehen: die
Erneuerung aufregender Agitationen in kurzen Zwiſchen-
räumen. ö
Dicke Bände ſind in der parlamentsloſen Zwiſchenzeit
in Frankreich geredet und geſchrieben worden, um die
republikaniſchen Quer⸗ und Hitzköpfe zur Beſonnenheit zu
ermahnen und möglichſt unter einen Hut — Fagçon Grevy-
Freycinet — zu bringen. Aber kaum iſt die Deputirten-
kammer zuſammengetreten, beginnen die alten Schwierigkeiten
wieder und die Miniſterſtühle gerathen ins Wackeln. Vier
Miniſter, an ihrer Spitze Sarrien, erklärten, ihr Porte-
feuille niederlegen zu wollen, weil die Kammer die von der
Regierung bei den Arbeiterunruhen in Vierzonville ge-
troffenen Maßnahmen nicht gutheißen wollte. Da ſich
Freycinet indeß alle Mühe gegeben, und zwar nicht vergeb-
lich, ſeine Collegen zum Bleiben zu bewegen, ſo dürfte die
über Nacht ausgebrochene Kriſis wieder glücklich abge-
wendet ſein. Auch die Kammer bedauert den Beſchluß, an
welchem die Miniſter Anſtoß genommen, aber charakteriſtiſch
für dieſe Kammerpolitiker iſt ihre Erklärung, die ganze Ge-
ſchichte beruhe lediglich auf einem — Mißzerſtändniß. Das
könnte nun auf den erſten Blick bloß ſehr bußig erſcheinen;
aber es hat ſeine gar ernſte Seite: man denke einmal, daß
eine Frage, welche die Lawine, die der Chauvinismus jetzt
eifriger als je aufſchichtet, zum Rollen bringen könnte,
zur Verhandlung im Palais Bourbon käme und die Mehr-
heit aus Mißverſtändniß dafür ſtimmte: würde der Riß
zwiſchen Frankreich und Deutſchland ebenſo harmlos wieder
verkleiſtert werden können, wie zwiſchen den Deputirten und
den Miniſtern Sarrien u. ſ. w.? Die dritte Republik
wird ohne Logik geführt; man lebt von Illuſionen und
Gelüſten, man hat überreizte Weibernerven, man iſt be-
ſeſſen von Größenwahn: iſt mit ſolchen Leuten zu rechnen
oder ein ruhiger Geſchäftsgang möglich? Und unter ſolchen
Umſtänden hat Herr Herbette ſeinen Einzug in Berlin
gehalten.
Den Matadoren der ultramontanen Hetzpreſſe
iſt vom Papſt Leo XIII. in einer jüngſt an die portu-
gieſiſchen Biſchöfe erlaſſenen Eneyklika gar nnſanft auf die
Finger geklopft worden. Darin bezeichnet nämlich der
Papſt die Handlungsweiſe derjenigen katholiſchen Publiziſten
als fehlerhaft und unrecht, „die als Anhänger einer poli-
tiſchen Partei nicht anſtehen, den katholiſchen Glauben An-
derer zu verdächtigen, aus dem einzigen Grunde, weil ſie
zu einer anderen Partei gehören; als ob das Lob ka-
tholiſcher Bekenntnißtrene mit dieſen oder
jenen politiſchen Parteien nothwendig zu-
ſammenhänge.“ Eine gar bittere Pille für unſere ultra-
montanen Politiker. Möge ſie Se. Heiligkeit nicht umſonſt
verabreicht haben.
Deutſches Reich.
Baden⸗Baden, 19. Oct. Obgleich der Geſundheits-
zuſtand des Kaiſers während der vorigen Woche mehr-
fachen Schwankungen unterlag, iſt zur Zeit doch das Be-
finden derart befriedigend, daß er heute um 2 Uhr eine
Ausfahrt und einen Beſuch beim Fürſten Solms unter-
nehmen konnte. Die Abreiſe des Kaiſers bleibt für
morgen Nachmittag halb 6 Uhr mittelſt Extrazuges feſt-
geſetzt. — Montag, den 18. d., als dem Geburtstage des
Deutſchen Kronprinzen, begaben ſich der Großherzog
und die Großherzogin Vormittags zu Ihren Kaiſerl. Maje-
ſtäten zur Gratulation. — Geſtern Früh begab ſich der
Flügeladjutant Major Müller im Auftrag des Großherzogs
nach Gernsbach, um dem Grafen Hermann von Arni m die
Theilnahme des Großherzogs und der Großherzogin an
deſſen ſchwerer Prüfung auszudrücken. Major Müller traf
den Grafen in Weiſenbach und konnte ſich dort des höchſten
Auftrags entledigen. Major Müller hatte noch den Auftrag,
ſich über die näheren Umſtände der Auffindung der Leiche
der Gräfin Arnim zu erkundigen, um dem Großherzog ge-
nauen Bericht zu erſtatten, und ſetzte ſich daher mit dem
Amtsgericht und Amtsarzt in Verbindung. Schon um
Mittag konnte derſelbe dem Großherzog Meldung erſtatten.
Berlin, 19. Oct. Nachſtehende Verordnung iſt
erlaſſen worden: § 1. Der kaiſerliche Commiſſar
für das Schutzgebiet der Marſchall⸗, Brown⸗ und Pro-
vidence⸗Inſeln iſt ermächtigt, für die allgemeine.
Verwaltung und das Zoll⸗ und Steuerweſeneer
ordnungen zu erlaſſen. ſid fütt
ſchrift dem Reichskanzler
die erlaſſenen Verordnungen;
kündung der Verord
Weiſe jedenfalls durch An
gierungsgebäudes. § 3. Geß che
auf Grund der in Gemäßheit des § 1 erlaſſenen Verord-
nungen ergehen, ſteht den Betroffenen die Beſchwerde an
den Reichskanzler (Auswärtiges Amt) zu. Die Einlegung
der Beſchwerde hat keine aufſchiebende Wirkung, es kann
jedoch von dem kaiſerlichen Commiſſar die vorläufige Ein-
ſtellung der Vollſtreckung verfügt werden. Urkundlich unter
Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem
kaiſerlichen Inſiegel gegeben zu Baden⸗Baden, den 15. Oct.
1886. Wilhelm. v. Bismarck. — Der neue fran-
zöſiſche Botſchafter Jules Herbette hat bereits geſtern
mit dem Staatsſecretär Grafen Herbert Bis marck
im Auswärtigen Amte eine län gere Unterredung
gehabt.
Berlin, 19. Oct. Eine ſtürmiſche Verſammlung
hielten, wie ſchon erwähnt, die Chriſtlichſocialen in
Berlin am Abend des 15. Prof. Wagner ſprach über
„Staatsſocialismus und Socialdemokratie“ und die Wahl
dieſes Themas hatte die im Südoſten beſonders zahlreich
—
Frauenloos.
Von S. v. d. Horſt.
(Fortſetzung.)
Keine Stunde des Tages gehörte ihr ſelbſt, nur die
verſchwiegene Nacht durfte ſehen, was das arme junge
Weſen litt. Thräne um Thräne fiel herab, die Bruſt er-
hob ſich in bitterem Weh, ein Ton erſchütternder Klage
traf das Ohr des lauſchenden Mannes.
Er trat unhörbar aus dem Schatten hervor und näherte
ſich dem jungen Mädchen, indem er leiſe die bebende Hand
auf ihren Scheitel legte „Cäcilie!“ ö
Sie zuckte zuſammen, wie vom Feuer berührt, ihre gro-
ßen dunklen Augen ſahen ihm beinahe drohend entgegen,
ihre Stimme klang verändert vor innerer Aufregung. „Gehen
Sie, Herr Baron! Wer gab Ihnen das Recht, mich ſo
furchtbar zu beleidigen?“ ö
Er ſchüttelte den Kopf. „Laß das alles, Cäcilie, es
25)
nützt zu nichts. Ich mußte Dich ſehen, und ich bin hier-
nicht Deine Hand geben
ergekommen. Willſt Du mir
Kar daß Deine Großmuth dem
— Cilli, willſt Du nicht ſagen,
armen Thoren verzeiht 2“
Der Ton traf ihr Herz. „Geh, Leo, geh, — ich ver-
zieh' Dir längſt. Möchteſt Du geſegnet ſein für und für,
— aber geh jetzt um Gotteswillen.
Er küßte ihre kleine, brennende Hand, er berauſchte ſich
in der Wonne der Selbſtanklage. „Cilli, ich habe wie ein
Schurke an Dir gehandelt, einmal muß ich es Dir ſagen
dürfen, — und Du ſegneſt den Verräther, armer Engel,
Du haſt kein Wort des Vorwurfes! Aber laß Dir's ge-
ſtehen, liebes Herz, Du biſt furchtbar gerächt; wenn Haß
und Groll in Deiner Seele lebten, Du könnteſt mir kein
härteres Loos wünſchen, als das, welches mich getroffen.“
Er hielt immer ihre beiden Hände und ſie ließ ſie ihm
willig. Konnte das eine Sünde ſein ? Die fremde, unbe-
kannte Frau hätte jedes Wort hören dürfen, das ſie mit
ihrem Gatten ſprach, hätte getroſt in ihr offenes, blutendes
Herz hineinblicken können!
„Ich weiß nichts von Groll und Zürnen, Leo,“ ſagte
ſie mit weicher Stimme, „aber Du mußt mich jetzt ver-
laſſen. Bedenke, wenn Jemand käme!“
„Geh' mit mir,“ flüſterte er. „Wir ſind unglücklich,
eins ohne das andere, unheilbar unglücklich. Geb' mit, —
der See iſt verſchwiegen und tief.“
Ein Schauer rann durch die Adern des Mädchens.
„Du ſollſt mich nicht verlocken, Leo. Denkſt Du, ich hätte
nicht gekämpft? Aber meine arme Mutter und die kleinen
Geſchwiſter! — der Vater ſtarb, Leo, ſie haben nur mich!“
Ihre Thränen floſſen wieder; er ſchwieg erſchüttert, von
Reue verzehrt. Arme Cilli, armer Engel, es gab für
ihn und ſie auf Erden keinen Troſt mehr.
Drinnen im Zimmer unter dem Balkon regte ſich's.
Mit weit geöffneten Augen ſah das junge Mädchen in die
des Barons. „Leo, bringe nichts auf meine Ehre! Sie
iſt alles, was ich beſitze.“
Er nickte mit ſchmerzvollem Lächeln. „Wir ſehen uns
wieder, Cilli, — oft, oft. Gute Nacht, mein armes Herz!“
Er hauchte einen Kuß auf ihr Haar, dann verſchwand
er wie ein Schatten. Cäcilie horchte mit angſtvoll ſchla-
gendem Herzen, aber ſie ſah und hörte nichts mehr, — nur
im Gebüſch erklang ein leiſes Rauſchen, ob vom Wind oder
von ſeinen Schritten, ſie wußte es nicht. Leiſe ihr Lager
nehen denen der ſchlummernden Kinder aufſuchend, weinte
ſie ſtill vor ſich hin, bis der neue Morgen grau und
dämmernd heraufzog.
Leo war auf der breiten Landſtraße langſam weiter-
gegangen, es drängte ihn nicht, nach Hauſe zu kommen, er
wäre am liebſten in den altmodiſchen Räumen nie wieder
erſchienen, hätte ſich ſelbſt geleugnet, daß ſie überhaupt
exiſtirten. Es war gegen ein Uhr Morgens, als er die
Hausthür öffnete. Im Zimmer neben dem Flur brannte
noch Licht; die Erzieherin ſaß und las in einem Buche, das
ſie bei dem Erſcheinen des Freiherrn zuſammenklappte und
in die Taſche ſchob.
Er ſah ſe vul Erſtaunen an. „Hat man Ihnen auf-
getragen, mich zu erwarten, gnädiges Fräulein ?“
Pauline ſchüttelte den Kopf. „Nein, Herr Baron. Aber
ich dürfte Sie vielleicht bitten, die Poſttaſche zu öffnen und
nachzuſehen, ob ſich für mich ein Brief findet.“
Sie reichte ihm ein elegantes Behältniß, das der
Diener zweimal täglich vom Poſtamte der kleinen Stadt
abholen mußte und das er bei ſeinem eiligen Fortgehen gänzlich
überſehen hatte. Jetzt zog er den Schlüſſel aus der Taſche.
„Sie erwarten alſo dieſen Brief mit großer Sehnſucht.
gnädiges Fräulein 2“
„Ja, Herr Baron.“
Er lächelte ironiſch. „Ohne Zweifel eine jener Sen-
dungen, die Ihnen in rieſigen Beuteln aus Tütenpapier
zugehen, nicht wahr!“
ö (Fortſ. folgt.)
„Ja!“
Arlceint
Aäglich Sonntags
ausgenommen.
Prri
mit Familien-
blättern viertel-
Fhrlich 24.60.4
Ausſchl. Poſtauf-
ſchlag u. Träger-
Lohn.
Heidelberger
Dagblatt und Verkündiger für die Stadt Heidelberg.
citung
Inſertieusgebihr
15.6fürdie 1ſpal-
tige Petitzeile oder
deren Ranm. Für
hieſ. Geſchäfts-
u. Privatanzeigen
bedeut. ermäßigt.
Gralis⸗Aufnahme
d. Inſerate in den
Placat⸗Anzeiger.
Tr. 246
Mittwoch, den 20. Oktober
1886
——
Politiſche Umſchau.
Heidelberg, 20. Oktober.
Der Geſetzentwurf über den Verkauf von Erzeug-
niſſen ausländiſchen Urſprungs, welchen der
Handelsminiſter Lockroy ſoeben der franzöſiſchen Abgeord-
netenkammer vorgelegt hat, gibt der Nat.⸗Lib.⸗Corr. Anlaß
Zwar iſt der
Geſetzentwurf ſchon ſeit längerer Zeit geplant geweſen, im
gegenwärtigen Augenblicke aber in unmittelbaren Zuſammen-
hang mit dem Lärm gebracht, welchen die Pariſer Preſſe
der vorigen Woche über ein auf den Boulevards ver-
kauftes Spielzeug deutſcher Herkunft geſchlagen hat. Unter
dieſem Geſichtspunkte reiht ſich der Entwurf dem famoſen
„Sbpionagegeſetz würdig an. Von neuem hat ſich hier ge-
zeigt, daß die franzöſiſche Regierung ſelbſt den an's Lächer-
liche ſtreifenden Ausbrüchen des chauviniſtiſchen Haſſes gegen
Deutſchland nicht allein nicht entgegentritt, ſondern ihnen
eher nachgibt. In Deutſchland wird man dieſe Thatſache
zu den andern ſchreiben; wundern kann man ſich ja bei
unſern weſtlichen Nachbarn nachgerade über nichts mehr.
Abgeſehen von dieſer mehr äußerlichen politiſchen Seite hat
aber der Lockroy'ſche Geſetzentwurf im Grunde eine ſehr
nüchterne wirthſchaftliche Bedeutung. Er iſt einfach ein
beſonders in die Augen ſpringender Ausfluß des Protec-
tionsſyſtems, wie es in Frankreich in Blüthe ſteht. Seit
Jahren weiß man, daß die ehemals ſo hervorragende In-
duſtrie der articles de Paris dem auswärtigen Wettbewerb
immer mehr hat weichen müſſen, daß nicht allein ihre Aus-
fuhr ſehr zurückgegangen iſt, ſondern daß ihre Waaren ſogar
f dem Pariſer Markte zum Theil durch ausländiſche Fahri-
te verdrängt ſind. Dem will man jetzt dadurch entgegentreten,
aß man dem Verkäufer die Angabe des Urſprungsortes
ſeiner Waaren zur Pflicht macht und jede Bezeichnung aus-
ländiſcher Erzeugniſſe als franzöſiſche unter ſehr ſchwere
Strafen ſtellt. Uns Deutſchen ſchwindelt bei dem Gedanken
an die Unſumme von Angebereien, von Polizeiſpionage und
aͤllerhand Plackereien, welche die ernſtliche Durchführung
eines ſolchen Geſetzes verurſachen muß. In Frankreich kann
eine Regierung, die es an politiſchem Radicalismus unſern
fortgeſchrittenſten Fortſchrittlern zum mindeſten gleichthut,
dergleichen Vorſchläge wagen, ohne von irgend jemand frei-
heitfeindlicher Geſinnung angeklagt zu werden. Sehr merk-
würdig freilich iſt das Zeugniß der Schwäche, welches der
franzöſiſchen Induſtrie mit dieſem Geſetz ausgeſtellt wird.
Wenm alle die bekanntlich ſehr reichlich bemeſſenen Schutz-
zölle nicht genügen, um die ſiegreiche Concurrenzfähigkeit
der franzöſiſchen Fabrikate außer Zweifel zu ſtellen, ſo muß
daran doch wohl die thatſächliche Ueberlegenheit der aus-
ländiſchen Erzeugniſſe ſchuld ſein. Und dieſer Ueberlegen-
heit gegenüber weiß man ſich nicht anders zu helfen, als
durch eine Anrufung des Chauvinismus! Für uns Deutſche
liegt darin eine gewiſſe Genugthuung, zugleich aber doch
eine ſtarke Beſchämung. In Frankreich iſt man überzeugt,
der ausländiſchen Waare nur die franzöſiſche Etikette neh-
men zu müſſen, um ſich die Käufer von ihr abwenden zu
ſehen. Bei uns glaubt man umgekehrt immer noch, dem
deutſchen Erzeugniß einen fremdländiſchen Namen geben zu
müſſen, um ihm leichtern Abſatz zu ſichern. Und leider iſt
dieſe Speculation in den Neigungen des deutſchen Publi-
kums immer noch nur zu ſehr begründet. In dieſem Punkte
wäre es endlich Zeit, von den Franzoſen zu lernen.
Die Nat.⸗Zig. unterſucht die geſchichtliche Entſtehung
des ſogen. Militärſeptennats und ſpricht für die Bei-
behaltung desſelben. In letzterer Beziehung ſagt ſie: Die
Zahl von 7 Jahren für die geſetzliche Feſtſtellung beſitzt
natürlich keine ſakramentale Weihe; es können vielleicht
ebenſo gut 6 oder 8 Jahre ſein; worauf es ankommt, das
iſt die durch eine längere Periode der Feſtſtellung gewährte
Stetigkeit, und da hat die 7 jährige Periode den Vorzug,
daß ſie nun ſchon einigermaßen Gewohnheitsrecht geworden
iſt, während die Wahl jeder anderen Zahl willkürlich wäre.
Gegen eine Feſtſtellung auf kurze Friſt ſpricht auch jede
ſachliche Erwägung. Die europäiſchen Verhältniſſe werden
ſich für abſehbare Zeit nicht von einem Jahre auf das
andere, auch nicht binnen 3 Jahren ſo entſchieden beruhi-
gend geſtalten, daß eine erhebliche Verminderung des Prä-
ſenzſtandes zuläſſig erſcheine, die bei einer auf allgemeiner
Wehrpflicht beruhenden Armee auf viele Jahre hinaus in
einer Verminderung der Kriegsſtärke nachwirkt. Nur ei ne
ſichere Folge wäre von häufigen Wiederholungen der Be-
ſchlußfaſſung über die Friedensſtärke vorherzuſehen: die
Erneuerung aufregender Agitationen in kurzen Zwiſchen-
räumen. ö
Dicke Bände ſind in der parlamentsloſen Zwiſchenzeit
in Frankreich geredet und geſchrieben worden, um die
republikaniſchen Quer⸗ und Hitzköpfe zur Beſonnenheit zu
ermahnen und möglichſt unter einen Hut — Fagçon Grevy-
Freycinet — zu bringen. Aber kaum iſt die Deputirten-
kammer zuſammengetreten, beginnen die alten Schwierigkeiten
wieder und die Miniſterſtühle gerathen ins Wackeln. Vier
Miniſter, an ihrer Spitze Sarrien, erklärten, ihr Porte-
feuille niederlegen zu wollen, weil die Kammer die von der
Regierung bei den Arbeiterunruhen in Vierzonville ge-
troffenen Maßnahmen nicht gutheißen wollte. Da ſich
Freycinet indeß alle Mühe gegeben, und zwar nicht vergeb-
lich, ſeine Collegen zum Bleiben zu bewegen, ſo dürfte die
über Nacht ausgebrochene Kriſis wieder glücklich abge-
wendet ſein. Auch die Kammer bedauert den Beſchluß, an
welchem die Miniſter Anſtoß genommen, aber charakteriſtiſch
für dieſe Kammerpolitiker iſt ihre Erklärung, die ganze Ge-
ſchichte beruhe lediglich auf einem — Mißzerſtändniß. Das
könnte nun auf den erſten Blick bloß ſehr bußig erſcheinen;
aber es hat ſeine gar ernſte Seite: man denke einmal, daß
eine Frage, welche die Lawine, die der Chauvinismus jetzt
eifriger als je aufſchichtet, zum Rollen bringen könnte,
zur Verhandlung im Palais Bourbon käme und die Mehr-
heit aus Mißverſtändniß dafür ſtimmte: würde der Riß
zwiſchen Frankreich und Deutſchland ebenſo harmlos wieder
verkleiſtert werden können, wie zwiſchen den Deputirten und
den Miniſtern Sarrien u. ſ. w.? Die dritte Republik
wird ohne Logik geführt; man lebt von Illuſionen und
Gelüſten, man hat überreizte Weibernerven, man iſt be-
ſeſſen von Größenwahn: iſt mit ſolchen Leuten zu rechnen
oder ein ruhiger Geſchäftsgang möglich? Und unter ſolchen
Umſtänden hat Herr Herbette ſeinen Einzug in Berlin
gehalten.
Den Matadoren der ultramontanen Hetzpreſſe
iſt vom Papſt Leo XIII. in einer jüngſt an die portu-
gieſiſchen Biſchöfe erlaſſenen Eneyklika gar nnſanft auf die
Finger geklopft worden. Darin bezeichnet nämlich der
Papſt die Handlungsweiſe derjenigen katholiſchen Publiziſten
als fehlerhaft und unrecht, „die als Anhänger einer poli-
tiſchen Partei nicht anſtehen, den katholiſchen Glauben An-
derer zu verdächtigen, aus dem einzigen Grunde, weil ſie
zu einer anderen Partei gehören; als ob das Lob ka-
tholiſcher Bekenntnißtrene mit dieſen oder
jenen politiſchen Parteien nothwendig zu-
ſammenhänge.“ Eine gar bittere Pille für unſere ultra-
montanen Politiker. Möge ſie Se. Heiligkeit nicht umſonſt
verabreicht haben.
Deutſches Reich.
Baden⸗Baden, 19. Oct. Obgleich der Geſundheits-
zuſtand des Kaiſers während der vorigen Woche mehr-
fachen Schwankungen unterlag, iſt zur Zeit doch das Be-
finden derart befriedigend, daß er heute um 2 Uhr eine
Ausfahrt und einen Beſuch beim Fürſten Solms unter-
nehmen konnte. Die Abreiſe des Kaiſers bleibt für
morgen Nachmittag halb 6 Uhr mittelſt Extrazuges feſt-
geſetzt. — Montag, den 18. d., als dem Geburtstage des
Deutſchen Kronprinzen, begaben ſich der Großherzog
und die Großherzogin Vormittags zu Ihren Kaiſerl. Maje-
ſtäten zur Gratulation. — Geſtern Früh begab ſich der
Flügeladjutant Major Müller im Auftrag des Großherzogs
nach Gernsbach, um dem Grafen Hermann von Arni m die
Theilnahme des Großherzogs und der Großherzogin an
deſſen ſchwerer Prüfung auszudrücken. Major Müller traf
den Grafen in Weiſenbach und konnte ſich dort des höchſten
Auftrags entledigen. Major Müller hatte noch den Auftrag,
ſich über die näheren Umſtände der Auffindung der Leiche
der Gräfin Arnim zu erkundigen, um dem Großherzog ge-
nauen Bericht zu erſtatten, und ſetzte ſich daher mit dem
Amtsgericht und Amtsarzt in Verbindung. Schon um
Mittag konnte derſelbe dem Großherzog Meldung erſtatten.
Berlin, 19. Oct. Nachſtehende Verordnung iſt
erlaſſen worden: § 1. Der kaiſerliche Commiſſar
für das Schutzgebiet der Marſchall⸗, Brown⸗ und Pro-
vidence⸗Inſeln iſt ermächtigt, für die allgemeine.
Verwaltung und das Zoll⸗ und Steuerweſeneer
ordnungen zu erlaſſen. ſid fütt
ſchrift dem Reichskanzler
die erlaſſenen Verordnungen;
kündung der Verord
Weiſe jedenfalls durch An
gierungsgebäudes. § 3. Geß che
auf Grund der in Gemäßheit des § 1 erlaſſenen Verord-
nungen ergehen, ſteht den Betroffenen die Beſchwerde an
den Reichskanzler (Auswärtiges Amt) zu. Die Einlegung
der Beſchwerde hat keine aufſchiebende Wirkung, es kann
jedoch von dem kaiſerlichen Commiſſar die vorläufige Ein-
ſtellung der Vollſtreckung verfügt werden. Urkundlich unter
Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem
kaiſerlichen Inſiegel gegeben zu Baden⸗Baden, den 15. Oct.
1886. Wilhelm. v. Bismarck. — Der neue fran-
zöſiſche Botſchafter Jules Herbette hat bereits geſtern
mit dem Staatsſecretär Grafen Herbert Bis marck
im Auswärtigen Amte eine län gere Unterredung
gehabt.
Berlin, 19. Oct. Eine ſtürmiſche Verſammlung
hielten, wie ſchon erwähnt, die Chriſtlichſocialen in
Berlin am Abend des 15. Prof. Wagner ſprach über
„Staatsſocialismus und Socialdemokratie“ und die Wahl
dieſes Themas hatte die im Südoſten beſonders zahlreich
—
Frauenloos.
Von S. v. d. Horſt.
(Fortſetzung.)
Keine Stunde des Tages gehörte ihr ſelbſt, nur die
verſchwiegene Nacht durfte ſehen, was das arme junge
Weſen litt. Thräne um Thräne fiel herab, die Bruſt er-
hob ſich in bitterem Weh, ein Ton erſchütternder Klage
traf das Ohr des lauſchenden Mannes.
Er trat unhörbar aus dem Schatten hervor und näherte
ſich dem jungen Mädchen, indem er leiſe die bebende Hand
auf ihren Scheitel legte „Cäcilie!“ ö
Sie zuckte zuſammen, wie vom Feuer berührt, ihre gro-
ßen dunklen Augen ſahen ihm beinahe drohend entgegen,
ihre Stimme klang verändert vor innerer Aufregung. „Gehen
Sie, Herr Baron! Wer gab Ihnen das Recht, mich ſo
furchtbar zu beleidigen?“ ö
Er ſchüttelte den Kopf. „Laß das alles, Cäcilie, es
25)
nützt zu nichts. Ich mußte Dich ſehen, und ich bin hier-
nicht Deine Hand geben
ergekommen. Willſt Du mir
Kar daß Deine Großmuth dem
— Cilli, willſt Du nicht ſagen,
armen Thoren verzeiht 2“
Der Ton traf ihr Herz. „Geh, Leo, geh, — ich ver-
zieh' Dir längſt. Möchteſt Du geſegnet ſein für und für,
— aber geh jetzt um Gotteswillen.
Er küßte ihre kleine, brennende Hand, er berauſchte ſich
in der Wonne der Selbſtanklage. „Cilli, ich habe wie ein
Schurke an Dir gehandelt, einmal muß ich es Dir ſagen
dürfen, — und Du ſegneſt den Verräther, armer Engel,
Du haſt kein Wort des Vorwurfes! Aber laß Dir's ge-
ſtehen, liebes Herz, Du biſt furchtbar gerächt; wenn Haß
und Groll in Deiner Seele lebten, Du könnteſt mir kein
härteres Loos wünſchen, als das, welches mich getroffen.“
Er hielt immer ihre beiden Hände und ſie ließ ſie ihm
willig. Konnte das eine Sünde ſein ? Die fremde, unbe-
kannte Frau hätte jedes Wort hören dürfen, das ſie mit
ihrem Gatten ſprach, hätte getroſt in ihr offenes, blutendes
Herz hineinblicken können!
„Ich weiß nichts von Groll und Zürnen, Leo,“ ſagte
ſie mit weicher Stimme, „aber Du mußt mich jetzt ver-
laſſen. Bedenke, wenn Jemand käme!“
„Geh' mit mir,“ flüſterte er. „Wir ſind unglücklich,
eins ohne das andere, unheilbar unglücklich. Geb' mit, —
der See iſt verſchwiegen und tief.“
Ein Schauer rann durch die Adern des Mädchens.
„Du ſollſt mich nicht verlocken, Leo. Denkſt Du, ich hätte
nicht gekämpft? Aber meine arme Mutter und die kleinen
Geſchwiſter! — der Vater ſtarb, Leo, ſie haben nur mich!“
Ihre Thränen floſſen wieder; er ſchwieg erſchüttert, von
Reue verzehrt. Arme Cilli, armer Engel, es gab für
ihn und ſie auf Erden keinen Troſt mehr.
Drinnen im Zimmer unter dem Balkon regte ſich's.
Mit weit geöffneten Augen ſah das junge Mädchen in die
des Barons. „Leo, bringe nichts auf meine Ehre! Sie
iſt alles, was ich beſitze.“
Er nickte mit ſchmerzvollem Lächeln. „Wir ſehen uns
wieder, Cilli, — oft, oft. Gute Nacht, mein armes Herz!“
Er hauchte einen Kuß auf ihr Haar, dann verſchwand
er wie ein Schatten. Cäcilie horchte mit angſtvoll ſchla-
gendem Herzen, aber ſie ſah und hörte nichts mehr, — nur
im Gebüſch erklang ein leiſes Rauſchen, ob vom Wind oder
von ſeinen Schritten, ſie wußte es nicht. Leiſe ihr Lager
nehen denen der ſchlummernden Kinder aufſuchend, weinte
ſie ſtill vor ſich hin, bis der neue Morgen grau und
dämmernd heraufzog.
Leo war auf der breiten Landſtraße langſam weiter-
gegangen, es drängte ihn nicht, nach Hauſe zu kommen, er
wäre am liebſten in den altmodiſchen Räumen nie wieder
erſchienen, hätte ſich ſelbſt geleugnet, daß ſie überhaupt
exiſtirten. Es war gegen ein Uhr Morgens, als er die
Hausthür öffnete. Im Zimmer neben dem Flur brannte
noch Licht; die Erzieherin ſaß und las in einem Buche, das
ſie bei dem Erſcheinen des Freiherrn zuſammenklappte und
in die Taſche ſchob.
Er ſah ſe vul Erſtaunen an. „Hat man Ihnen auf-
getragen, mich zu erwarten, gnädiges Fräulein ?“
Pauline ſchüttelte den Kopf. „Nein, Herr Baron. Aber
ich dürfte Sie vielleicht bitten, die Poſttaſche zu öffnen und
nachzuſehen, ob ſich für mich ein Brief findet.“
Sie reichte ihm ein elegantes Behältniß, das der
Diener zweimal täglich vom Poſtamte der kleinen Stadt
abholen mußte und das er bei ſeinem eiligen Fortgehen gänzlich
überſehen hatte. Jetzt zog er den Schlüſſel aus der Taſche.
„Sie erwarten alſo dieſen Brief mit großer Sehnſucht.
gnädiges Fräulein 2“
„Ja, Herr Baron.“
Er lächelte ironiſch. „Ohne Zweifel eine jener Sen-
dungen, die Ihnen in rieſigen Beuteln aus Tütenpapier
zugehen, nicht wahr!“
ö (Fortſ. folgt.)
„Ja!“