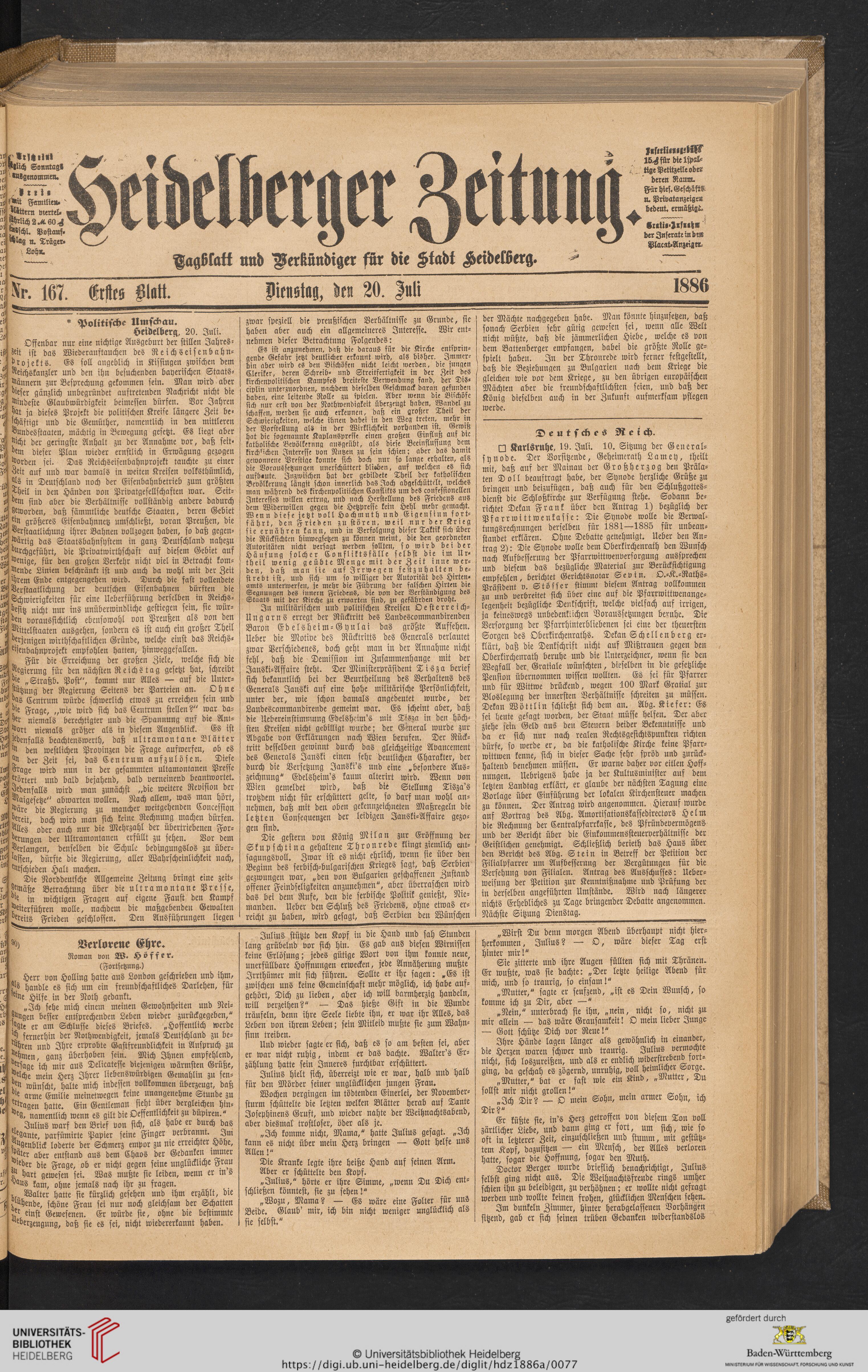urein
lich Sonntags
e usgenommen.
u[ „DIT.
Drri-
aſit Familier-
ſih Zuttern wiertel-
o4rch 24 604
ſchl. Poſtauf-
ridelberger Zeitun
* zaſerliensIsbile
15. für die 1ſpal-
* tige Petitzeile oder
deren Raum.
Fär hieſ. Geſchäfts
u. Privatanzeigers
4„ bedeut. ermäßigt.
Sratis⸗-Infnats
eiwlag n. Trager · der Inſerate in des
aſLohn. „— — „ „ — Placat⸗Anzeiger-
+H[ — Tagblalt und Verkündiger für die Stadt Heidelberg. —
1120..—
—0 — —
Nr. 167. Erſies Blalt. Dienstag, den 20. Zuli 188
al
* Politiſche Umſchau. zwar ſpeziell die preußiſchen Verhältniſſe zu Grunde, ſie der Mächte nachgegeben habe. Man könnte hinzuſetzen, daß
Heidelberg, 20. Juli. haben aber auch ein allgemeineres Intereſſe. Wir ent⸗ ſonach Serbien ſehr gütig geweſen ſei, wenn alle Welt
„Offfnbar nur eine nichtige Ausgeburt der ſtillen Jahres-
ſſzeit iſt das Wiederauftauchen des Reichseiſenbahn-
brojekts. Es ſoll angeblich in Kiſſingen zwiſchen dem
0 Reichskanzler und den ihn beſuchenden bayeriſchen Staats-
irh ännern zur Beſprechung gekommen ſein. Man wird aber
196 ieſer gänzlich unbegründet auftretenden Nachricht nicht die
9½ windeſte Glaubwürdigkeit beimeſſen dürfen. Vor Jahren
zun dat ja dieſes Projekt die politiſchen Kreiſe längere Zeit be-
4 Gäftigt und die Gemüther, namentlich in den mittleren
4 Dundesſtaaten, mächtig in Bewegung geſetzt. Es liegt aber
icht der geringſte Anhalt zu der Annahme vor, daß ſeit-
niem dieſer Plan wieder ernſtlich in Erwägung gezogen
0 vorden ſei. Das Reichseiſenbahnprojekt tauchte zu einer
30 Jeit auf und war damals in weiten Kreiſen volksthümlich,
In Us in Deutſchland noch der Eiſenbahnbetrieb zum größten
Theil in den Händen von Privatgeſellſchaften war. Seit-
dem ſind aber die Verhältniſſe vollſtändig andere dadurch
ibſetworden, daß ſämmtliche deutſche Staaten, deren Gebiet
200 f. größeres Eiſenbahnnetz umſchließt, voran Preußen, die
3 erſtaatlichung ihrer Bahnen vollzogen haben, ſo daß gegen-
her durtig das Staatsbahnſyſtem in ganz Deutſchland nahezu
9 urchgeführt, die Privatwirthſchaft auf dieſem Gebiet auf
u denige, für den großen Verkehr nicht viel in Betracht kom-
umende Linien beſchränkt iſt und auch da wohl mit der Zeit
erihrem Ende entgegengehen wird. Durch die faſt vollendete
3 Verſtaatlichung der deutſchen Eiſenbahnen dürften die
chwierigkeiten für eine Ueberführung derſelben in Reichs-
+ beſitz nicht nur ins unüberwindliche geſtiegen ſein, ſie wür-
lic den vorausſichtlich ebenſowohl von Preußen als von den
+ Mittelſtaaten ausgehen, ſondern es iſt auch ein großer Theil
Verjenigen wirthſchaftlichen Gründe, welche einſt das Reichs-
. eiſenbahnprojekt empfohlen hatten, hinweggefallen.
Für die Erreichung der großen Ziele, welche ſich die
Aegierung für den nächſten Reichstag geſetzt hat, ſchreibt
e „Straßb. Poſt“, kommt nur Alles — auf die Unter-
buſkützung der Regierung Seitens der Parteien an. Ohne
1bDas Centrum würde ſchwerlich etwas zu erreichen ſein und
die Frage, „wie wird ſich das Centrum ſtellen?“ war da-
r niemals berechtigter und die Spannung auf die Ant-
2ig dort niemals größer als in dieſem Augenblick. Es iſt
Fudenfalls beachtenswerth, daß ultramontane Blätter
hgin den weſtlichen Provinzen die Frage aufwerfen, ob es
jan der Zeit ſei, das Centrum aufzulöſen. Dieſe
age wird nun in der geſammten ultamontanen Preſſe
rtert und bald bejahend, bald verneinend beantwortet.
(Iddenfalls wird man zunächſt „die weitere Reviſion der
Maigeſetz“ abwarten wollen. Nach allem, was man hört,
Jwäre die Regierung zu mancher weitgehenden Conceſſion
Abereit, doch wird man ſich keine Rechnung machen dürfen.
0u Mles oder auch nur die Mehrzahl der übertriebenen For-
irn derungen der Ultramontanen erfüllt zu ſehen. Vor dem
geſ Ferlangen, denſelben die Schule bedingungslos zu über-
laſſen, dürfte die Regierung, aller Wahrſcheinlichkeit nach,
unſentſchieden Halt machen.
Die Norddeutſche Allgemeine Zeitung bringt eine zeit-
I. Mwäße Betrachtung über die ultramontane Preſſe,
2 10 in wichtigen Fragen auf eigene Fauſt den Kampf
heterführen wolle, nachdem die maßgebenden Gewalten
Seits Frieden geſchloſſen. Den Ausführungen liegen
t
—
2
9
nehmen dieſer Betrachtung Folgendes:
Es iſt anzunehmen, daß die daraus für die Kirche entſprin-
geude Gefahr jetzt deutlicher erkannt wird, als bisher. Immer-
bin aber wird es den Biſchöfen nicht leicht werden, die jungen
Cleriker, deren Schreib⸗ und Streitfertigkeit in der Zeit des
kirchenpolitiſchen Kampfes breiteſte Verwendung fand, der Dis-
ciplin unterzuordnen, nachdem dieſelben Geſchmack daran gefunden
haben, eine leitende Rolle zu ſpielen. Aber wenn die Biſchöfe
ſich nur erſt von der Nothwendigkeit überzeugt haben. Wandel zu
ſchaffen, werden ſie auch erkennen, daß ein großer Theil der
Schwierigkeiten, welche ihnen dabei in den Weg treten, mehr in
der Vorſtellung als in der Wirklichkeit vorhanden iſt. Gewiß
hat die ſogenannte Kaplanspreſſe einen großen Einfluß auf die
katholiſche Bevölkernng ausgeübt, als dieſe Beeinfluſſung dem
kirchlichen Intereſſe von Nutzen zu ſein ſchien: aber das damit
gewonnene Preſtige konnte ſich doch nur ſo lange erhalten, als
die Vorausſetzun gen unerſchüttert blieben, auf welchen es ſich
aufbaute. Inzwiſchen hat der gebildete Theil der katholiſchen
Bevölkerung längſt ſchon innerlich das Joch abgeſchüttelt, welches
man während des kirchenpolitiſchen Conflikts um des confeſſionellen
Intereſſes willen ertrug, und nach Herſtellung des Friedens aus
dem Widerwillen gegen die Hetzpreſſe kein Hehl mehr gemacht.
Wenn dieſe jetzt voll Hochmuth und Eigenſinn fort-
fährt, den Frieden zu ſtören, weil nur der Krieg
ſie ernähren kann, und in Verfolgung dieſer Taktik ſich über
die Rückſichten hinwegſetzen zu können meint, die den geordneten
Autoritäten nicht verſagt werden ſollten, ſo wird bei der
Häufung ſolcher Confliktsfälle ſelbſt die im Ur-
theil wenig geübte Menge mit der Zeit inne wer-
den, daß man ſie auf Irrwegen feſtzuhalten be-
ſtrebt iſt, und ſich um ſo williger der Autorität des Hirten-
amts unterwerfen, je mehr die Führung der falſchen Hirten die
Segnungen des innern Friedens, die von der Verſtändigung des
Staats mit der Kirche zu erwarten ſind, zu gefährden droht.
In militäriſchen und politiſchen Kreiſen Oeſterreich-
Ungarns erregt der Rücktritt des Landescommandirenden
Baron Edelsheim⸗Gyulai das größte Aufſehen.
Ueber die Motive des Rücktritts des Generals verlautet
zwar Verſchiedenes, doch geht man in der Annahme nicht
fehl, daß die Demiſſion im Zuſammenhange mit der
Janski⸗Affaire ſteht. Der Miniſterpräſident Tisza berief
ſich bekanntlich bei der Beurtheilung des Verhaltens des
Generals Janski auf eine hohe militäriſche Perſönlichkeit,
unter der, wie ſchon damals angedeutet wurde, der
Landescommandirende gemeint war. Es ſcheint aber, daß
die Uebereinſtimmung Edelsheim's mit Tisza in den höch-
ſten Kreiſen nicht gebilligt wurde; der General wurde zur
Abgabe von Erklärungen nach Wien berufen. Der Rück-
tritt deſſelben gewinnt durch das gleichzeitige Avancement
des Generals Janski einen ſehr deutlichen Charakter, der
durch die Verſetzung Janski's und eine „beſondere Aus-
zeichnung“ Edelsheim's kaum alterirt wird. Wenn von
Wien gemeldet wird, daß die Stellung Tisza's
trotzdem nicht für erſchüttert gelte, ſo darf man wohl an-
nehmen, daß mit den oben gekennzeichneten Maßregeln die
letzten Conſequenzen der leidigen Janski⸗Affaire gezo-
gen ſind.
Die geſtern von König Milan zur Eröffnung der
Skupſchtina gehaltene Thronrede klingt ziemlich ent-
ſagungsvoll. Zwar iſt es nicht ehrlich, wenn ſie über den
Beginn des ſerbiſch⸗bulgariſchen Krieges ſagt, daß Serbien
gezwungen war, „den von Bulgarien geſchaffenen Zuſtand
offener Feindſeligkeiten anzunehmen“, aber überraſchen wird
das bei dem Rufe, den die ſerbiſche Politik genießt, Nie-
manden. Ueber den Schluß des Friedens, ohne etwas er-
reicht zu haben, wird geſagt, daß Serbien den Wünſchen
nicht wüßte, daß die jämmerlichen Hiebe, welche es von
dem Battenberger empfangen, dabei die größte Rolle ge-
ſpielt haben. In der Thronrede wird ferner feſtgeſtellt,
daß die Beziehungen zu Bulgarien nach dem Kriege die
gleichen wie vor dem Kriege, zu den übrigen europätſchen
Mächten aber die freundſchaftlichſten ſeien, und daß der
König dieſelben auch in der Zukunft aufmerkſam pflegen
werde.
Deutſches Reich.
◻Karlsruhe, 19. Juli. 10. Sitzung der General-
ſynode. Der Vorſitzende, Geheimerath Lamey, theilt
mit, daß auf der Mainau der Großherzog den Präla-
ten Doll beauftragt habe, der Synode herzliche Grüße zu
bringen und beizufügen, daß auch für den Schlußgottes-
dienſt die Schloßkirche zur Verfügung ſtehe. Sodann be-
richtet Dekan Frank über den Antrag 1) bezüglich der
Pfarrwittwenkaſſe: Die Synode wolle die Verwal-
tungsrechnungen derſelben für 1881 1885 für unbean-
ſtandet erklären. Ohne Debatte genehmigt. Ueber den An-
trag 2): Die Synode wolle dem Oberkirchenrath den Wunſch
nach Aufbeſſerung der Pfarrwittwenverſorgung ausſprechen
und dieſem das bezügliche Material zur Berückſichtigung
empfehlen, berichtet Gerichtsnotar Sev in. O.⸗K.⸗Raths-
Präſident v. Stöſſer ſtimmt dieſem Antrag vollkommen
zu und verbreitet ſich über eine auf die Pfarrwittwenange-
legenheit bezügliche Denkſchrift, welche vielfach auf irrigen,
ja keineswegs unbedenklichen Vorausſetzungen beruhe. Die
Verſorgung der Pfarrhinterbliebenen ſei eine der theuerſten
Sorgen des Oberkirchenraths. Dekan Schellenberg er-
klärt, daß die Denkſchrift nicht auf Mißtrauen gegen den
Oberkirchenrath beruhe und die Unterzeichner, wenn ſie den
Wegfall der Gratiale wünſchten, dieſelben in die geſetzliche
Penſion übernommen wiſſen wollten. Es ſei für Pfarrer
und für Wittwe drückend, wegen 100 Mark Gratial zur
Bloslegung der innerſten Verhältniſſe ſchreiten zu müſſen.
Dekan Wöttlin ſchließt ſich dem an. Abg. Kiefer: Es
ſei heute geſagt worden, der Staat müſſe helfen. Der aber
ziehe ſein Geld aus den Steuern beider Bekenntniſſe und
da er ſich nur nach realen Rechtsgeſichtspunkten richten
dürfe, ſo werde er, da die katholiſche Kirche keine Pfarr-
wittwen kenne, ſich in dieſer Sache ſehr ſpröd und zurück-
haltend benehmen müſſen. Er warne daher vor eitlen Hoff-
nungen. Uebrigens habe ja der Kultusminiſter auf dem
letzten Landtag erklärt, er glaube der nächſten Tagung eine
Vorlage über Einführung der lokalen Kirchenſteuer machen
zu können. Der Antrag wird angenommen. Hierauf wurde
auf Vortrag des Abg. Amortiſationskaſſedirectors Helm
die Rechnung der Centralpfarrkaſſe, des Pfründevermögens
und der Bericht über die Einkommensſteuerverhältniſſe der
Geiſtlichen genehmigt. Schließlich berieth das Haus über
den Bericht des Abg. Stein in Betreff der Petition der
Filialpfarrer um Aufbeſſerung der Vergütungen für die
Verſehung von Filialen. Antrag des Ausſchuſſes: Ueber-
weiſung der Petition zur Kenntnißnahme und Prüfung der
in derſelben angeführten Umſtände. Wird nach längerer
nichts Erhebliches zu Tage bringender Debatte angenommen.
Nächſte Sitzung Dienstag.
——
Verlorene Ehre.
Roman von W. Höffer.
4 (Fortſetzung.)
ar Herr von Holling hatte aus London geſchrieben und ihm,
106 handle es ſich um ein freundſchaftliches Darlehen, für
Jene Hilfe in der Noth gedankt.
54, „Ich ſehe mich einem meinen Gewohnheiten und Nei-
6 ungen beſſer entſprechenden Leben wieder zurückgegeben,“
iate er am Schluſſe dieſes Briefes. „Hoffentlich werde
0 fernerhin der Nothwendigkeit, jemals Deutſchland zu be-
ö Whren und Ihre erprobte Gaſtfreundlichkeit in Anſpruch zu
Iiehmen, ganz überhoben ſein. Mich Ihnen empfehlend,
Iiſage ich mir aus Delicateſſe diejenigen wärmſten Grüße,
eiche mein Herz Ihrer liebenswürdigen Gemahlin zu ſen-
2 5 wünſcht, halte mich indeſſen vollkommen überzeugt, daß
0 0 arme Emilie meinetwegen keine unangenehme Stunde zu
16 deragen hatte. Ein Gentleman ſieht über dergleichen hin-
Veg, namentlich wenn es gilt die Oeffentlichkeit zu düpiren.“
ul.Julius warf den Brief von ſich, als habe er durch das
Amante, parfümirte Papier ſeine Finger verbrannt. Im
paublic loderte der Schmerz empor zu nie erreichter Höhe,
1ier aber entſtand aus dem Chaos der Gedanken immer
uder die Frage, ob er nicht gegen ſeine unglückliche Frau
1Ue hart geweſen ſei. Was mußte ſie leiden, wenn er in's
aus kam, ohne jemals nach ihr zu fragen.
Walter hatte ſie kürzlich geſehen und ihm erzählt, die
wäbende ſchöne Frau ſei nur noch gleichſam der Schatten
ö 0 einſt Geweſenen. Er würde ſie, ohne die beſtimmte
erzeugung, daß ſie es ſei, nicht wiedererkannt haben.
Julius ſtützte den Kopf in die Hand und ſah Stunden
lang grübelnd vor ſich hin. Es gab aus dieſen Wirniſſen
keine Erlöſung; jedes gütige Wort von ihm konnte neue,
unerfüllbare Hoffnungen erwecken, jede Annäherung mußte
Irrthümer mit ſich führen. Sollte er ihr ſagen: „Es iſt
zwiſchen uns keine Gemeinſchaft mehr möglich, ich habe auf-
gehört, Dich zu lieben, aber ich will barmherzig handeln,
will verzeihen?“ — Das hieße Gift in die Wunde
träufeln, denn ihre Seele liebte ihn, er war ihr Alles, das
Leben von ihrem Leben; ſein Mitleid mußte ſie zum Wahn-
ſinn treiben.
Und wieder ſagte er ſich, daß es ſo am beſten ſei, aber
er war nicht ruhig, indem er das dachte. Walter's Er-
zählung hatte ſein Inneres furchtbar erſchüttert.
Julius hielt ſich, überreizt wie er war, halb und halb
für den Mörder ſeiner unglücklichen jungen Frau.
Wochen vergingen im tödtenden Einerlei, der November-
ſturm ſchüttelte die letzten welken Blätter herab auf Tante
Joſephinens Gruft, und wieder nahte der Weihnachtsabend,
aber diesmal troſtloſer, öder als je.
„Ich komme nicht, Mama,“ hatte Julius geſagt. „Ich
kann es nicht über mein Herz bringen — Gott helfe uns
Allen !“
Die Kranke legte ihre heiße Hand auf ſeinen Arm.
Aber er ſchüttelte den Kopf.
„Julius,“ hörte er ihre Simme, „wenn Du Dich ent-
ſchließen könnteſt, ſie zu ſehen!“
„Wozu, Mama? — Es wäre eine Folter für uns
Beide. Glaub' mir, ich bin nicht weniger unglücklich als
ſie ſelbſt.“ ö
„Wirſt Du denn morgen Abend überhaupt nicht hier-
herkommen, Julius? — O, wäre dieſer Tag erſt
hinter mir!“
Sie zitterte und ihre Augen füllten ſich mit Thränen.
Er wußte, was ſie dachte: „Der letzte heilige Abend für
mich, und ſo traurig, ſo einſam!“
„Mutter,“ ſagte er ſeufzend, „iſt es Dein Wunſch, ſo
komme ich zu Dir, aber —“
„Nein,“ unterbrach ſie ihn, „nein, nicht ſo, nicht zu
mir allein — das wäre Grauſamkeit! O mein lieber Junge
— Gott ſchütze Dich vor Reue!“
Ihre Hände lagen länger als gewöhnlich in einander,
die Herzen waren ſchwer und traurig. Julius vermochte
nicht, ſich loszureißen, und als er endlich widerſtrebend fort-
ging, da geſchah es zögernd, unruhig, voll heimlicher Sorge.
„Mutter,“ bat er faſt wie ein Kind, „Mutter, Du
ſollſt mir nicht grollen!“
„Ich Dir? — O mein Sohn, mein armer Sohn, ich
Dir 2*
Er küßte ſie, in's Herz getroffen von dieſem Ton voll
zärtlicher Liebe, und dann ging er fort, um ſich, wie ſo
oft in letzterer Zeit, einzuſchliezen und ſtumm, mit geſtütz-
tem Kopf, dazuſitzen — ein Menſch, der Alles verloren
hatte, ſogar die Hoffnung, ſogar den Muth.
Doctor Berger wurde brieflich benachrichtigt, Julius
ſelbſt ging nicht aus. Die Weihnachtsfreude rings umher
ſchien ihn zu beleidigen, zu verhöhnen; er wollte nicht gefragt
werden und wollte keinen frohen, glücklichen Menſchen ſehen.
Im dunkeln Zimmer, hinter herabgelaſſenen Vorhängen
ſitzend, gab er ſich ſeinen trüben Gedanken widerſtandslos
lich Sonntags
e usgenommen.
u[ „DIT.
Drri-
aſit Familier-
ſih Zuttern wiertel-
o4rch 24 604
ſchl. Poſtauf-
ridelberger Zeitun
* zaſerliensIsbile
15. für die 1ſpal-
* tige Petitzeile oder
deren Raum.
Fär hieſ. Geſchäfts
u. Privatanzeigers
4„ bedeut. ermäßigt.
Sratis⸗-Infnats
eiwlag n. Trager · der Inſerate in des
aſLohn. „— — „ „ — Placat⸗Anzeiger-
+H[ — Tagblalt und Verkündiger für die Stadt Heidelberg. —
1120..—
—0 — —
Nr. 167. Erſies Blalt. Dienstag, den 20. Zuli 188
al
* Politiſche Umſchau. zwar ſpeziell die preußiſchen Verhältniſſe zu Grunde, ſie der Mächte nachgegeben habe. Man könnte hinzuſetzen, daß
Heidelberg, 20. Juli. haben aber auch ein allgemeineres Intereſſe. Wir ent⸗ ſonach Serbien ſehr gütig geweſen ſei, wenn alle Welt
„Offfnbar nur eine nichtige Ausgeburt der ſtillen Jahres-
ſſzeit iſt das Wiederauftauchen des Reichseiſenbahn-
brojekts. Es ſoll angeblich in Kiſſingen zwiſchen dem
0 Reichskanzler und den ihn beſuchenden bayeriſchen Staats-
irh ännern zur Beſprechung gekommen ſein. Man wird aber
196 ieſer gänzlich unbegründet auftretenden Nachricht nicht die
9½ windeſte Glaubwürdigkeit beimeſſen dürfen. Vor Jahren
zun dat ja dieſes Projekt die politiſchen Kreiſe längere Zeit be-
4 Gäftigt und die Gemüther, namentlich in den mittleren
4 Dundesſtaaten, mächtig in Bewegung geſetzt. Es liegt aber
icht der geringſte Anhalt zu der Annahme vor, daß ſeit-
niem dieſer Plan wieder ernſtlich in Erwägung gezogen
0 vorden ſei. Das Reichseiſenbahnprojekt tauchte zu einer
30 Jeit auf und war damals in weiten Kreiſen volksthümlich,
In Us in Deutſchland noch der Eiſenbahnbetrieb zum größten
Theil in den Händen von Privatgeſellſchaften war. Seit-
dem ſind aber die Verhältniſſe vollſtändig andere dadurch
ibſetworden, daß ſämmtliche deutſche Staaten, deren Gebiet
200 f. größeres Eiſenbahnnetz umſchließt, voran Preußen, die
3 erſtaatlichung ihrer Bahnen vollzogen haben, ſo daß gegen-
her durtig das Staatsbahnſyſtem in ganz Deutſchland nahezu
9 urchgeführt, die Privatwirthſchaft auf dieſem Gebiet auf
u denige, für den großen Verkehr nicht viel in Betracht kom-
umende Linien beſchränkt iſt und auch da wohl mit der Zeit
erihrem Ende entgegengehen wird. Durch die faſt vollendete
3 Verſtaatlichung der deutſchen Eiſenbahnen dürften die
chwierigkeiten für eine Ueberführung derſelben in Reichs-
+ beſitz nicht nur ins unüberwindliche geſtiegen ſein, ſie wür-
lic den vorausſichtlich ebenſowohl von Preußen als von den
+ Mittelſtaaten ausgehen, ſondern es iſt auch ein großer Theil
Verjenigen wirthſchaftlichen Gründe, welche einſt das Reichs-
. eiſenbahnprojekt empfohlen hatten, hinweggefallen.
Für die Erreichung der großen Ziele, welche ſich die
Aegierung für den nächſten Reichstag geſetzt hat, ſchreibt
e „Straßb. Poſt“, kommt nur Alles — auf die Unter-
buſkützung der Regierung Seitens der Parteien an. Ohne
1bDas Centrum würde ſchwerlich etwas zu erreichen ſein und
die Frage, „wie wird ſich das Centrum ſtellen?“ war da-
r niemals berechtigter und die Spannung auf die Ant-
2ig dort niemals größer als in dieſem Augenblick. Es iſt
Fudenfalls beachtenswerth, daß ultramontane Blätter
hgin den weſtlichen Provinzen die Frage aufwerfen, ob es
jan der Zeit ſei, das Centrum aufzulöſen. Dieſe
age wird nun in der geſammten ultamontanen Preſſe
rtert und bald bejahend, bald verneinend beantwortet.
(Iddenfalls wird man zunächſt „die weitere Reviſion der
Maigeſetz“ abwarten wollen. Nach allem, was man hört,
Jwäre die Regierung zu mancher weitgehenden Conceſſion
Abereit, doch wird man ſich keine Rechnung machen dürfen.
0u Mles oder auch nur die Mehrzahl der übertriebenen For-
irn derungen der Ultramontanen erfüllt zu ſehen. Vor dem
geſ Ferlangen, denſelben die Schule bedingungslos zu über-
laſſen, dürfte die Regierung, aller Wahrſcheinlichkeit nach,
unſentſchieden Halt machen.
Die Norddeutſche Allgemeine Zeitung bringt eine zeit-
I. Mwäße Betrachtung über die ultramontane Preſſe,
2 10 in wichtigen Fragen auf eigene Fauſt den Kampf
heterführen wolle, nachdem die maßgebenden Gewalten
Seits Frieden geſchloſſen. Den Ausführungen liegen
t
—
2
9
nehmen dieſer Betrachtung Folgendes:
Es iſt anzunehmen, daß die daraus für die Kirche entſprin-
geude Gefahr jetzt deutlicher erkannt wird, als bisher. Immer-
bin aber wird es den Biſchöfen nicht leicht werden, die jungen
Cleriker, deren Schreib⸗ und Streitfertigkeit in der Zeit des
kirchenpolitiſchen Kampfes breiteſte Verwendung fand, der Dis-
ciplin unterzuordnen, nachdem dieſelben Geſchmack daran gefunden
haben, eine leitende Rolle zu ſpielen. Aber wenn die Biſchöfe
ſich nur erſt von der Nothwendigkeit überzeugt haben. Wandel zu
ſchaffen, werden ſie auch erkennen, daß ein großer Theil der
Schwierigkeiten, welche ihnen dabei in den Weg treten, mehr in
der Vorſtellung als in der Wirklichkeit vorhanden iſt. Gewiß
hat die ſogenannte Kaplanspreſſe einen großen Einfluß auf die
katholiſche Bevölkernng ausgeübt, als dieſe Beeinfluſſung dem
kirchlichen Intereſſe von Nutzen zu ſein ſchien: aber das damit
gewonnene Preſtige konnte ſich doch nur ſo lange erhalten, als
die Vorausſetzun gen unerſchüttert blieben, auf welchen es ſich
aufbaute. Inzwiſchen hat der gebildete Theil der katholiſchen
Bevölkerung längſt ſchon innerlich das Joch abgeſchüttelt, welches
man während des kirchenpolitiſchen Conflikts um des confeſſionellen
Intereſſes willen ertrug, und nach Herſtellung des Friedens aus
dem Widerwillen gegen die Hetzpreſſe kein Hehl mehr gemacht.
Wenn dieſe jetzt voll Hochmuth und Eigenſinn fort-
fährt, den Frieden zu ſtören, weil nur der Krieg
ſie ernähren kann, und in Verfolgung dieſer Taktik ſich über
die Rückſichten hinwegſetzen zu können meint, die den geordneten
Autoritäten nicht verſagt werden ſollten, ſo wird bei der
Häufung ſolcher Confliktsfälle ſelbſt die im Ur-
theil wenig geübte Menge mit der Zeit inne wer-
den, daß man ſie auf Irrwegen feſtzuhalten be-
ſtrebt iſt, und ſich um ſo williger der Autorität des Hirten-
amts unterwerfen, je mehr die Führung der falſchen Hirten die
Segnungen des innern Friedens, die von der Verſtändigung des
Staats mit der Kirche zu erwarten ſind, zu gefährden droht.
In militäriſchen und politiſchen Kreiſen Oeſterreich-
Ungarns erregt der Rücktritt des Landescommandirenden
Baron Edelsheim⸗Gyulai das größte Aufſehen.
Ueber die Motive des Rücktritts des Generals verlautet
zwar Verſchiedenes, doch geht man in der Annahme nicht
fehl, daß die Demiſſion im Zuſammenhange mit der
Janski⸗Affaire ſteht. Der Miniſterpräſident Tisza berief
ſich bekanntlich bei der Beurtheilung des Verhaltens des
Generals Janski auf eine hohe militäriſche Perſönlichkeit,
unter der, wie ſchon damals angedeutet wurde, der
Landescommandirende gemeint war. Es ſcheint aber, daß
die Uebereinſtimmung Edelsheim's mit Tisza in den höch-
ſten Kreiſen nicht gebilligt wurde; der General wurde zur
Abgabe von Erklärungen nach Wien berufen. Der Rück-
tritt deſſelben gewinnt durch das gleichzeitige Avancement
des Generals Janski einen ſehr deutlichen Charakter, der
durch die Verſetzung Janski's und eine „beſondere Aus-
zeichnung“ Edelsheim's kaum alterirt wird. Wenn von
Wien gemeldet wird, daß die Stellung Tisza's
trotzdem nicht für erſchüttert gelte, ſo darf man wohl an-
nehmen, daß mit den oben gekennzeichneten Maßregeln die
letzten Conſequenzen der leidigen Janski⸗Affaire gezo-
gen ſind.
Die geſtern von König Milan zur Eröffnung der
Skupſchtina gehaltene Thronrede klingt ziemlich ent-
ſagungsvoll. Zwar iſt es nicht ehrlich, wenn ſie über den
Beginn des ſerbiſch⸗bulgariſchen Krieges ſagt, daß Serbien
gezwungen war, „den von Bulgarien geſchaffenen Zuſtand
offener Feindſeligkeiten anzunehmen“, aber überraſchen wird
das bei dem Rufe, den die ſerbiſche Politik genießt, Nie-
manden. Ueber den Schluß des Friedens, ohne etwas er-
reicht zu haben, wird geſagt, daß Serbien den Wünſchen
nicht wüßte, daß die jämmerlichen Hiebe, welche es von
dem Battenberger empfangen, dabei die größte Rolle ge-
ſpielt haben. In der Thronrede wird ferner feſtgeſtellt,
daß die Beziehungen zu Bulgarien nach dem Kriege die
gleichen wie vor dem Kriege, zu den übrigen europätſchen
Mächten aber die freundſchaftlichſten ſeien, und daß der
König dieſelben auch in der Zukunft aufmerkſam pflegen
werde.
Deutſches Reich.
◻Karlsruhe, 19. Juli. 10. Sitzung der General-
ſynode. Der Vorſitzende, Geheimerath Lamey, theilt
mit, daß auf der Mainau der Großherzog den Präla-
ten Doll beauftragt habe, der Synode herzliche Grüße zu
bringen und beizufügen, daß auch für den Schlußgottes-
dienſt die Schloßkirche zur Verfügung ſtehe. Sodann be-
richtet Dekan Frank über den Antrag 1) bezüglich der
Pfarrwittwenkaſſe: Die Synode wolle die Verwal-
tungsrechnungen derſelben für 1881 1885 für unbean-
ſtandet erklären. Ohne Debatte genehmigt. Ueber den An-
trag 2): Die Synode wolle dem Oberkirchenrath den Wunſch
nach Aufbeſſerung der Pfarrwittwenverſorgung ausſprechen
und dieſem das bezügliche Material zur Berückſichtigung
empfehlen, berichtet Gerichtsnotar Sev in. O.⸗K.⸗Raths-
Präſident v. Stöſſer ſtimmt dieſem Antrag vollkommen
zu und verbreitet ſich über eine auf die Pfarrwittwenange-
legenheit bezügliche Denkſchrift, welche vielfach auf irrigen,
ja keineswegs unbedenklichen Vorausſetzungen beruhe. Die
Verſorgung der Pfarrhinterbliebenen ſei eine der theuerſten
Sorgen des Oberkirchenraths. Dekan Schellenberg er-
klärt, daß die Denkſchrift nicht auf Mißtrauen gegen den
Oberkirchenrath beruhe und die Unterzeichner, wenn ſie den
Wegfall der Gratiale wünſchten, dieſelben in die geſetzliche
Penſion übernommen wiſſen wollten. Es ſei für Pfarrer
und für Wittwe drückend, wegen 100 Mark Gratial zur
Bloslegung der innerſten Verhältniſſe ſchreiten zu müſſen.
Dekan Wöttlin ſchließt ſich dem an. Abg. Kiefer: Es
ſei heute geſagt worden, der Staat müſſe helfen. Der aber
ziehe ſein Geld aus den Steuern beider Bekenntniſſe und
da er ſich nur nach realen Rechtsgeſichtspunkten richten
dürfe, ſo werde er, da die katholiſche Kirche keine Pfarr-
wittwen kenne, ſich in dieſer Sache ſehr ſpröd und zurück-
haltend benehmen müſſen. Er warne daher vor eitlen Hoff-
nungen. Uebrigens habe ja der Kultusminiſter auf dem
letzten Landtag erklärt, er glaube der nächſten Tagung eine
Vorlage über Einführung der lokalen Kirchenſteuer machen
zu können. Der Antrag wird angenommen. Hierauf wurde
auf Vortrag des Abg. Amortiſationskaſſedirectors Helm
die Rechnung der Centralpfarrkaſſe, des Pfründevermögens
und der Bericht über die Einkommensſteuerverhältniſſe der
Geiſtlichen genehmigt. Schließlich berieth das Haus über
den Bericht des Abg. Stein in Betreff der Petition der
Filialpfarrer um Aufbeſſerung der Vergütungen für die
Verſehung von Filialen. Antrag des Ausſchuſſes: Ueber-
weiſung der Petition zur Kenntnißnahme und Prüfung der
in derſelben angeführten Umſtände. Wird nach längerer
nichts Erhebliches zu Tage bringender Debatte angenommen.
Nächſte Sitzung Dienstag.
——
Verlorene Ehre.
Roman von W. Höffer.
4 (Fortſetzung.)
ar Herr von Holling hatte aus London geſchrieben und ihm,
106 handle es ſich um ein freundſchaftliches Darlehen, für
Jene Hilfe in der Noth gedankt.
54, „Ich ſehe mich einem meinen Gewohnheiten und Nei-
6 ungen beſſer entſprechenden Leben wieder zurückgegeben,“
iate er am Schluſſe dieſes Briefes. „Hoffentlich werde
0 fernerhin der Nothwendigkeit, jemals Deutſchland zu be-
ö Whren und Ihre erprobte Gaſtfreundlichkeit in Anſpruch zu
Iiehmen, ganz überhoben ſein. Mich Ihnen empfehlend,
Iiſage ich mir aus Delicateſſe diejenigen wärmſten Grüße,
eiche mein Herz Ihrer liebenswürdigen Gemahlin zu ſen-
2 5 wünſcht, halte mich indeſſen vollkommen überzeugt, daß
0 0 arme Emilie meinetwegen keine unangenehme Stunde zu
16 deragen hatte. Ein Gentleman ſieht über dergleichen hin-
Veg, namentlich wenn es gilt die Oeffentlichkeit zu düpiren.“
ul.Julius warf den Brief von ſich, als habe er durch das
Amante, parfümirte Papier ſeine Finger verbrannt. Im
paublic loderte der Schmerz empor zu nie erreichter Höhe,
1ier aber entſtand aus dem Chaos der Gedanken immer
uder die Frage, ob er nicht gegen ſeine unglückliche Frau
1Ue hart geweſen ſei. Was mußte ſie leiden, wenn er in's
aus kam, ohne jemals nach ihr zu fragen.
Walter hatte ſie kürzlich geſehen und ihm erzählt, die
wäbende ſchöne Frau ſei nur noch gleichſam der Schatten
ö 0 einſt Geweſenen. Er würde ſie, ohne die beſtimmte
erzeugung, daß ſie es ſei, nicht wiedererkannt haben.
Julius ſtützte den Kopf in die Hand und ſah Stunden
lang grübelnd vor ſich hin. Es gab aus dieſen Wirniſſen
keine Erlöſung; jedes gütige Wort von ihm konnte neue,
unerfüllbare Hoffnungen erwecken, jede Annäherung mußte
Irrthümer mit ſich führen. Sollte er ihr ſagen: „Es iſt
zwiſchen uns keine Gemeinſchaft mehr möglich, ich habe auf-
gehört, Dich zu lieben, aber ich will barmherzig handeln,
will verzeihen?“ — Das hieße Gift in die Wunde
träufeln, denn ihre Seele liebte ihn, er war ihr Alles, das
Leben von ihrem Leben; ſein Mitleid mußte ſie zum Wahn-
ſinn treiben.
Und wieder ſagte er ſich, daß es ſo am beſten ſei, aber
er war nicht ruhig, indem er das dachte. Walter's Er-
zählung hatte ſein Inneres furchtbar erſchüttert.
Julius hielt ſich, überreizt wie er war, halb und halb
für den Mörder ſeiner unglücklichen jungen Frau.
Wochen vergingen im tödtenden Einerlei, der November-
ſturm ſchüttelte die letzten welken Blätter herab auf Tante
Joſephinens Gruft, und wieder nahte der Weihnachtsabend,
aber diesmal troſtloſer, öder als je.
„Ich komme nicht, Mama,“ hatte Julius geſagt. „Ich
kann es nicht über mein Herz bringen — Gott helfe uns
Allen !“
Die Kranke legte ihre heiße Hand auf ſeinen Arm.
Aber er ſchüttelte den Kopf.
„Julius,“ hörte er ihre Simme, „wenn Du Dich ent-
ſchließen könnteſt, ſie zu ſehen!“
„Wozu, Mama? — Es wäre eine Folter für uns
Beide. Glaub' mir, ich bin nicht weniger unglücklich als
ſie ſelbſt.“ ö
„Wirſt Du denn morgen Abend überhaupt nicht hier-
herkommen, Julius? — O, wäre dieſer Tag erſt
hinter mir!“
Sie zitterte und ihre Augen füllten ſich mit Thränen.
Er wußte, was ſie dachte: „Der letzte heilige Abend für
mich, und ſo traurig, ſo einſam!“
„Mutter,“ ſagte er ſeufzend, „iſt es Dein Wunſch, ſo
komme ich zu Dir, aber —“
„Nein,“ unterbrach ſie ihn, „nein, nicht ſo, nicht zu
mir allein — das wäre Grauſamkeit! O mein lieber Junge
— Gott ſchütze Dich vor Reue!“
Ihre Hände lagen länger als gewöhnlich in einander,
die Herzen waren ſchwer und traurig. Julius vermochte
nicht, ſich loszureißen, und als er endlich widerſtrebend fort-
ging, da geſchah es zögernd, unruhig, voll heimlicher Sorge.
„Mutter,“ bat er faſt wie ein Kind, „Mutter, Du
ſollſt mir nicht grollen!“
„Ich Dir? — O mein Sohn, mein armer Sohn, ich
Dir 2*
Er küßte ſie, in's Herz getroffen von dieſem Ton voll
zärtlicher Liebe, und dann ging er fort, um ſich, wie ſo
oft in letzterer Zeit, einzuſchliezen und ſtumm, mit geſtütz-
tem Kopf, dazuſitzen — ein Menſch, der Alles verloren
hatte, ſogar die Hoffnung, ſogar den Muth.
Doctor Berger wurde brieflich benachrichtigt, Julius
ſelbſt ging nicht aus. Die Weihnachtsfreude rings umher
ſchien ihn zu beleidigen, zu verhöhnen; er wollte nicht gefragt
werden und wollte keinen frohen, glücklichen Menſchen ſehen.
Im dunkeln Zimmer, hinter herabgelaſſenen Vorhängen
ſitzend, gab er ſich ſeinen trüben Gedanken widerſtandslos