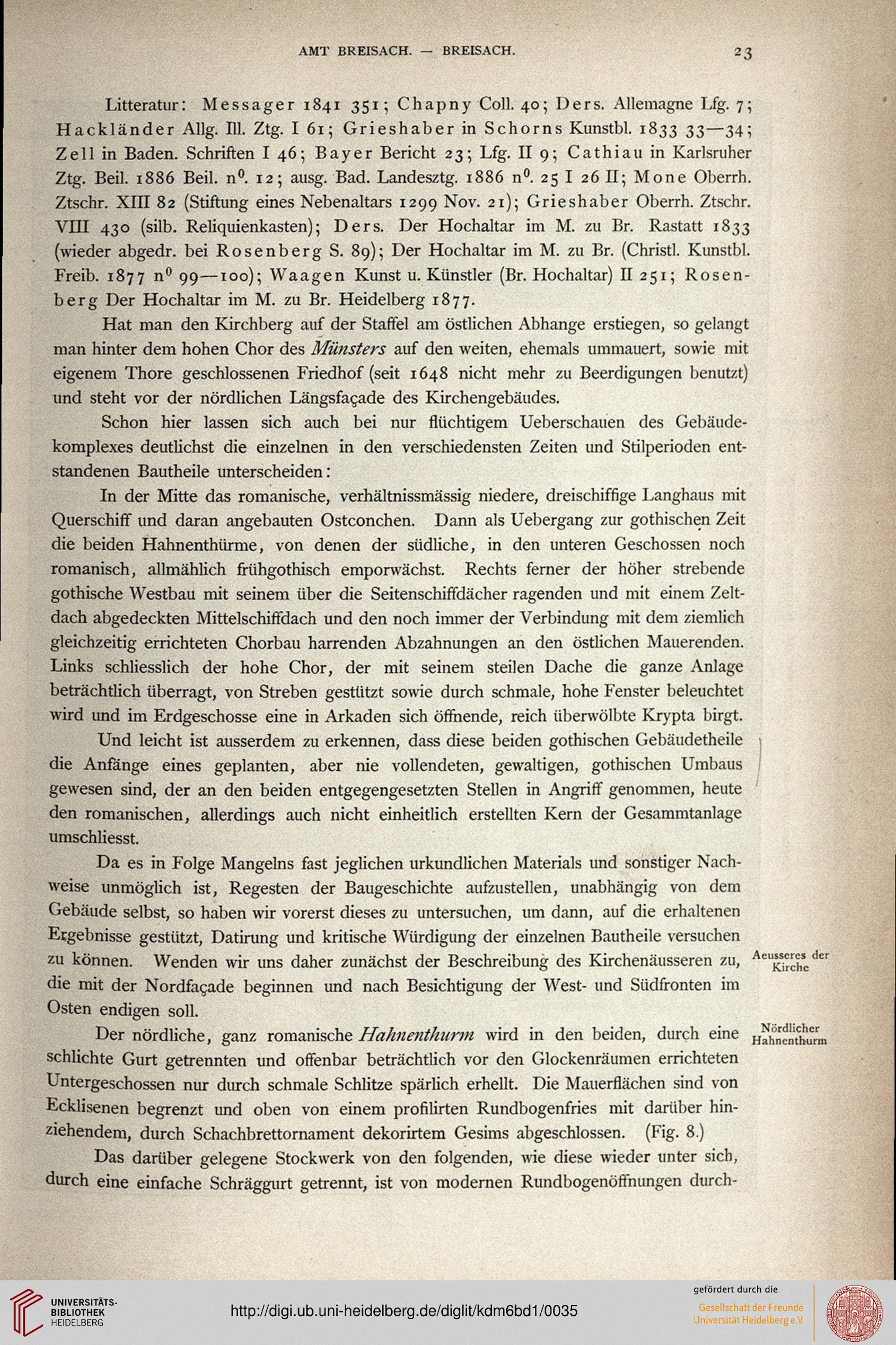AMT BREISACH. — BREISACH. 23
Litteratur: Messager 1841 351; Chapny Coli. 40; Ders. Allemagne Lfg. 7;
Hackiänder Allg. 111. Ztg. I 61; GrieshaberinSchorns Kunstbl. 1833 33—34;
Zell in Baden. Schriften I 46; Bayer Bericht 23; Lfg. II 9; Cathiau in Karlsruher
Ztg. Beil. 1886 Beil. n°. 125 ausg. Bad. Landesztg. 1886 n°. 25 I 26 II; Mone Oberrh.
Ztschr. XIII 82 (Stiftung eines Nebenaltars 1299 Nov. 21); Grieshaber Oberrh. Ztschr.
VIII 430 (silb. Reliquienkasten); Ders. Der Hochaltar im M. zu Br. Rastatt 1833
(wieder abgedr. bei Rosenberg S. 89); Der Hochaltar im M. zu Br. (Christi. Kunstbl.
Freib. 1877 n° 99—100); Waagen Kunst u. Künstler (Br. Hochaltar) II 251; Rosen-
berg Der Hochaltar im M. zu Br. Heidelberg 1877.
Hat man den Kirchberg auf der Staffel am östlichen Abhänge erstiegen, so gelangt
man hinter dem hohen Chor des Münsters auf den weiten, ehemals ummauert, sowie mit
eigenem Thore geschlossenen Friedhof {seit 1648 nicht mehr zu Beerdigungen benutzt)
und steht vor der nördlichen Längsfacade des Kirchengebäudes.
Schon hier lassen sich auch bei nur flüchtigem Ueberschauen des Gebäude-
komplexes deutlichst die einzelnen in den verschiedensten Zeiten und Stilperioden ent-
standenen Bautheile unterscheiden:
In der Mitte das romanische, verhältnissmässig niedere, dreischiffige Langhaus mit
Querschiff und daran angebauten Ostconchen. Dann als Uebergang zur gothischen Zeit
die beiden Hahnenthürme, von denen der südliche, in den unteren Geschossen noch
romanisch, allmählich frühgothisch emporwächst. Rechts femer der höher strebende
gothische Westbau mit seinem über die Seitenschiffdächer ragenden und mit einem Zelt-
dach abgedeckten Mittelschiffdach und den noch immer der Verbindung mit dem ziemlich
gleichzeitig errichteten Chorbau harrenden Abzahnungen an den östlichen Mauerenden.
Links schliesslich der hohe Chor, der mit seinem steilen Dache die ganze Anlage
beträchtlich überragt, von Streben gestützt sowie durch schmale, hohe Fenster beleuchtet
wird und im Erdgeschosse eine in Arkaden sich öffnende, reich überwölbte Krypta birgt.
Und leicht ist ausserdem zu erkennen, dass diese beiden gothischen Gebäudetheile j
die Anfänge eines geplanten, aber nie vollendeten, gewaltigen, gothischen Umbaus
gewesen sind, der an den beiden entgegengesetzten Stellen in Angriff genommen, heute
den romanischen, allerdings auch nicht einheitlich erstellten Kern der Gesammtanlage
umschliesst.
Da es in Folge Mangeins fast jeglichen urkundlichen Materials und sonstiger Nach-
weise unmöglich ist, Regesten der Baugeschichte aufzustellen, unabhängig von dem
Gebäude selbst, so haben wir vorerst dieses zu untersuchen, um dann, auf die erhaltenen
Begebnisse gestützt, Datirung und kritische Würdigung der einzelnen Bautheile versuchen
zu können. Wenden wir uns daher zunächst der Beschreibung des Kirchenäusseren zu, A(
die mit der Nordfacade beginnen und nach Besichtigung der West- und Südfronten im
Osten endigen soll.
Der nördliche, ganz romanische Hahnenthurm wird in den beiden, durch eine H'
schlichte Gurt getrennten und offenbar beträchtlich vor den Glockenräumen errichteten
Untergeschossen nur durch schmale Schlitze spärlich erhellt. Die Mauerflächen sind von
Ecklisenen begrenzt und oben von einem profUirten Rundbogenfries mit darüber hin-
ziehendem, durch Schachbrettornament dekorirtem Gesims abgeschlossen. (Fig. 8.)
Das darüber gelegene Stockwerk von den folgenden, wie diese wieder unter sich,
durch eine einfache Schräggurt getrennt, ist von modernen Rundbogenöffnungen durch-
Litteratur: Messager 1841 351; Chapny Coli. 40; Ders. Allemagne Lfg. 7;
Hackiänder Allg. 111. Ztg. I 61; GrieshaberinSchorns Kunstbl. 1833 33—34;
Zell in Baden. Schriften I 46; Bayer Bericht 23; Lfg. II 9; Cathiau in Karlsruher
Ztg. Beil. 1886 Beil. n°. 125 ausg. Bad. Landesztg. 1886 n°. 25 I 26 II; Mone Oberrh.
Ztschr. XIII 82 (Stiftung eines Nebenaltars 1299 Nov. 21); Grieshaber Oberrh. Ztschr.
VIII 430 (silb. Reliquienkasten); Ders. Der Hochaltar im M. zu Br. Rastatt 1833
(wieder abgedr. bei Rosenberg S. 89); Der Hochaltar im M. zu Br. (Christi. Kunstbl.
Freib. 1877 n° 99—100); Waagen Kunst u. Künstler (Br. Hochaltar) II 251; Rosen-
berg Der Hochaltar im M. zu Br. Heidelberg 1877.
Hat man den Kirchberg auf der Staffel am östlichen Abhänge erstiegen, so gelangt
man hinter dem hohen Chor des Münsters auf den weiten, ehemals ummauert, sowie mit
eigenem Thore geschlossenen Friedhof {seit 1648 nicht mehr zu Beerdigungen benutzt)
und steht vor der nördlichen Längsfacade des Kirchengebäudes.
Schon hier lassen sich auch bei nur flüchtigem Ueberschauen des Gebäude-
komplexes deutlichst die einzelnen in den verschiedensten Zeiten und Stilperioden ent-
standenen Bautheile unterscheiden:
In der Mitte das romanische, verhältnissmässig niedere, dreischiffige Langhaus mit
Querschiff und daran angebauten Ostconchen. Dann als Uebergang zur gothischen Zeit
die beiden Hahnenthürme, von denen der südliche, in den unteren Geschossen noch
romanisch, allmählich frühgothisch emporwächst. Rechts femer der höher strebende
gothische Westbau mit seinem über die Seitenschiffdächer ragenden und mit einem Zelt-
dach abgedeckten Mittelschiffdach und den noch immer der Verbindung mit dem ziemlich
gleichzeitig errichteten Chorbau harrenden Abzahnungen an den östlichen Mauerenden.
Links schliesslich der hohe Chor, der mit seinem steilen Dache die ganze Anlage
beträchtlich überragt, von Streben gestützt sowie durch schmale, hohe Fenster beleuchtet
wird und im Erdgeschosse eine in Arkaden sich öffnende, reich überwölbte Krypta birgt.
Und leicht ist ausserdem zu erkennen, dass diese beiden gothischen Gebäudetheile j
die Anfänge eines geplanten, aber nie vollendeten, gewaltigen, gothischen Umbaus
gewesen sind, der an den beiden entgegengesetzten Stellen in Angriff genommen, heute
den romanischen, allerdings auch nicht einheitlich erstellten Kern der Gesammtanlage
umschliesst.
Da es in Folge Mangeins fast jeglichen urkundlichen Materials und sonstiger Nach-
weise unmöglich ist, Regesten der Baugeschichte aufzustellen, unabhängig von dem
Gebäude selbst, so haben wir vorerst dieses zu untersuchen, um dann, auf die erhaltenen
Begebnisse gestützt, Datirung und kritische Würdigung der einzelnen Bautheile versuchen
zu können. Wenden wir uns daher zunächst der Beschreibung des Kirchenäusseren zu, A(
die mit der Nordfacade beginnen und nach Besichtigung der West- und Südfronten im
Osten endigen soll.
Der nördliche, ganz romanische Hahnenthurm wird in den beiden, durch eine H'
schlichte Gurt getrennten und offenbar beträchtlich vor den Glockenräumen errichteten
Untergeschossen nur durch schmale Schlitze spärlich erhellt. Die Mauerflächen sind von
Ecklisenen begrenzt und oben von einem profUirten Rundbogenfries mit darüber hin-
ziehendem, durch Schachbrettornament dekorirtem Gesims abgeschlossen. (Fig. 8.)
Das darüber gelegene Stockwerk von den folgenden, wie diese wieder unter sich,
durch eine einfache Schräggurt getrennt, ist von modernen Rundbogenöffnungen durch-