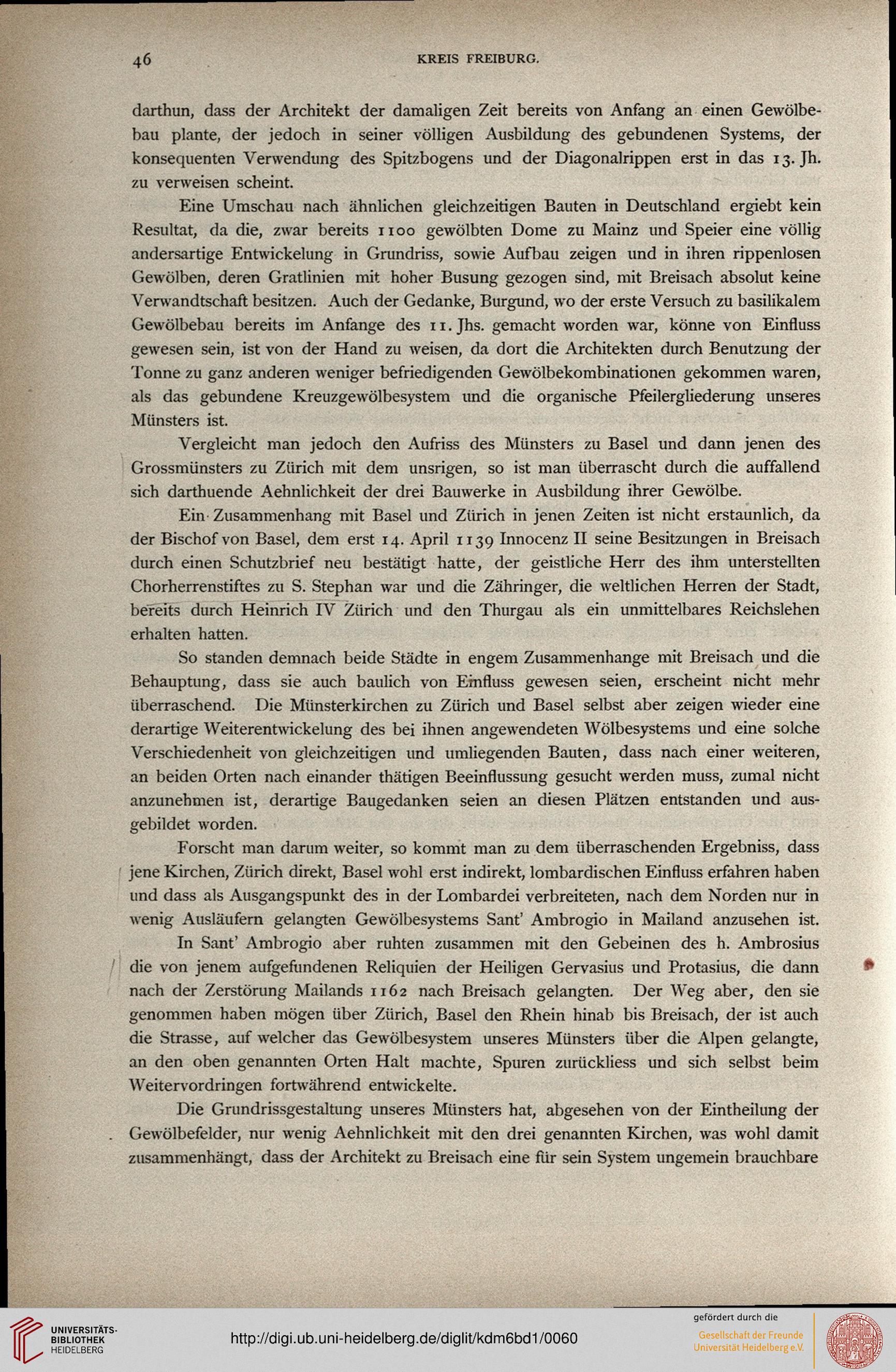46 KREIS FREIBÜRG.
darthun, dass der Architekt der damaligen Zeit bereits von Anfang an einen Gewölbe-
bau plante, der jedoch in seiner völligen Ausbildung des gebundenen Systems, der
konsequenten Verwendung des Spitzbogens und der Diagonalrippen erst in das 13. Jh.
zu verweisen scheint.
Eine Umschau nach ähnlichen gleichzeitigen Bauten in Deutschland ergiebt kein
Resultat, da die, zwar bereits 1100 gewölbten Dome zu Mainz und Speier eine völlig
andersartige Entwickelung in Grundriss, sowie Aufbau zeigen und in ihren rippenlosen
Gewölben, deren Gratlinien mit hoher Busung gezogen sind, mit Breisach absolut keine
Verwandtschaft besitzen. Auch der Gedanke, Burgund, wo der erste Versuch zu basilikalem
Gewölbebau bereits im Anfange des 11. Jhs. gemacht worden war, könne von Einfluss
gewesen sein, ist von der Hand zu weisen, da dort die Architekten durch Benutzung der
Tonne zu ganz anderen weniger befriedigenden Gewölbekombinationen gekommen waren,
als das gebundene Kreuzgewölbesystem und die organische Pfeilergliederung unseres
Münsters ist.
Vergleicht man jedoch den Aufriss des Münsters zu Basel und dann jenen des
Grossmünsters zu Zürich mit dem unsrigen, so ist man überrascht durch die auffallend
sich darthuende Aehnlichkeit der drei Bauwerke in Ausbildung ihrer Gewölbe.
Ein' Zusammenhang mit Basel und Zürich in jenen Zeiten ist nicht erstaunlich, da
der Bischof von Basel, dem erst 14. April 1139 Innocenz II seine Besitzungen in Breisach
durch einen Schutzbrief neu bestätigt hatte, der geistliche Herr des ihm unterstellten
Chorherrenstiftes zu S. Stephan war und die Zähringer, die weltlichen Herren der Stadt,
bereits durch Heinrich IV Zürich und den Thurgau als ein unmittelbares Reichslehen
erhalten hatten.
So standen demnach beide Städte in engem Zusammenhange mit Breisach und die
Behauptung, dass sie auch baulich von Emfluss gewesen seien, erscheint nicht mehr
überraschend. Die Münsterkirchen zu Zürich und Basel selbst aber zeigen wieder eine
derartige Weiterentwickelung des bei ihnen angewendeten Wölbesystems und eine solche
Verschiedenheit von gleichzeitigen und umliegenden Bauten, dass nach einer weiteren,
an beiden Orten nach einander thätigen Beeinflussung gesucht werden muss, zumal nicht
anzunehmen ist, derartige Baugedanken seien an diesen Plätzen entstanden und aus-
gebildet worden.
Forscht man darum weiter, so kommt man zu dem überraschenden Ergebniss, dass
jene Kirchen, Zürich direkt, Basel wohl erst indirekt, lombardischen Einfluss erfahren haben
und dass als Ausgangspunkt des in der Lombardei verbreiteten, nach dem Norden nur in
wenig Ausläufern gelangten Gewölbesystems Sant' Ambrogio in Mailand anzusehen ist.
In Sant' Ambrogio aber ruhten zusammen mit den Gebeinen des h. Ambrosius
die von jenem aufgefundenen Reliquien der Heiligen Gervasius und Protasius, die dann
nach der Zerstörung Mailands 1162 nach Breisach gelangten. Der Weg aber, den sie
genommen haben mögen über Zürich, Basel den Rhein hinab bis Breisach, der ist auch
die Strasse, auf welcher das Gewölbesystem unseres Münsters über die Alpen gelangte,
an den oben genannten Orten Halt machte, Spuren zurückliess und sich selbst beim
Weitervordringen fortwährend entwickelte.
Die Grundrissgestaltung unseres Münsters hat, abgesehen von der Eintheilung der
Gewölbefelder, nur wenig Aehnlichkeit mit den drei genannten Kirchen, was wohl damit
zusammenhängt, dass der Architekt zu Breisach eine für sein System ungemein brauchbare
darthun, dass der Architekt der damaligen Zeit bereits von Anfang an einen Gewölbe-
bau plante, der jedoch in seiner völligen Ausbildung des gebundenen Systems, der
konsequenten Verwendung des Spitzbogens und der Diagonalrippen erst in das 13. Jh.
zu verweisen scheint.
Eine Umschau nach ähnlichen gleichzeitigen Bauten in Deutschland ergiebt kein
Resultat, da die, zwar bereits 1100 gewölbten Dome zu Mainz und Speier eine völlig
andersartige Entwickelung in Grundriss, sowie Aufbau zeigen und in ihren rippenlosen
Gewölben, deren Gratlinien mit hoher Busung gezogen sind, mit Breisach absolut keine
Verwandtschaft besitzen. Auch der Gedanke, Burgund, wo der erste Versuch zu basilikalem
Gewölbebau bereits im Anfange des 11. Jhs. gemacht worden war, könne von Einfluss
gewesen sein, ist von der Hand zu weisen, da dort die Architekten durch Benutzung der
Tonne zu ganz anderen weniger befriedigenden Gewölbekombinationen gekommen waren,
als das gebundene Kreuzgewölbesystem und die organische Pfeilergliederung unseres
Münsters ist.
Vergleicht man jedoch den Aufriss des Münsters zu Basel und dann jenen des
Grossmünsters zu Zürich mit dem unsrigen, so ist man überrascht durch die auffallend
sich darthuende Aehnlichkeit der drei Bauwerke in Ausbildung ihrer Gewölbe.
Ein' Zusammenhang mit Basel und Zürich in jenen Zeiten ist nicht erstaunlich, da
der Bischof von Basel, dem erst 14. April 1139 Innocenz II seine Besitzungen in Breisach
durch einen Schutzbrief neu bestätigt hatte, der geistliche Herr des ihm unterstellten
Chorherrenstiftes zu S. Stephan war und die Zähringer, die weltlichen Herren der Stadt,
bereits durch Heinrich IV Zürich und den Thurgau als ein unmittelbares Reichslehen
erhalten hatten.
So standen demnach beide Städte in engem Zusammenhange mit Breisach und die
Behauptung, dass sie auch baulich von Emfluss gewesen seien, erscheint nicht mehr
überraschend. Die Münsterkirchen zu Zürich und Basel selbst aber zeigen wieder eine
derartige Weiterentwickelung des bei ihnen angewendeten Wölbesystems und eine solche
Verschiedenheit von gleichzeitigen und umliegenden Bauten, dass nach einer weiteren,
an beiden Orten nach einander thätigen Beeinflussung gesucht werden muss, zumal nicht
anzunehmen ist, derartige Baugedanken seien an diesen Plätzen entstanden und aus-
gebildet worden.
Forscht man darum weiter, so kommt man zu dem überraschenden Ergebniss, dass
jene Kirchen, Zürich direkt, Basel wohl erst indirekt, lombardischen Einfluss erfahren haben
und dass als Ausgangspunkt des in der Lombardei verbreiteten, nach dem Norden nur in
wenig Ausläufern gelangten Gewölbesystems Sant' Ambrogio in Mailand anzusehen ist.
In Sant' Ambrogio aber ruhten zusammen mit den Gebeinen des h. Ambrosius
die von jenem aufgefundenen Reliquien der Heiligen Gervasius und Protasius, die dann
nach der Zerstörung Mailands 1162 nach Breisach gelangten. Der Weg aber, den sie
genommen haben mögen über Zürich, Basel den Rhein hinab bis Breisach, der ist auch
die Strasse, auf welcher das Gewölbesystem unseres Münsters über die Alpen gelangte,
an den oben genannten Orten Halt machte, Spuren zurückliess und sich selbst beim
Weitervordringen fortwährend entwickelte.
Die Grundrissgestaltung unseres Münsters hat, abgesehen von der Eintheilung der
Gewölbefelder, nur wenig Aehnlichkeit mit den drei genannten Kirchen, was wohl damit
zusammenhängt, dass der Architekt zu Breisach eine für sein System ungemein brauchbare