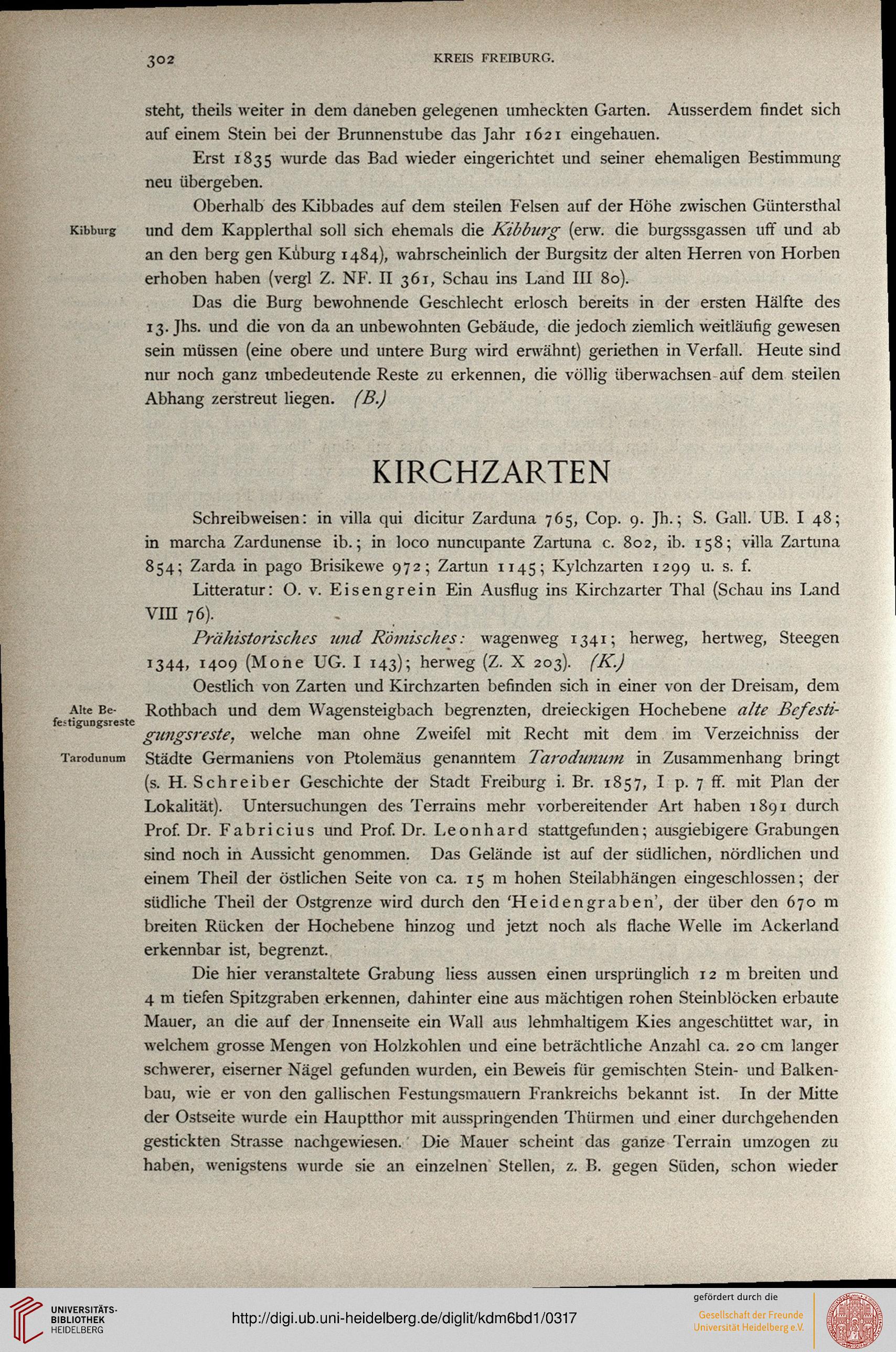302 KREIS FREIBURG.
steht, theils weiter in dem daneben gelegenen umheckten Garten. Ausserdem findet sich
auf einem Stein bei der Brunnenstube das Jahr 16 21 eingehauen.
Erst 1835 wurde das Bad wieder eingerichtet und seiner ehemaligen Bestimmung
neu übergeben.
Oberhalb des Kibbades auf dem steilen Felsen auf der Höhe zwischen Güntersthal
und dem Kapplerthal soll sich ehemals die Kihburg (erw. die burgssgassen uff und ab
an den berg gen Küburg 1484), wahrscheinlich der Burgsitz der alten Herren von Horben
erhoben haben (vergl Z. NF. II 361, Schau ins Land III 80).
Das die Burg bewohnende Geschlecht erlosch bereits in der ersten Hälfte des
13. Jhs. und die von da an unbewohnten Gebäude, die jedoch ziemlich weitläufig gewesen
sein müssen (eine obere und untere Burg wird erwähnt) geriethen in Verfall. Heute sind
nur noch ganz unbedeutende Reste zu erkennen, die völlig überwachsen auf dem steilen
Abhang zerstreut Hegen. (B.)
KIRCHZARTEN
Schreibweisen: in villa qui dicitur Zardnna 765, Cop. 9. Jh.; S. Gall. ÜB. I 48;
in marcha Zardunense ib.; in loco nuncupante Zartuna c. 802, ib. 158; villa Zartuna
854; Zarda in pago Brisikewe 972; Zartun 1145; Kylchzarten 1299 u. s. f.
Litteratur: O. v. Eisengrein Ein Ausflug ins Kirchzarter Thal (Schau ins Land
VIII 76).
Prähistorisches und Römisches: wagenweg 1341; herweg, hertweg, Steegen
1344, 1409 (Mone UG. I 143); herweg (Z. X 203). (K.)
Oestlich von Zarten und Kirchzarten befinden sich in einer von der Dreisam, dem
Alte Be- Rothbach und dem Wagensteigbach begrenzten, dreieckigen Hochebene alte Befesti-
gungsreste, welche man ohne Zweifel mit Recht mit dem im Verzeichniss der
Tnrodumim Städte Germaniens von Ptolemäus genanntem Tarodunum in Zusammenhang bringt
(s. H. Schreiber Geschichte der Stadt Freiburg i. Br. 1857, I p. 7 ff. mit Plan der
Lokalität). Untersuchungen des Terrains mehr vorbereitender Art haben 1891 durch
Prof. Dr. Fabricius und Prof. Dr. Leonhard stattgefunden; ausgiebigere Grabungen
sind noch in Aussicht genommen. Das Gelände ist auf der südlichen, nördlichen und
einem Theil der östlichen Seite von ca. 15 m hohen Steilabhängen eingeschlossen; der
südliche Theil der Ostgrenze wird durch den 'Heidengraben', der über den 670 m
breiten Rücken der Hochebene hinzog und jetzt noch als flache Welle im Ackerland
erkennbar ist, begrenzt.
Die hier veranstaltete Grabung Hess aussen einen ursprünglich 12 m breiten und
4 m tiefen Spitzgraben erkennen, dahinter eine aus mächtigen rohen Steinblöcken erbaute
Mauer, an die auf der Innenseite ein Wall aus lehmhaltigem Kies angeschüttet war, in
welchem grosse Mengen von Holzkohlen und eine beträchtliche Anzahl ca. 20 cm langer
schwerer, eiserner Nägel gefunden wurden, ein Beweis für gemischten Stein- und Batken-
bau, wie er von den gallischen Festungsmauern Frankreichs bekannt ist. In der Mitte
der Ostseite wurde ein Hauptthor mit ausspringenden Thürmen und einer durchgehenden
gestickten Strasse nachgewiesen. Die Mauer scheint das ganze Terrain umzogen zu
haben, wenigstens wurde sie an einzelnen Stellen, z. R. gegen Süden, schon wieder
steht, theils weiter in dem daneben gelegenen umheckten Garten. Ausserdem findet sich
auf einem Stein bei der Brunnenstube das Jahr 16 21 eingehauen.
Erst 1835 wurde das Bad wieder eingerichtet und seiner ehemaligen Bestimmung
neu übergeben.
Oberhalb des Kibbades auf dem steilen Felsen auf der Höhe zwischen Güntersthal
und dem Kapplerthal soll sich ehemals die Kihburg (erw. die burgssgassen uff und ab
an den berg gen Küburg 1484), wahrscheinlich der Burgsitz der alten Herren von Horben
erhoben haben (vergl Z. NF. II 361, Schau ins Land III 80).
Das die Burg bewohnende Geschlecht erlosch bereits in der ersten Hälfte des
13. Jhs. und die von da an unbewohnten Gebäude, die jedoch ziemlich weitläufig gewesen
sein müssen (eine obere und untere Burg wird erwähnt) geriethen in Verfall. Heute sind
nur noch ganz unbedeutende Reste zu erkennen, die völlig überwachsen auf dem steilen
Abhang zerstreut Hegen. (B.)
KIRCHZARTEN
Schreibweisen: in villa qui dicitur Zardnna 765, Cop. 9. Jh.; S. Gall. ÜB. I 48;
in marcha Zardunense ib.; in loco nuncupante Zartuna c. 802, ib. 158; villa Zartuna
854; Zarda in pago Brisikewe 972; Zartun 1145; Kylchzarten 1299 u. s. f.
Litteratur: O. v. Eisengrein Ein Ausflug ins Kirchzarter Thal (Schau ins Land
VIII 76).
Prähistorisches und Römisches: wagenweg 1341; herweg, hertweg, Steegen
1344, 1409 (Mone UG. I 143); herweg (Z. X 203). (K.)
Oestlich von Zarten und Kirchzarten befinden sich in einer von der Dreisam, dem
Alte Be- Rothbach und dem Wagensteigbach begrenzten, dreieckigen Hochebene alte Befesti-
gungsreste, welche man ohne Zweifel mit Recht mit dem im Verzeichniss der
Tnrodumim Städte Germaniens von Ptolemäus genanntem Tarodunum in Zusammenhang bringt
(s. H. Schreiber Geschichte der Stadt Freiburg i. Br. 1857, I p. 7 ff. mit Plan der
Lokalität). Untersuchungen des Terrains mehr vorbereitender Art haben 1891 durch
Prof. Dr. Fabricius und Prof. Dr. Leonhard stattgefunden; ausgiebigere Grabungen
sind noch in Aussicht genommen. Das Gelände ist auf der südlichen, nördlichen und
einem Theil der östlichen Seite von ca. 15 m hohen Steilabhängen eingeschlossen; der
südliche Theil der Ostgrenze wird durch den 'Heidengraben', der über den 670 m
breiten Rücken der Hochebene hinzog und jetzt noch als flache Welle im Ackerland
erkennbar ist, begrenzt.
Die hier veranstaltete Grabung Hess aussen einen ursprünglich 12 m breiten und
4 m tiefen Spitzgraben erkennen, dahinter eine aus mächtigen rohen Steinblöcken erbaute
Mauer, an die auf der Innenseite ein Wall aus lehmhaltigem Kies angeschüttet war, in
welchem grosse Mengen von Holzkohlen und eine beträchtliche Anzahl ca. 20 cm langer
schwerer, eiserner Nägel gefunden wurden, ein Beweis für gemischten Stein- und Batken-
bau, wie er von den gallischen Festungsmauern Frankreichs bekannt ist. In der Mitte
der Ostseite wurde ein Hauptthor mit ausspringenden Thürmen und einer durchgehenden
gestickten Strasse nachgewiesen. Die Mauer scheint das ganze Terrain umzogen zu
haben, wenigstens wurde sie an einzelnen Stellen, z. R. gegen Süden, schon wieder