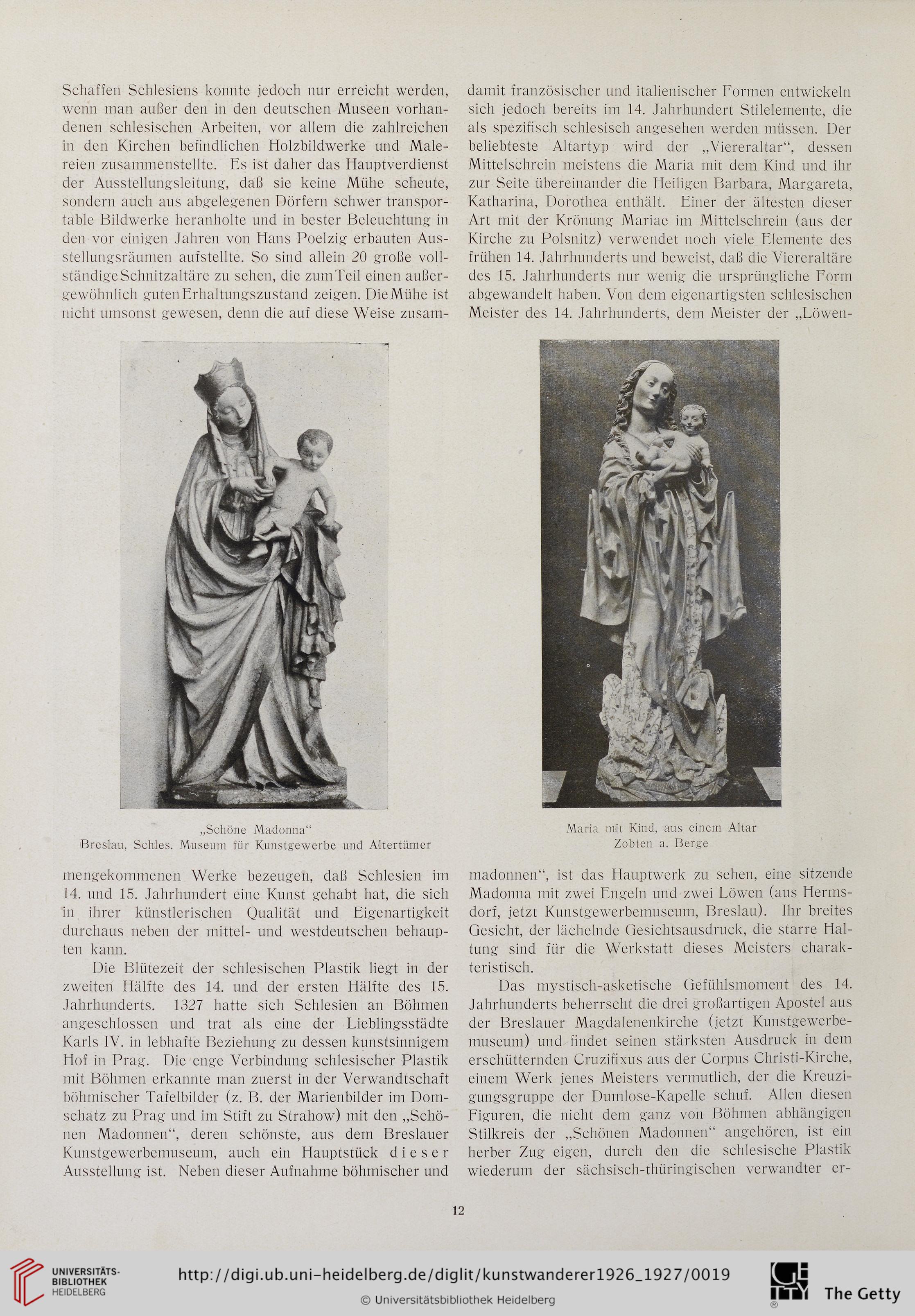Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 8./9.1926/27
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0019
DOI Heft:
1/2. Septemberheft
DOI Artikel:Kühnel-Kunze, Irene: Schlesische Malerei und Plastik des Mittelalters: Ausstellung in Breslau
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25876#0019
Schaffen Schlesiens konnte jedoch nur erreicht werden,
wenn man außer den in den deutschen Museen vorhan-
denen schlesischen Arbeiten, vor allem die zahlreichen
in den Kirchen befindlichen Holzbildwerke und Male-
reien zusammenstellte. Es ist daher das Hauptverdienst
der Ausstellungsleitung, daß sie keine Mühe scheute,
sondern auch aus abgelegenen Dörfern schwer transpor-
table Bildwerke heranholte und in bester Beleuchtung in
den vor einigen Jahren von Hans Poelzig erbauten Aus-
stellungsräumen aufstellte. So sind allein 20 große voll-
ständigeSchnitzaitäre zu sehen, die zumTeil einen außer-
gewöhnlich gutenErhaltungszustand zeigen. DieMühe ist
nicht umsonst gewesen, denn die auf diese Weise zusam-
damit französischer und italienischer Formen entwickeln
sich jedoch bereits im 14. Jahrhundert Stilelemente, die
als spezifisch schlesisch angesehen werden miissen. Der
beliebteste Altartyp wird der „Viereraltar“, dessen
Mittelschrein meistens die Maria mit dem Kind und ihr
zur Seite übereinander die Heiligen Barbara, Margareta,
Katharina, Dorothea enthält. Einer der ältesten dieser
Art mit der Krönung Mariae im Mittelschrein (aus der
Kirche zu Polsnitz) verwendet noch viele Elemente des
frühen 14. Jahrhunderts und beweist, daß die Viereraltäre
des 15. Jahrhunderts nur wenig die ursprüngliche Form
abgewandelt haben. Von dem eigenartigsten schlesischen
Meister des 14. Jahrhunderts, dem Meister der „Löwen-
„Schöne Madonna“
Breslau, Schles. Museum fiir Kunstgewerbe und Aitertümer
mengekommenen Werke bezeugen, daß Schlesien im
14. und 15. Jahrhundert eine Kunst gehabt hat, die sicli
in ihrer künstlerischen Qualität und Eigenartigkeit
durchaus nebcn der mittel- und westdeutschen behaup-
ten kann.
Die Blütezeit der schlesischen Plastik liegt in der
zweiten Hälfte des 14. und der ersten Hälfte des 15.
Jahrhunderts. 1327 hatte sich Schlesien an Böhmen
angeschlossen und trat als eine der Lieblingsstädte
Karls IV. in lebhafte Beziehung zu dessen kunstsinnigem
Hof in Prag. Die enge Verbindung schlesischer Plastik
mit Böhmen erkannte man zuerst in der Verwandtschaft
böhmischer Tafelbilder (z. B. der Marienbilder im Dom-
schatz zu Prag und im Stift zu Strahow) mit den „Schö-
nen Madonnen“, deren schönste, aus dem Breslauer
Kunstgewerbemuseum, auch ein Hauptstück d i e s e r
Ausstellung ist. Neben dieser Aufnahme böhmischer und
Maria mit Kind, aus einem Altar
Zobten a. Berge
madonnen“, ist das Hauptwerk zu sehen, eine sitzende
Madonna mit zwei Engeln und zwei Löwen (aus Herms-
dorf, jetzt Kunstgewerbemuseum, Breslau). Ihr breites
Gesicht, der lächelnde Gesichtsausdruck, die starre Hal-
tung sind für die Werkstatt dieses Meisters charak-
teristisch.
Das mystisch-asketische Gefühlsmoment des 14.
Jahrhunderts behcrrscht die drei großartigen Apostel aus
der Breslauer Magdalenenkirche (jetzt Kunstgewerbe-
museum) und findet seinen stärksten Ausdruck in dem
erschütternden Cruzifixus aus der Corpus Christi-Kirche,
einem Werk jenes Meisters vermutlich, der die Kreuzi-
gungsgruppe der Dumlose-Kapelle schuf. Allen diesen
Figuren, die nicht dem ganz von Böhmen abhängigen
Stilkreis der „Schönen Madonnen“ angehören, ist ein
herber Zug eigen, durch den die schlesische Plastik
wiedernm der sächsisch-thüringischen verwandter er-
12
wenn man außer den in den deutschen Museen vorhan-
denen schlesischen Arbeiten, vor allem die zahlreichen
in den Kirchen befindlichen Holzbildwerke und Male-
reien zusammenstellte. Es ist daher das Hauptverdienst
der Ausstellungsleitung, daß sie keine Mühe scheute,
sondern auch aus abgelegenen Dörfern schwer transpor-
table Bildwerke heranholte und in bester Beleuchtung in
den vor einigen Jahren von Hans Poelzig erbauten Aus-
stellungsräumen aufstellte. So sind allein 20 große voll-
ständigeSchnitzaitäre zu sehen, die zumTeil einen außer-
gewöhnlich gutenErhaltungszustand zeigen. DieMühe ist
nicht umsonst gewesen, denn die auf diese Weise zusam-
damit französischer und italienischer Formen entwickeln
sich jedoch bereits im 14. Jahrhundert Stilelemente, die
als spezifisch schlesisch angesehen werden miissen. Der
beliebteste Altartyp wird der „Viereraltar“, dessen
Mittelschrein meistens die Maria mit dem Kind und ihr
zur Seite übereinander die Heiligen Barbara, Margareta,
Katharina, Dorothea enthält. Einer der ältesten dieser
Art mit der Krönung Mariae im Mittelschrein (aus der
Kirche zu Polsnitz) verwendet noch viele Elemente des
frühen 14. Jahrhunderts und beweist, daß die Viereraltäre
des 15. Jahrhunderts nur wenig die ursprüngliche Form
abgewandelt haben. Von dem eigenartigsten schlesischen
Meister des 14. Jahrhunderts, dem Meister der „Löwen-
„Schöne Madonna“
Breslau, Schles. Museum fiir Kunstgewerbe und Aitertümer
mengekommenen Werke bezeugen, daß Schlesien im
14. und 15. Jahrhundert eine Kunst gehabt hat, die sicli
in ihrer künstlerischen Qualität und Eigenartigkeit
durchaus nebcn der mittel- und westdeutschen behaup-
ten kann.
Die Blütezeit der schlesischen Plastik liegt in der
zweiten Hälfte des 14. und der ersten Hälfte des 15.
Jahrhunderts. 1327 hatte sich Schlesien an Böhmen
angeschlossen und trat als eine der Lieblingsstädte
Karls IV. in lebhafte Beziehung zu dessen kunstsinnigem
Hof in Prag. Die enge Verbindung schlesischer Plastik
mit Böhmen erkannte man zuerst in der Verwandtschaft
böhmischer Tafelbilder (z. B. der Marienbilder im Dom-
schatz zu Prag und im Stift zu Strahow) mit den „Schö-
nen Madonnen“, deren schönste, aus dem Breslauer
Kunstgewerbemuseum, auch ein Hauptstück d i e s e r
Ausstellung ist. Neben dieser Aufnahme böhmischer und
Maria mit Kind, aus einem Altar
Zobten a. Berge
madonnen“, ist das Hauptwerk zu sehen, eine sitzende
Madonna mit zwei Engeln und zwei Löwen (aus Herms-
dorf, jetzt Kunstgewerbemuseum, Breslau). Ihr breites
Gesicht, der lächelnde Gesichtsausdruck, die starre Hal-
tung sind für die Werkstatt dieses Meisters charak-
teristisch.
Das mystisch-asketische Gefühlsmoment des 14.
Jahrhunderts behcrrscht die drei großartigen Apostel aus
der Breslauer Magdalenenkirche (jetzt Kunstgewerbe-
museum) und findet seinen stärksten Ausdruck in dem
erschütternden Cruzifixus aus der Corpus Christi-Kirche,
einem Werk jenes Meisters vermutlich, der die Kreuzi-
gungsgruppe der Dumlose-Kapelle schuf. Allen diesen
Figuren, die nicht dem ganz von Böhmen abhängigen
Stilkreis der „Schönen Madonnen“ angehören, ist ein
herber Zug eigen, durch den die schlesische Plastik
wiedernm der sächsisch-thüringischen verwandter er-
12